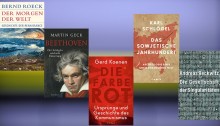Nicht immer gelingt der Jury der Leipziger Buchmesse eine überzeugende Auswahl für den Sachbuchpreis. Mal ist es das eine oder andere Buch, das in der intellektuellen Qualität gegenüber den anderen abfällt. Mal ist es die bunte Auswahl an Allerlei, der Verzicht auf eine Botschaft durch die Auswahl der Bücher. Dabei ist der Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse eine der schönsten und besten Gelegenheiten, eine Schneise der Vernunft durch die Unvernunft der Zeiten zu schlagen. Hier können die Bücher nominiert werden, denen dies gelingt.
Dieses Jahr gilt es jedoch ein großes Lob an die Jury auszusprechen. Jedes der von ihr nominierten Bücher, jeder der nominierten Autoren hätte es verdient, am 15. März als Sieger ausgezeichnet zu werden. Das eine oder andere Buch wurde bereits mit Preisen ausgezeichnet, zwei erscheinen in exklusiven historiographischen Reihen. Die Qualität der Werke lässt sich alleine an den begeisterten Buchbesprechungen ablesen. Die Zusammenstellung der Bücher tut ihr übriges. Von Umbrüchen und Umbruchszeiten handeln die ausgewählten Bücher. Umbrüche, Veränderungen, Umbruchszeiten gehören zur menschlichen Leben dazu. Veränderungen geschehen, aber nicht nur, sie werden gemacht, gemacht von Menschen, durch bewusste Entscheidungen zu Veränderungen, durch alltägliche Praxis des Neuen und Anderen.
Umbrüche und Veränderungen sind immer Menschengemacht, selbst wenn wir uns individuell als Opfer von Veränderungen verstehen, wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Sie beginnen ganz langsam, sie greifen langsam Raum, ihre Konsequenzen sind aber auch Jahrhunderte später wirkmächtig. Davon handelt Der Morgen der Welt – Geschichte der Renaissance von Bernd Roeck. Sie finden Ausdruck in einer Person, die diese Umbrüche in sich verkörpert und dadurch neue Veränderungen anstößt. Diese Geschichte erzählt Martin Geck in der Biographie über Beethoven – Der Schöpfer und sein Universum. Über die menschliche Hybris und ihre Erbschaften handeln die beiden Bücher, die den Beginn des 20. Jahrhunderts, dem »Zeitalter der Extreme«, zum Thema haben: die Russische Revolution 1917. Gerd Koenen führt in Die Farbe Rot zu den Ursprüngen und zur Geschichte des Kommunismus, Karl Schlögel zeigt in Das sowjetische Jahrhundert die Spuren und Hinterlassenschaften einer untergegangenen Welt auf. Andreas Reckwitz schließlich liefert mit Die Gesellschaft der Singularitäten eine Analyse, warum unsere Gesellschaft so ratlos gegenüber den Veränderungen, die etliche strahlende Sieger, aber ebenso Ungleichheiten, Paradoxien und viele Verlierer hervorgebracht hat. Die Jury hat mit diesen fünf Bücher eine brillante Antwort auf die heutigen Umbruchssituationen gegeben.
Zwei eher lästige Vorbemerkungen, die die glänzende Auswahl jedoch nicht trüben sollen: Alle nominierten Bücher stammen aus dem Jahr 2017. Dies ist insofern bemerkenswert, weil Verlage und Jury meist gern Bücher aus der aktuellen Kollektion präsentieren. Dies mag vielleicht daran liegen, dass die Bücher, die zu den relevanten Daten dieses Jahres – Ende des Ersten Weltkrieges vor hundert Jahren am 9. November; die Studentenunruhen, die zu den 68er-Bewegung werde, im Frühjahr und Sommer vor 50 Jahren – noch nicht erschienen sind. Vermutlich werden sie Thema im nächsten Jahr. Dieses Jahr ist zum anderen keine einzige Frau nominiert. Vielleicht ist diese Lücke umso offensichtlicher, als 2017 zum zweiten Mal eine Frau mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde: Barbara Stollberg-Rilinger mit ihrer Biographie zu Maria Theresia – Die Kaiserin in ihrer Zeit. Die erste Preisträgerin war übrigens 2008 Irina Liebmann mit ihrer Familiengeschichte Wäre es schön? Es wäre schön! Mein Vater Rudolf Herrnstadt.
Zurück zu den nominierten Büchern und Autoren des Jahres 2018, zu den Umbrüchen und Umbruchszeiten. Die kluge Auswahl der Jury besteht auch darin, das Buch von Bernd Roeck, Professor für Allgemeine und Schweizer Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich, an den Beginn zu stellen. Die Renaissance legt die Grundlage einiger Revolutionen, deren Zusammenspiel wir die Moderne nennen, oder, wie der Autor einschränkt, ihre westliche, weit wirkende Variante. Die Revolutionen sind die Mechanisierung der Welt, die im 13. Jahrhundert beginnt; die Verschränkung von Diskursrevolution als Ausfächerung weltlicher Themen und Medienrevolution durch die Erfindung Gutenbergs. Die Reformation als religiöse Revolte sowie eine Revolution der Naturwissenschaften. Diese zunächst lose nebeneinanderstehenden Revolutionen verbanden, verkoppelten, verschränkten, beeinflussten und verstärkten sich, sie veränderten die Welt. Die Renaissance in Europa steht am Anfang der westlichen Moderne. Es ist ein spezifisch europäisches Projekt, das auf sieben Säulen steht: Auf den geographischen und klimatischen Bedingungen; zweitens der staatlichen Vielfalt, die sich in politischer wie kultureller Konkurrenz manifestiert; des Weiteren die städtischen Mittelschichten, die die stark hierarchisierten Gesellschaften des Mittelalters durchbrachen; der Eindämmung der Religion: nicht der Himmel erwacht, sondern weltliches Denken, darauf verweist auch der Titel des Buches; der kritischen Diskurs mit der antiken und arabischen Philosophie und Wissenschaft: die Renaissance ist eine Revolution der Wissenschaft; sechstens auf der bereits erwähnten Medienrevolution, die die europäischen Denker zum bis dahin größten intellektuellen Kollektiv der Welt zusammenbrachte; und schließlich den Zeiträumen, die die Tiefenstrukturen des Historischen vermessen. »In den Umbrüchen, die am Anfang der Moderne stehen, gipfeln sich überlagernde Entwicklungen, die sehr unterschiedliche Ausgangspunkte hatten: Stränge von Ursachen und Wirkungen, die ihrerseits in Beziehungen zueinander gerieten und sich wechselseitig beeinflussten.«