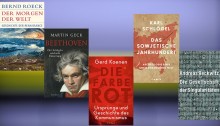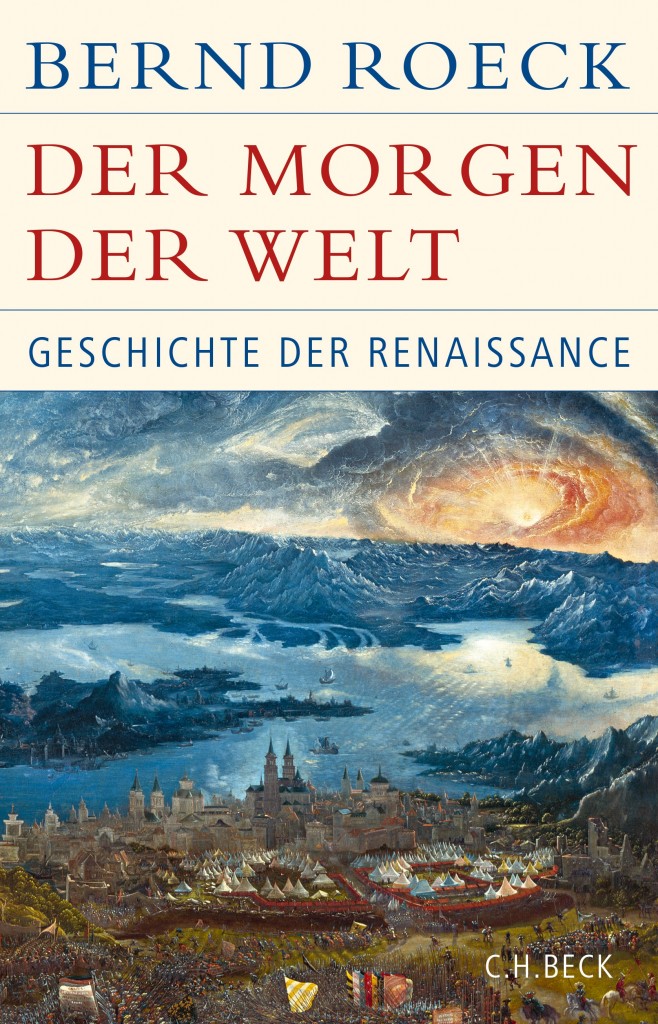
Bernd Roeck: Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance. Verlag C.H.Beck 2017. 1.304 Seiten. 44,- Euro.
Mit Roeck lernen wir, dass die Grundlage des Projekts der westlichen Moderne, deren aktuellen Zustand Andreas Reckwitz so vortrefflich analysieren wird, die Neuentdeckung intellektuellen Verarbeitens der Welt, die Renaissance antiken Wissens, der kritischen Austausch mit heidnischen und moslemischen Denkern und die Emanzipation gegenüber religiösem Denken als »Eindämmung der Religion« war. Die Renaissance war in erster Linie eine Befreiung von den Fesseln einer lediglich durch die Brille der mittelalterlichen Theologie wahrgenommenen Welt. Weil Roeck aus guten Gründen jeder monokausalen Erklärung misstraut, weitet sich sein Blick über die engen Grenzen Europas hinaus. Die Faszination des Buches macht der Vergleich Europas der Renaissance mit den Kulturen in anderen Regionen und Kontinenten der Welt. Roecks globale Perspektive führt uns in die muslimische Welt, nach China, Indien und Afrika. Die kulturellen Räume der Welt in den Jahrhunderten zwischen 1300 und 1700 standen im Austausch, sie waren nie in der Weise hermetisch abgeschlossen, wie es uns selbsternannte Bewahrer des Abendlandes vorgaukeln möchten. Die Offenheit der Welt, die Auseinandersetzung mit dem anderen ist ein Signum des westlichen Projekts.
Der 64-Jährige beschreibt die Renaissance aber nicht nur als Veränderungen in geistigen Sphären. Die Veränderungen materialisieren sich, sie finden Ausdruck in Buch, Brille, Fernrohr, Mikroskop und Tinte. Sie sind die Materialien moderner Wissenschaft, von Staatlichkeit und Bürokratie. Schließlich verändert sich dadurch auch das soziale Miteinander. Es verändert sich die Differenz von Vertikale und Horizontale. Vor allem in den Städten entwickelt sich ein neues Bewusstsein, der von einer Nähe, einem Zusammenhalt von Menschen, die sich auf derselben sozialen Ebene befinden und zu einer politischen Kraft werden. Diese Horizontale, wie Roeck sie nennt, steht in Konkurrenz zum vertikalen politischen Entwurf, bei dem vornehme und/oder reiche Akteure von oben nach unten politische und ökonomische Abhängigkeiten, Gefolgschaften oder Gruppierungen bilden, von deren Spitze aus sie kontrollieren und lenken. Es ist der Bürgerstolz, der sich gegen die Kultur des Ritterwesens durchsetzt. Er bildet die Grundlage einer gesellschaftlichen Ordnung, in der wir uns nach wie vor bewegen.
Die Entwicklungen, die die Renaissance anstößt, findet ihre Verkörperung ein paar Jahrhunderte später in Ludwig van Beethoven. Die Begriffe »Schöpfer«, »Universum«, »Titan der Musik«, die sich auf dem Einband finden, verweisen darauf. Dieser oberflächlichen Deutung widerspricht Martin Geck, ehemaliger Professor für Musikwissenschaft an der Universität Dortmund, entschieden. Ihm geht es nicht darum, Beethoven zu heroisieren, sondern ihn in seinen Bezügen zu anderen zu verstehen. Die Bezüge zum Leben wie zum Werk findet Geck nicht nur in Beethovens Gegenwart, sondern auch in dessen Vergangenheit und Zukunft. Diese anderen sind nicht nur Komponisten von Johann Sebastian Bach über Richard Wagner zu Igor Strawinsky, es sind auch Literaten wie Aldous Huxley, William Shakespeare oder Jean Paul, Maler wie Tintoretto oder Caspar David Friedrich, Philosophen wie Jean-Jacques Rousseau, Theodor W. Adorno oder Gilles Deleuze, Dirigenten wie Hans von Bülow, Wilhelm Furtwängler oder Leonard Bernstein sowie den Politiker zu Beethovens Zeiten: Napoleon Bonaparte.
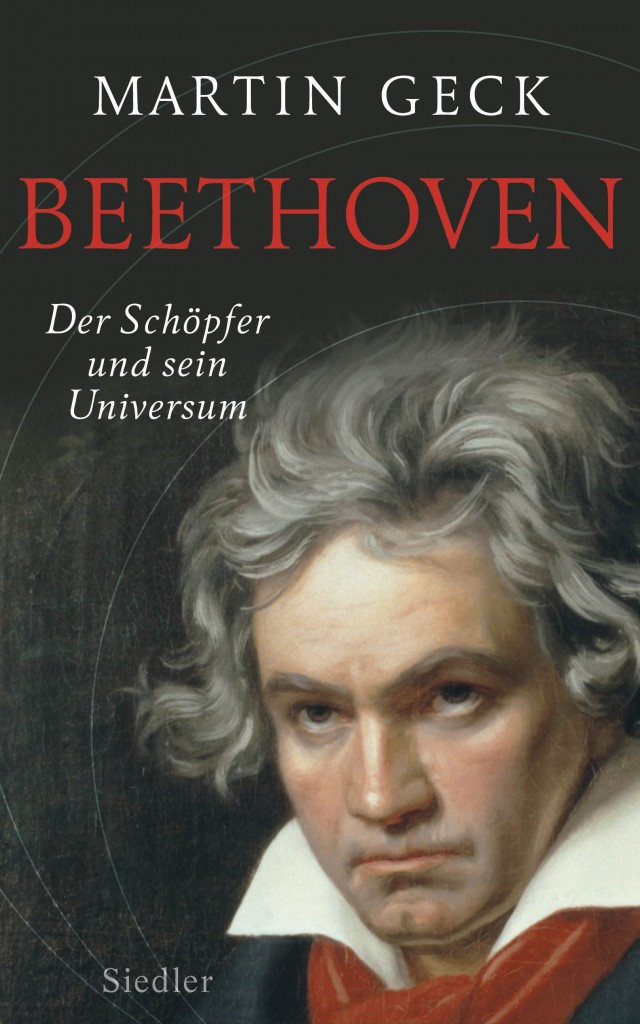
Martin Geck: Beethoven. Der Schöpfer und sein Universum. Siedler Verlag 2017. 512 Seiten. 26,- Euro.
Gecks Zugriff auf das Buch ist originell. Er schreibt keine chronologische Abhandlung zur Biographie und Kompositionen, sondern verfasst 36 Miniaturen, die in beliebiger Reihenfolge gelesen werden können. Geck kreist Beethoven ein: historisch, musikalisch, literarisch, philosophisch. Wie man ihn einkreisen möchte, liegt an der Lust und Laune der Leserinnen und Leser. Herauskommt keine klassische Erzählung eines großen, weißen Mannes, herauskommt aber auch nicht eine enge, auf die Musikwissenschaften bezogene Abhandlung über die Musik Beethovens. Geck verfasst keine musikalische Analyse des Notentextes des Komponisten. Beethoven und sein Universum verweist viel eher auf das intellektuelle Universum des Autors. Dieses Buch könnte auch heißen »Martin Geck und sein Universum. Dargestellt am Leben und Werk von Ludwig van Beethoven«. Geck ist ein Universalgelehrter alter Schule. Eines der schönsten Komplimente, die man einem Wissenschaftler machen kann, der in diesen Tagen 82 Jahre alt wird.
Mit seinem Beethoven-Buch verfolgt der Autor ein Anliegen. Er führt die zwei methodischen Ansätze – den hermeneutischen wie den analytischen Ansatz –, die aktuell in der Musikwissenschaft gegeneinanderstehen, zusammen. Weder geht es Geck alleine darum, einem plumpen Biographismus zu frönen, der die Werke mit den Gefühlen und biographischen Ereignissen des Komponisten deutet, noch in einer selbstverliebten Deutung von Noten und Komposition nach unterliegenden Botschaften zu suchen. Beethoven eignet sich für Geck auch deshalb so gut, weil er sich diesem aus zwei Perspektiven bereits angenähert hatte. In einer klassischen biographisch-musikalischen Monographie sowie in einer Abhandlung zu den neun Symphonien.
Für Geck ist Beethoven ein Mann der Moderne, der an dieser Moderne bereits leidet. »Das Versprechen der Moderne, dass alles besser wird, wenn jeder das Seine dazutut, hat er weder nur entlarvt wie Wagner oder Verdi noch nur beiseitegeschoben wie Debussy oder Strawinsky. Vielmehr hat er es in seinem Werk durchlitten. Die in seiner Zeit propagierte Selbstermächtigung des Menschen erlebt er nicht nur als wachsende Verfügungsgewalt des Komponisten über sein Material; vielmehr spiegeln seine Werke zum Ende hin zunehmend den Prozess der Fragmentierung alles Gesellschaftlichen und das Sich-fremd-Werden des Einzelnen.« Fragmentierung und Entfremdung bereits Anfang des 19. Jahrhunderts. Die bewusste intellektuelle Ermächtigung des Menschen über die Welt, die mit der Renaissance startete, erfährt hier bereits ihre ersten Risse. Vielleicht verweisen die letzten Sätze des Buches auf die Modernität Beethovens und auf das Kommende: »Doch das alles geschieht ohne Resignation: Leidenschaftlich und kämpferisch steht Beethovens Musik für ein Glück ein, das es noch zu erringen gilt.«