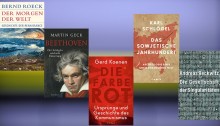Wegen seiner stilistischen und sprachlichen Fähigkeit hätte Reckwitz den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse bestimmt nicht verdient. Er hat das sprachlich sperrigste Werk vorgelegt. Von der intellektuellen Wucht, von der intellektuellen Tiefenbohrung, von analytischen Kraft gebührt ihm der Leipziger Sachbuchpreis allemal. Mit Die Gesellschaft der Singularitäten sieht man neu und anders auf unsere Gesellschaft. Auch anders und neu auf sich. Man entdeckt sich als Opfer, Treiber, Ermöglicher, Ausbeuter und Ausgebeuteter. Wir halten ein System am Laufen, dessen Grenzen wir erkennen, dessen Überforderung wir beklagen, dessen Profit wir einstecken.
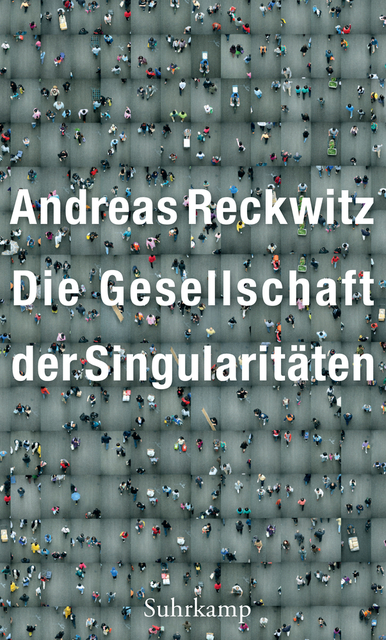
Andreas Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne. Suhrkamp 2017.
Für Reckwitz, dem mit seinen in Kürze 48 Jahren Jüngsten in der Runde, geht es um die alte soziologische Frage des Verhältnisses von Individualisierung Vergesellschaftung. Er stellt eine zunehmende Singularisierung, im weitesten Sinne eine weitere Drehung im Prozess der Individualisierung, fest. Das eigene Leben folgt nicht dem Allgemeinen, sondern dem Besonderen. Das eigene Leben ist besonders. Und diese Besonderheiten werden öffentlich gemacht, sie werden ausgestellt. Wir beginnen unser Leben nicht mehr nur zu führen, sondern es zu kuratieren. Wir setzen es ins rechte Licht, an den richtigen Ort, reihen uns zwischen denen ein, die unser eigenes Leben wertvoll machen und uns strahlen lassen.
Welche Strukturen liegen diesem Prozess zugrunde? Zunächst einmal die Bildungsexplosion, die in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhundert startete. Von damals 5 Prozent eines Jahrgangs, die auf die Universität gingen, stieg die Zahl auf 30 Prozent an. Aktuell liegt Studienanfängerquote bei 58,3 Prozent. Gestiegene Bildung steigert auch die Erwartungen. Vor allem an das Berufsleben. Out sind die 9-to-5-Jobs, die unkreativen Abarbeiterstellen. Heute muss alles innovativ und kreativ sein. So sind es die Kreativen, denen das besondere Augenmerk Reckwitz gilt. Aus dem »Arbeitsplatz als Kampfplatz für den Frieden« wird der kulturelle Kampfplatz für die eigene Profilierung. Kulturkapitalismus ist die Kategorie, mit der Reckwitz die Veränderungen im Ökonomischen beschreibt. Er meint damit der Prozess, nach dem bestimmte Dienstleistungen oder Waren, Erfahrungen oder Räume kulturalisiert werden: Die bestimmte Wohngegend mit spezifischen Charakter, die Restaurants mit den richtigen Gästen, die speziellen Sneaker, ganz bestimmte Kleidungsstücke. Auch im Kulturkapitalismus materialisieren sich die Ideen in Form von Gebrauchsgegenständen, deren wichtigste Eigenschaft ihre Einzigartigkeit sein müssen. Einzigartigkeit als Ausdruck des Besonderen. In Zeiten der technischen Reproduzierbarkeit, von denen Walter Benjamin schon 1935 geschrieben hat, ein schwieriges Unterfangen, und so müssen Gegenstände mit Bedeutung angereichert werden, damit sie dem harten Attraktivitätsdiskurs standhalten.
Kulturalisierung und Expansion des Bildungswesens schaffen neue Klassen. Keine Klassen, die es vor den Zeiten der nivellierten Mittelstandsgesellschaft, wie Schelsky die bundesrepublikanische Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet hatte, sondern neue Klassen. Die relevanteste unter ihnen ist die neue obere Mittelklasse. Sie zeichnet sich weniger durch harte Kategorien wie Wohlstand und Einkommen aus, als vielmehr durch ihre Werte, Ideale und Ansichten, die die Diskurse unserer Gesellschaften prägen. Die Kampfbegriffe von rechts – »links-grün-versifft«, »Mainstream-Presse«, »Systemparteien« – finden hier ihr politisches und kulturelles Gegenüber. Geschmacksherrschaft, Deutungshoheit und Möglichkeiten der Einflussnahme entwerten diejenigen, die offensichtlich nicht dazugehören: Die Verlierer der Bildungsexpansion, die Abgehängten auf dem flachen Lande, die Globalisierungsskeptiker, die alte nichtakademische Mittelschicht, die zunehmend an Boden verliert. Dies mit fatalen politischen Konsequenzen, die wir aktuell so sehr spüren: Die soziale Logik des Besonderen, deren Kern die permanente Bewertung von Eigenschaften und Gegenständen als das Besondere ist, schafft eine Gesellschaft ohne Gemeinsamkeit, ohne Gemeinsinn. Ohne Gemeinsinn, ohne Gemeinsamkeiten ist eine demokratische Ordnung jedoch nicht denkbar. Die Analyse von Reckwitz ist hart, aber treffend: »Die soziale Krise der Anerkennung, die kulturelle Krise der Selbstverwirklichung und die politische Krise von Öffentlichkeit und Staat lassen sich allesamt als Ausformungen einer Krise des Allgemeinen interpretieren, in die eine Gesellschaft gerät, die sich radikal an Besonderen ausrichtet.«
Wir befinden uns in dramatischen Zeiten, deren Dramatik wir an Abstimmungen über den Brexit, an Wahlen wie die Donald Trumps zum US-Präsidenten und an Entscheidungen, die Begrenzung der Amtszeit des chinesischen Staatspräsidenten aufzuheben. Die eigentlichen dramatischen Entwicklungen spielen sich auf Ebenen ab, auf denen wir alle tagtäglich spielen. Die Folgen dieser alltäglichen Plebiszite werden uns erst in ein, zwei Dekaden gewahr. Vielleicht wird 2068 ein Buch bei der Leipziger Büchermesse ausgezeichnet, welches die westlichen Demokratien als temporäre Erscheinung nach 1945 beschreibt, untergegangen in den politischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Wirren zwischen 2008 und 2025.
Der Pessimist erscheint immer klüger als der Optimist, dessen Naivität man in der Tat nie trauen sollte. Was die fünf Bücher, die für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse nominiert wurden, uns aber lehren, ist mit Veränderungen zu leben, sie zu gestalten und immer zu wissen, dass den Gewinnen immer auch ein Verlust gegenübersteht. Die Renaissance hat enorme Veränderungen angestoßen, deren Produkte wir nun sind. Wir sind die Menschen, die Reckwitz beschreibt. Keiner wird sich wünschen, 50, 100, 200 oder gar 500 Jahre früher gelebt zu haben. Wir sollten uns fürchten vor der Hybris der Menschen, die Kosten sind enorm. Wir sollten uns darum sorgen, ein gemeinsames Miteinander zu gestalten. Dazu bedarf es Institutionen, die zusammenführen. Dazu bedarf es Institutionen, die Schneisen der Vernunft in die Unvernunft der Welt schlagen. Dies hat dieses Jahr die Jury der Leipziger Buchmesse in einer grandiosen Weise geschaffen. Wer auch immer von den fünf nominierten Autoren am Ende ausgezeichnet wird, es wird der richtige sein.