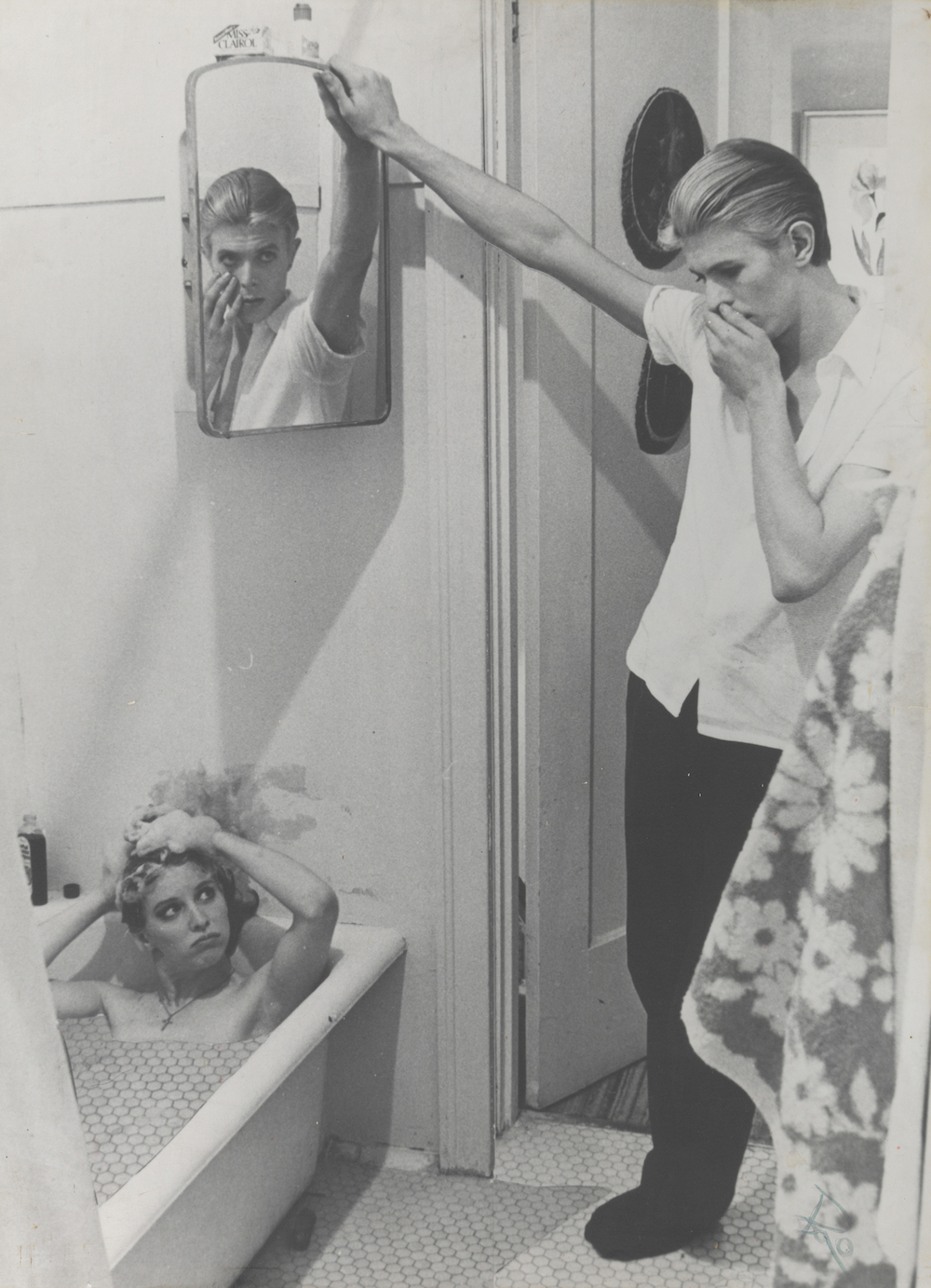Meine Bowie-Sozialisation ist vermutlich repräsentativ für meine Generation: Als Kind der Achtzigerjahre war ich zu spät gekommen für Bowies beste Zeiten. Also erschloss ich mir seine Siebziger im Schnelldurchlauf, zeitverzögert. Bald allerdings hörte Bowie auf, richtig Spaß zu machen – ein paar wirklich doofe Alben, seine Ausflüge ins Tapetendesign, und dann versteckte er sich auch noch hinter einem hässlichen Bart in der Muckerband Tin Machine. Es folgten die elektronischen Neunzigerjahre. Irgendwann hatte ich Bowie fast vergessen.
Mit Outside (1995) und nachfolgenden Alben kriegte er zwar wieder die Kurve, so einigermaßen. Doch von mir gab es dafür allenfalls wohlwollendes Desinteresse. 2002 landetet ich eher zufällig auf dem großartigen Berliner Konzert der Heathen-Tour, bei dem er, quasi als Zwischenprogramm zwischen alten und neuen Hits, sein Low-Album in voller Länge spielte: Für Bowie wohl eine kleine Verbeugung vor Berlin, für mich die Live-Darbietung meines wohl liebsten Albums aller Zeiten. Ich näherte mich wieder an, an den Held meiner Jugend. Zum ersten Mal seit den frühen Achtzigern hörte ich sogar das aktuelle Material mit Vergnügen – und langsam wurde mir klar, wie sehr Bowie meine innere Landkarte geprägt hatte. Ich entdeckte wieder, welcher Fundus an Ideen und Einflüssen in seiner Musik, aber vor allem in seinen wechselnden Bühnenpersönlichkeiten steckt.
An den Blaupausen, die Bowie gesetzt hat, haben sich zahllose Künstler – und nicht nur Musiker – abgearbeitet. Er hat Popmusik zu einer ganzheitlichen Erfahrung gemacht, und ganze Generationen haben von dieser erweiterten Bandbreite profitiert. Die Vielschichtigkeit des Gesamtkunstwerks Bowie konnte man sich schon als Teenager erschließen, intuitiv, ohne groß Ahnung zu haben von möglichen Subtexten und dem Referenzsystem, in dem Bowie sich bewegte.
Von postmodernen Ideen hatte man erst recht noch nichts gehört. Bowie aber war ein durch und durch postmoderner Popstar, vielleicht der erste große überhaupt. Er zitierte und amalgamierte, entzog sich definitiven Zuschreibungen und löste ganz nebenbei die Trennung zwischen progressiver Rockmusik (das, was junge Männer hörten) und Pop (für den bzw. für dessen Protagonisten weibliche Fans schwärmten) endgültig auf. Das Bild, das man sich von Popstars oder Rockmusikern machte, stellte Bowie gehörig auf den Kopf, die Vorstellung von einer authentischen Sprecherstimme sowieso.
»And that I wanted to be thought of as someone who was very much a trendy person, rather than a trend. I didn’t want to be a trend, I wanted to be the instigator of new ideas. I wanted to turn people on to new ideas and new perspectives. And so I had to govern everything around that.« DB 1976
Abstrakte Ideen übersetzte Bowie in konkrete Geschichten und greifbare Figuren. Und obwohl der begabte Rollenspieler sich Zuschreibungen entzog und sicher nicht zu jenen Popstars gehörte, die ihren Fans praktische Lebenshilfe anboten, hörte mein jugendliches Ich bei ihm ein Versprechen raus: dass man sich ein interessanteres Leben basteln kann. Nicht zuletzt steht Bowie dafür, sich in einer suboptimalen Welt selbst zu ermächtigen.
»You are not a victim, you just scream with boredom.« (Time, 1973)
Vielen seiner Fans gab Bowie erste Impulse, sich mit abseitigeren kulturellen Sphären zu beschäftigen. Ob es nun das japanische Kabuki-Theater war, auf das Ziggy Stardust verwies, sein androgynes Alter Ego, dass er 1972 geschaffen hatte und 1973 schon wieder killte, weil es ihm über den Kopf gewachsen war. Oder die Anregung, mit verschiedenen Schreibtechniken zu experimentieren. Faszinierend war etwa die von den Dadaisten erfundene und von William S. Burroughs – und eben auch Bowie – popularisierte Cut-Up-Methode, mit der er seine bisweilen enigmatischen Texte schrieb. Oder einfach auch nur die Entdeckung, was man mit den richtigen Klamotten alles anrichten kann.
Das alles lässt sich in der Ausstellung anschaulich nachvollziehen. Zu sehen sind da etwa die avantgardistischen Bühnenoutfits, die der japanische Designer Kansai Yamamoto Anfang der Siebzigerjahre für Bowies »Ziggy Stardust« und »Aladdin Sane«-Touren entworfen hatte – zu einer Zeit, als man in Europa kaum eine Vorstellung von zeitgenössischem japanischen Design hatte.
Oder das von Brain Eno und Peter Schmidt 1975 entworfene Oblique Strategies-Kartenset. Das basiert auf der Idee, durch aphorismenhafte Handlungsanweisungen den kreativen Prozess voranzutreiben. Für Bowie scheint das funktioniert zu haben. Insbesondere bei seiner hochgeschätzten Berlin-Trilogie (Low, »Heroes« und Lodger) soll die Technik zum Einsatz gekommen sein. Toll auch das Video zu Boys Keep Swinging, in dem Bowie nicht nur als Performer zu sehen ist, sondern gleich dreimal als Background-Sängerin in unterschiedlichen Drag-Kostümierungen auftritt. In dem demonstrativ naiven Text schaut Bowie so verwundert auf die Geschlechterzuschreibungen, nach denen die Menschen sich sortieren, wie es eben nur jemand kann, der ein halber Alien ist.
Zum Glück versuchten die Kuratoren der Londoner Ausstellung gar nicht erst, eine bestimmte Lesart von Bowies künstlerischer Entwicklung durchzusetzen und zu einem abschließenden Fazit zu kommen. Vielmehr setzten sie seine Einflüsse, die sich aus so vielen Quellen gespeist haben – von Hochkultur über Chansons bis zu Science-Fiction und Comics – in einen künstlerischen Zusammenhang – und ließen reichlich lose Ende. Was die Ausstellung unter anderem veranschaulichte: Bei Bowie gibt es keine Entwicklung, der man zwingenderweise folgen muss – schon gar nicht entlang einer Zeitachse.
»The truth is of course is that there is no journey. We are arriving and departing all at the same time.« DB 2002