
Vorderrad ist im Graben, mit ziemlichem Tempo reingerauscht, und sie sind alle tot, von außerhalb des Fahrzeugs in den Kopf geschossen.
Wer sich William Gibson stellen möchte, der braucht Durchhaltevermögen. Wohl kaum ein Autor ist bekannter dafür, seine eigene Sprache zu entwickeln. So prägte er in seinem wohl berühmtesten Werk „Neuromancer“ Wörter, die noch heute im Sprachgebrauch sind, wie Cyberspace oder Matrix. Auf diesen Erfindungsgeist muss man sich einlassen können. Gibson ist in der Science-Fiction zu Hause, weshalb diese technische Sprache ihre Berechtigung findet, den Lesegenuss jedoch für manche ausbremst.
„Er blickte wieder auf die Peripherals im Impostor Syndrome. Ihr krampfiges antimatronisches Diorama, das sich in völliger Stille darbot.“
Die Handlung ist komplex, da sie auf zwei Zeitebenen spielt und dies auch erst nach und nach dem Leser offenbart wird. Beide Epochen sind durch den Jackpot getrennt, eine verheerende Apokalypse, die den Großteil der Menschheit ausgelöscht hat. Vor der Apokalypse lebt Flynn mit ihrem Bruder Burton, für den sie ein Videospiel austesten soll. Dieses zeichnet sich durch eine virtuelle Welt aus, durch die sich der Spieler bewegt. Sein düsteres Setting ist jedoch alles andere als Fiktion, sondern die Welt, wie sie nach der Apokalypse aussieht – und Heimat von Wilf. Dieser arbeitet als PR-Agent für Promis, steht jedoch plötzlich vor dem Problem, dass eine seiner Klienten tot aufgefunden wird. Doch es gibt eine Zeugin: Flynn, die den Mord über das Spiel beobachtet hat. Von nun an müssen beide zusammenarbeiten und können nur über futuristische Technologien miteinander kommunizieren. Was als Detektivarbeit beginnt, weitet sich jedoch schon bald zu einer Verschwörung aus.
Viel Komplexität um eine seichte Grundstory
Wie eingangs gesagt, braucht man für dieses Buch viel Geduld. Wer nicht die ersten Seiten den Biss hat, durchzuhalten, wird vermutlich große Schwierigkeiten haben, dem Rest zu folgen – Hilfe bietet die Kürze der Kapitel. Vor allem die Zeit, in der Wilf lebt, strotzt nur so vor technischen Begriffen und Abkürzungen, die vor allem aber auch aktuelle Themen, wie Nanotechnologie oder soziale Netzwerke, aufgreifen. Gibsons Ideenreichtum und vor allem Komplexität im Denken kennen da wohl keine Grenzen und machen die Geschichte zu etwas Besonderem.
Nichtsdestotrotz zeigt sich hier, welche Art von Leser man ist, ob man nun eine Geschichte nachvollziehen muss oder auch einfach mal Informationen hinnehmen kann. Bei all der Ideenschmiede bleibt letztendlich trotzdem eine Grundstory, die auf Spannungsgehalt und Handlung bewertet werden kann: und die waren nicht hervorzuheben. Stattdessen hat man nach Beenden des Buches eher das Gefühl, dass viel zu viel drumherum gesponnen wurde, anstatt die eigentliche Geschichte voranzutreiben. So bleibt „Peripherie“ ein kompliziert zu lesender Science-Fiction-Roman ohne spannenden Inhalt.
Fazit:
Gibson bedient vor allem Science-Fiction-Fans, die Technik-Versierten, die in diesem Buch ihr Steckenpferd finden. Für solche, ohne diese Kenntnisse, dürfte es schwierig sein, der Geschichte zu folgen.
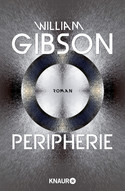
Peripherie
- Autor: William Gibson
- Verlag: Knaur TB



Deine Meinung zu »Peripherie«
Hier kannst Du einen Kommentar zu diesem Buch schreiben. Wir freuen uns auf Deine Meinungen. Ein fairer, respektvoller Umgang sollte selbstverständlich sein. Danke!
„I hate temporal dynamics“ ließ ein Drehbuchautor mal Miles O’Brien zu einem zeitlich versetzten Miles O’Brien in einer Episode von „Deep Space Nine“ sagen – und dieser Roman könnte eine gute Erklärung dafür sein, woran das liegen könnte. Stephen Fry hat sich in „Making History“ bereits mit der Möglichkeit beschäftigt, durch die Verschickung von Molekülen in die Vergangenheit – in diesem Fall Verhütungsmittel in das Trinkwasser von Branau am Inn in einem ganz bestimmten Jahr – beschäftigt. Aber selbst die Versendung solcher kleiner Stoffmengen über die Grenzen der Zeit erscheint nach wie vor eher etwas, dass für die Literatur interessant ist und weniger für die wissen-schaftliche Realität.
In „Peripherals“ ist Information das, was durch die Zeit reist – und zwar in beide Richtungen. Wie bereits in „Neuromancer“ in den 80er Jahren, spielt auch hierbei „Virtual Reality“ eine große Rolle. Menschen in einer nahen Zukunft bekommen Informationen darüber, wie sie etwas bauen können, mit dem sie in einer ferneren Zukunft sehr menschenähnliche Androiden steuern können. Die Menschen der ferneren Zukunft – der Zukunft nach dem „Jackpot“, haben ein großes Interesse daran, die Vergangenheit zu verändern – aber das gelingt nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt haben, denn die temporalen Dynamiken folgen ihren ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten und auch durch Zeitreise kann man anscheinend nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen.
Die Konzepte, die Sprache und die technologischen Entwicklungen in den beiden Zukünften, die hier präsentiert werden sind zum Teil interessant, zum Teil schräg und zum Teil eher albern – also eine Mischung, mit der man eventuell wirklich rechnen muss, wenn auch nicht notwendigerweise in der Form, wie sie hier vorgestellt werden. Viele Dinge, wie Drohnensteuerung in verschiedenen Zusammenhängen und die Möglichkeiten der Nano-Technologie als Hilfe oder auch als Waffe sind heute durchaus schon abzusehen – andere Sachen scheinen in erster Linie der eher pessimistischen Grundhaltung Gibsons zum Homo (mehr oder weniger) Sapiens zu entspringen.
Auf Grund der Sprache und der Situationen benötigt man vergleichsweise lange um in diesen Roman hinein zu finden und wenn man das dann getan hat und mit dem sich-selbst-auf-die-Schultern-Klopfen dafür fertig ist, dann merkt man schnell, dass die Struktur des Romans und die Charakterezeichnungen doch zu wünschen übrig lassen und man am Ende mit der nicht ganz unentscheidende Frage zurück gelassen wird: „Und dafür nun der ganze Aufwand?“ Nicht wirklich zu empfehlen.