
Reise in die dunkle Seite der Seele
Thomas Thomson ist ein junger Schriftsteller, der sich im London des Jahres 1914 als Ghostwriter für Groschenromane mehr schlecht als recht durchbringt. Zufällig trifft er auf den Anwalt Edward Norton, der jemanden sucht, der die unglaubliche Geschichte seines aktuellen Klienten aufschreibt: Marcus Garvey, ein ehemaliger Stallknecht, der sich auf eine Afrika-Expedition begeben hat, wird beschuldigt, William und Richard, die Söhne des Herzogs von Carver, im Kongo beraubt und ermordet zu haben. Thomson nimmt Nortons Auftrag an. In den nächsten Wochen und Monaten lauscht er im Gefängnis, wo Garvey auf seinen Prozess wartet, dessen Bericht.
Zusammen mit 100 schwarzen Trägern waren die Carver-Brüder mit Garvey, der sie als Koch begleitete, tief in den Dschungel des Kongo eingedrungen. Auf einer Lichtung stießen sie auf Gold, das William und Richard von ihren Trägern aus dem Boden schürfen ließen. Dabei geschah das Unglaubliche: Aus der Tiefe der Erde stiegen menschenähnliche aber albinoweiße Wesen an die Oberfläche. Die "Tektoner" waren zunächst friedlich, doch dank der Herrenmenschen-Attitüden der Carvers kam es wenig später zu offenen Feindseligkeiten. Für William und Richard waren die Tektoner nur "weiße Nigger", die aus ihrer Goldmine verschwinden sollten. Als allerdings Amgam, ein weibliches Mitglied der seltsamen Eindringlinge, auf der Bildfläche erschien, wurde sie zum Objekt eines erbitterten Streites zwischen Richard und Marcus; der eine begehrte Amgam, der andere verliebte sich in sie.
Die Lage wurde kritisch, als die Träger flüchteten. Von Goldgier geblendet, weigerten sich die Brüder, ihre Mine im Stich zu lassen. Das rächte sich, denn nun schlugen die Tektoner zurück. Ein blutiger Kampf begann, der im Inneren der Erde seinen Höhepunkt fand ...
In Afrika ist alles möglich
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es nur noch wenige weiße Flecken auf der Weltkarte. Nach Jahrtausenden schien das Ende der großen Entdeckungen nahe. Nur die unwirtlichsten Regionen (sowie die Tiefen der Meere) sträubten sich noch gegen neugierige Forschungsreisende und Waghälse. So waren die gewaltigen Dschungel Zentralafrikas noch weitgehend unerschlossen.
Afrika, der "dunkle Kontinent", beflügelte ohnehin die Fantasie von Glücksrittern und Träumern. Hier konnten unternehmungslustige Männer ohne Geld und Skrupel aber mit Mumm in den Knochen ihr Glück und ein Vermögen machen, denn Schätze warteten förmlich darauf, aufgelesen zu werden. Man musste nicht einmal fremden Boden betreten, denn die europäischen Großmächte hatten Afrika unter sich aufgeteilt.
Aus den Kolonien wälzte sich ein breiter Strom kostbarer Bodenschätze und Waren in die Mutterländer. Dem Selbstverständnis der Zeit entsprechend, galt dies als Privileg der Zivilisation, der sich die einheimischen "Wilden" nicht nur zu beugen hatten: Sie mussten die Ausbeutung ihrer Heimatländer als bessere Sklaven selbst vornehmen.
Der Kongo bildete in doppelter Hinsicht ein Mysterium. Große Teile des Landes waren von dichtem Dschungel bewachsen, dessen potenzielle Gefahren beträchtlich und zudem unbekannt blieben. Von 1885 bis 1908 war die Kolonie Privatbesitz eines einzigen Mannes gewesen: König Leopold II. von Belgien (1835-1909) hatte ´seinen´ Kongo wirtschaftlich ausgepresst und unglaubliche Gräuel gegen die Bevölkerung ausdrücklich gebilligt, bis es sogar der in der Kolonialfrage nicht zimperlichen Restwelt zu viel und Leopold enteignet wurde.
Ein Ort als Katalysator für das Böse
1899 versuchte der Schriftsteller Joseph Conrad (1857-1924) eine literarische Interpretation der Ereignisse im Kongo. Mit "Heart of Darkness" (dt. "Herz der Finsternis") wollte er ergründen, wieso und wie der Mensch zum Moloch mutieren kann, wenn ihm keine Grenzen gesetzt werden. Conrads Novelle ist neben der historischen Realität eine der Hauptquellen, aus denen Albert Sánchez Piñol schöpft. Wie bei Conrad der Handelsagent Kurtz streifen die Brüder Richard und William Carver ihre ´zivilisierte´ Zurückhaltung ab, als sie Afrika erreichen. Eine Gesetzgebung, die ihnen, den "weißen Herren", alle Rechte zuspricht, und die Isolation des Urwalds lassen Züge, die sie bisher unterdrücken mussten, die Oberhand gewinnen. Die Carvers werden zu Unmenschen. Aufgrund ihres gesellschaftlichen Standes und ihrer Erziehung, die sie in der Überzeugung, wahre "Herrenmenschen" zu sein, sogar noch bestärkt, geben sie jeder Laune ohne Gewissensbisse nach. Mit einer Bestrafung müssen sie nicht rechnen, und bald ist ihnen dies ohnehin gleichgültig, da sie nicht vorhaben, Zeugen überleben zu lassen.
Zum Ausbruch solcher Grausamkeit trägt die Umgebung nachhaltig bei. "Der Kongo. Ein grüner Ozean. Und unter den Bäumen - nichts", lesen wir mehrfach. In dieser uralten, seltsamen Welt verändern sich die Menschen. Während die Carvers moralisch degenerieren, emanzipiert sich Marcus Garvey. Aus einem Untertanen und Diener wird ein freier Mann, der seine anerzogenen und aufgezwungenen Fesseln abstreift.
Schwarze und weiße Neger
Dem schließt sich in einem parallelen "coming-of-age"-Erzählstrang der junge Thomas Thomson. Er ist der klassische "reine Tor", der idealistisch seinen Lebensweg beginnt, um auf den Klippen der Realität immer wieder Schiffbruch zu erleiden. Der naive Jüngling ist ein ideales Opfer, was für das Gesamtgeschehen unbedingt erforderlich ist. Das zu erkennen (und sich damit der finalen Überraschung dieser gewandt präsentierten Schauermär zu berauben), fällt dem Leser freilich schwer, denn er wird von Piñol geschickt abgelenkt. "Pandora im Kongo" ist ein Roman der Allegorien, die erfreulich unaufdringlich bleiben, d. h. nicht Literatur um der Literatur willen sein möchten, sondern im Dienst der Handlung stehen.
Deshalb lasse man sich nicht aufs Glatteis führen: "Pandora im Kongo" ist kein modernisierter "Herz-der-Finsternis"-Aufguss, der noch einmal und unter Berücksichtigung moderner Gutmenschen-Manier vergangene Schrecken aufleben lassen soll. Piñol unterstreicht stattdessen unangenehme Wahrheiten: Das Verhalten der kolonialen Herren entsprach rechtlich und moralisch zeitgenössischen Standards, und in den profitierenden Mutterländern interessierte man sich herzlich wenig für die Verletzung von Menschenrechten, solange dies nicht übertrieben wurde, wobei die Erkenntnisschwelle aus heutiger Sicht erschreckend hoch lag.
Gleichzeitig zieht der Verfasser eine kühne Verbindungslinie zwischen dem Kongo und England. Auch Thomas Thomson ist ein "Neger" und wird so behandelt, nämlich betrogen, ausgebeutet und nicht für voll genommen. "Neger" ist eine im Schriftstellergewerbe fixierte Bezeichnung. Sie beschreibt einen Autor, der für seinen zahlenden Kunden die eigentliche Arbeit - Recherche, Schreiben, Korrektur - übernimmt, diesem den Verfassernamen und damit die (potenzielle) Anerkennung als kreativer Künstler überlässt.
Reise zum Mittelpunkt der Erde
Die Begegnung mit den Tektonern und die Irrfahrt zu ihrer Höhlenstadt ist vordergründig eine "lost-race"-Fantasy, wie sie um 1900 verbreitet und erfolgreich war. Verfasser wie Jules Verne, Edgar Rice Burroughs oder Henry Rider Haggard beschrieben abgelegene Erdwinkeln, welche die Zeit vergessen hatte, und ihren exotischen Bewohnern, die von mutigen (europäischen oder US-amerikanischen) Reisenden aufgesucht/zivilisiert/bekämpft wurden. (Aus heutiger Sicht bietet sich zusätzlich die Deutung der Tektoner als Außerirdische an, die sich im Inneren der Erde angesiedelt und ausgebreitet haben. Eine dritte Interpretation kommt dem Leser dank der Erzählkunst des listigen Verfassers lange nicht in den Sinn.)
Gleichwohl ist Piñols Sicht auf diese Ereignisse aktuell. Vorbei sind die Zeiten, als mutige Eroberer heulende Wilde zu Hunderten und als Methode der Spannungsförderung abknallen durften. Zwar geschieht dies auch in "Pandora im Kongo", doch hier steigert es Schrecken und Abscheu vor einer verdammungswürdigen Praxis. Die offenkundige Sachkenntnis des Autors, der als Anthropologe den (realen) Kongo bereist hat, fließt einmal mehr überzeugend in die Handlung ein. (Selbstverständlich wäre eine Liebesgeschichte wie die zwischen Marcus und Amgam in einer ´klassischen´ Fantasy undenkbar gewesen.)
So zieht die ebenso grausame wie faszinierende Kongo-Mär ihre fiktiven ebenso wie die realen Leser in den Bann. Die Auflösung mag subjektiv manchen Kritiker unzufrieden zurücklassen, doch sie ist dort konsequent, wo man mit einer ´logischen´ Erklärung nicht mehr gerechnet hat. Beeindruckt ist man darüber hinaus durch die Eleganz der Erzählsprache; ein Lob, das hierzulande die Übersetzerin ausdrücklich einschließt.
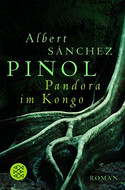
Pandora im Kongo
- Autor: Albert Sánchez Piñol
- Verlag: Fischer



Deine Meinung zu »Pandora im Kongo«
Hier kannst Du einen Kommentar zu diesem Buch schreiben. Wir freuen uns auf Deine Meinungen. Ein fairer, respektvoller Umgang sollte selbstverständlich sein. Danke!
Denke, dass es ein brillanter Roman ist und nicht schlechter als Rausch der Stille. Nur anders. Das Thema ist ein ganz anderes. Pinol führt uns zunächst alle aufs Glatteis, indem er eine Geschichte schreibt, die der „Stille“ so ähnlich ist, dass wir einen ähnlichen Ausgang erwarten. Sagt ihr mir worum es in der Stille geht, möglicherweise die Aggressivität der menschlichen Rasse, Liebe, etc. Im Kongo geht es einzig und allein ums Erzählen, um das Vermögen eines kreativen, fantasiereichen Kopfes, eines Schriftsteller halt, die Welt durch Erzählen (siehe Klappentext) aus den Angeln zu heben. Üblicherweise passiert das nur im Kopf des Lesers, hier hat ein Buch weitreichendere Konsequenzen (den Freispruch eines Mörders). Wird nicht zuletzt deutlich, dass die Geschichte zu 100% vom Ich-Erzähler erfunden wurde, da ja sogar die Vorlage für Garveys Lügengeschichte der frühe Groschenroman ist, den der Ich-Erzähler geschrieben hatte? An einigen Stellen, vor allem bei der Liebesgeschichte hatte ich irgendwie immer leise Zweifel, ob das nicht etwas zu dick aufgetragen ist und konnte sie nicht richtig nachvollziehen. Ich hätte mich nie getraut, den Gedanken zu fassen, dass alles eine Lüge ist. Das ist aber letztlich der Fall und somit der Grund für meine Zweifel, sowas so fantastisches kann einfach nicht wahr sein. Ein genialer Streich von Pinol.
Mir hat das Buch wirklich sehr gut gefallen!
Ich habe es auf diese Rezension hin gekauft und bin bin alles andere als Enttäuscht worden. Im Nachhinein kann ich der Rezension voll und gnz zustimmen, sie beschreibt die Qualitäten sehr passend.
Besonders gefallen hat mir zum einen die Sprache Pinols die sich qualitativ wirklich positiv absetzen kann und definitiv als Literatur bezeichnet werden kann und zum Anderen die mehreren Ebenen im Roman, so dass der Leser anfängt mit der Geschichte zu verschmelzen, mitzufühlen und sich mit Thomson sogar identifizieren kann. Das wurde von Herrn Pinol wirklich hervorragend gelöst!
Das Ende hat mir zu dem ebenfalls gut gefallen und es überrascht wie sehr am Ende alles einen Sinn macht und sich selbst kleine Hinweise letztendlich in die Geschichte einfügen und Sinn machen. Gelangweil habe ich mich über die fast 500 Seiten hinweg wirklich kein bisschen. Glecihwohl man hier keinen klassischen Page-turner erwarten sollte der einem vor Spannung dem Atem raubt. Vielmehr hab ich mich der Geschichte hingegeben und konnte sie mit großem Interesse genießen.
Daher von mir großes Lob für den Roman, einer der besten die ich in letzter Zeit gelesen habe.
Pinol schreibt in einer Art und Weise, die an die klassischen Krimis erinnert und kann trotz dieser Erzählweise schocken, in dem er Bilder in des Lesers Kopf erweckt ohne Grausamkeiten explizit zu schildern.
Nach einem verwirrenden Beginn und einem sehr lustigen 2 Kapitel plätschert die Story vor sich hin, ohne grosse Höhepunkte, aber nie uninteressant. Der Mittelteil des Buches zieht sich dann aber arg in die Länge und ich kam nicht voran. Selten schaffte ich mehr als 20 Seiten am Stück und das ist ja auch irgendwie ein Qualitätsurteil.
Wie beim klassischen Krimi erzählt Pinol auch zuerst den „Fall“, um danach alles aufzulösen. Das Ende ist überraschend und hat mich überzeugt, denn ich hätte nicht gedacht, dass er die losen Fäden so gekonnt wieder zusammen fügen kann, aber die vielen Längen und vor allem die Parallelen zu seinem ersten Buch hinterlassen dann doch einen überwiegend negativen Geschmack.
Schreiben kann er, der Pinol, aber im grossen und ganzen hat mich das Buch gelangweilt.