Sie wachen nachts auf, weil Sie ein dringendes Bedürfnis verspüren. Schlaftrunken wälzen Sie sich nackt aus dem Bett, machen sich auf den Weg zur Toilette, ziehen die Tür hinter sich zu und merken: Das ist nicht das Badezimmer, das ist das Treppenhaus! Oskar Simon versammelt in seinem Buch unzählige solcher Peinlichkeiten. Er liefert außerdem spannende Erkenntnisse über medizinische und psychologische Hintergründe von Schamgefühlen. Wann und warum der Autor sich selbst schon in Grund und Boden geschämt hat, verrät er im Essay.
von Oskar Simon

Shit happens
Die Geschichte begann mit einem üblen Fehltritt. Für ein Interview mit dem berühmten Philosophieprofessor S. war ich von ihm zu sich nach Hause eingeladen worden. S. empfing mich an der Haustür, nahm mir meinen Mantel ab und wies mir den Weg ins helle Wohnzimmer. Kaum hatten wir uns gesetzt, stieg uns beiden ein ekliger Geruch in die Nase: Offensichtlich war ich auf dem Weg vom Autor zu S.’ Haus in einen Hundehaufen getreten, jedenfalls führte von der Haustür durch Flur und Wohnzimmer eine kackbraune Spur, die exakt bei meinem Füßen endete. Das folgende eineinhalbstündige Gespräch führten wir unter höchster Anstrengung (und zumindest in meinem Fall: mit latentem Brechreiz) so, als wäre nichts geschehen. Noch viel schmerzhafter aber war für mich die Vorstellung, dass Professsor S. nach unserer Verabschiedung auf dem Boden herumgerutscht sein und die Kacke aus seinem Teppich zu wischen versucht haben musste. Fürchterlich.
Noch Monate später lief es mir, wenn ich an diese Peinlichkeit dachte, kalt und heiß den Rücken herunter. Gleichzeitig machte ich eine interessante Feststellung: Wenn ich anderen von der Episode erzählte, konnte ich gemeinsam mit ihnen über sie lachen. Und danach grinsten wir meist über die peinlichen Geschichten, die die Anderen erzählten. Es war immer unterhaltsam. Schließlich gibt es eine Menge zu erzählen. So entstand die Idee zu einem Buch.
Ausnahmslos jede(r) ist zuweilen peinlich – ganz unabhängig davon, ob er jung, reich, hyperintelligent oder notorisch ungeschickt ist. Shit happens to everyone. US-Präsident George W. Bush senior übergab sich während eines Staatsbanketts in den Schoß des japanischen Premierministers Kiichi Miyazawa. Doris Dörrie unterhielt sich bei einer Preisverleihung ausgiebig mit einem silberhaarigen Herrn, den sie für einen Filmproduzenten hielt. Es war Bundespräsident Roman Herzog. Und der Schauspielerin Jennifer Lawrence sahen Millionen Augenpaare zu, wie sie im vermutlich größten Moment ihrer Karriere der Länge nach hinschlug – auf dem Weg zur Bühne, auf der sie gerade ihren Oscar entgegennehmen sollte.
Andere Länder, andere Peinlichkeiten
Peinlichkeit ist ein universelles Gefühl, das uns über Kontinente, Kulturen und Jahrhunderte begleitet wie die notorisch wiederkehrenden Grippewellen. Allerdings schämt man sich regional höchst unterschiedlich. Chinesen beispielsweise ist öffentliches Naseschnäuzen peinlich, Tuareg-Männern das Unterwegssein ohne Gesichtsschleier, Nordeuropäern ein vergessenes Preisschild auf einem Präsent, was in Asien wiederum zum guten Ton gehört, weil man ja zeigen will, was man investiert hat. Verschieden auch die Bezeichnungen für glühende Osram-Birnen: Wer rot anläuft, muss sich je nach Sprache als Tomate, Kupferplatte oder auch Paprika verspotten lassen. Übrigens werden Menschen mit dunkler Hautfarbe genauso schamrot wie Blinde, auch wenn man es den einen kaum ansieht und die anderen es selbst nicht sehen können. Die einzigen Primaten, die nicht peinlich berührt erröten, sind Kleinkinder und Affen. Bleibt die Frage: Warum tun wir das?
„Scham ist der entscheidende Mechanismus, um die Zusammenarbeit in Gruppen zu etablieren und aufrechtzuerhalten“, weiß der Anthropologe Daniel Fessler von der University of California. Um diesen Zusammenhalt zu stärken, greift man mitunter zu drastischen Mitteln. Im Hoch- und Spätmittelalter beispielsweise wurden von Schweden bis Portugal Vergehen wie Lügen oder Diebstahl mit so genannten Scham- oder Ehrenstrafen sanktioniert. Bäcker spannte man auf den Karren, wenn sie zu kleine Brötchen gebacken hatten, Fischhändler, deren Ware verdorben war, wurden an den Pranger gestellt. Wer schlecht über Andere gesprochen hatte, wurde mit einem Halseisen durch den Ort gejagt, schließlich gefährdet Rufmord den inneren Frieden einer Gemeinschaft. Ehebrecher trieb man splitternackt durch die Straßen, wobei die Hände der Frau gefesselt, das Seil zwischen ihren Beinen durchgeführt und um den Penis des hinterherstolpernden Mannes geknotet wurde.
Der milde Kern der Scham
„Klingt zweifelsohne ziemlich martialisch“ meint Jörg Wettlaufer, Medizinhistoriker an der Universität Göttingen. „Aber der Kerngedanke der Schandstrafe war immer Vergebung.“ Wenn jemand seine Verfehlungen aufrichtig und öffentlich bereut hatte, war die Sache gut. Der Bäcker durfte nach seiner ungemütlichen Karren-Tour in die Backstube zurückkehren, die Ehebrecherin zu ihrer Familie. Auf diese Weise erfüllten Schamstrafen gleich einen doppelten Nutzen: Dem Delinquenten wurde die Vertreibung und damit ein existenzielles Risiko für Leib und Leben erspart. Seine Gemeinschaft wiederum vermied zermürbende Konflikte, langwierige Prozesse und den Verlust eines ihrer Mitglieder. Das war die Idee. Und genau darin steckt der milde Kern der Scham.
Was mit unserem Körper passiert, wenn wir uns bloßgestellt fühlen, ist mittlerweile ziemlich gut erforscht. Sally Dickerson, Psychologin an der Universität von Los Angeles, bat eine Gruppe von Versuchsteilnehmern, den blamabelsten Moment ihres Lebens noch einmal Revue passieren zu lassen. In den Speichelproben ihrer Probanden entdeckte Dickerson danach erhöhte Konzentrationen genau jener Immun-Signalstoffe, die unser Organismus auch bei Infektionen aktiviert. Botenstoffe wie Tumornekrosefaktor-A sorgen dafür, dass die Durchblutung angekurbelt, Schutzzellen schneller aktiviert und Abbauprodukte effektiv entsorgt werden. Sie lassen aber nicht nur den Kopf heiß und das Gesicht rot werden, sondern erzeugen auch ein Krankheits- und Lähmungsgefühl, das den Organismus bewegen soll, alle verfügbaren Ressourcen dem Immunsystem zu überlassen. Die Folge: In peinlichen Augenblicken fühlen wir uns plötzlich schachmatt wie bei einer einsetzenden Grippe. Die Symptome dieser Pseudo-Grippe wiederum – roter Kopf, schlappe Haltung – sind zwar persönlich extrem unangenehm, aber gesellschaftlich sehr nützlich.
„Durch öffentliches Erröten räumen Menschen einen Fehler ein“, so der amerikanische Psychologe Mark Leary. „Sie unterstreichen ihre Unterstützung für die Spielregeln, die sie übertreten haben und bekunden implizit, dass ihr ungeschicktes, dummes oder unerwünschtes Verhalten keineswegs als Ausdruck ihrer Persönlichkeit missverstanden werden soll.“ Auf diese Weise fungiert Scham als ein sich permanent aktualisierendes gesellschaftliches Antivirenprogramm: Es signalisiert einerseits, dass gerade etwas schief gelaufen ist und der Verursacher – klar erkennbar an seiner roten Birne – seinen Fehltritt bereut. Dadurch beschwichtigt er die Anderen und vermeidet Bestrafung. System-Neustart überflüssig.
Die Grundregeln souveräner Peinlichkeit
Jene Freundin, der mein Buch seinen Titel verdankt, hatte allerdings gar nichts Schlimmes verbrochen. Sie war einfach nur eines Nachts in ihrer neuen Wohnung im 5. Stock eines Mietshauses splitternackt aufs WC gegangen. Die Tür, die sie hinter sich zuzog, war allerdings nicht die Klo-, sondern die Wohnungstür (Ihre Rettung wurden dann zwei Fußmatten, die sie als notdürftige Körperbedeckung nutzte, und ein Sack Altkleider im Keller des Hauses, aus denen sie sich bediente).
Was hilft in solchen Momenten, sind die drei Grundregeln souveräner Peinlichkeit. Erstens: Rückgängig machen lässt sich eh nichts. Zweitens: Selbstironie hilft. Vor allem aber: Wirklich peinlich ist nur, bei alledem nicht über sich selbst lachen zu können.
Das Buch
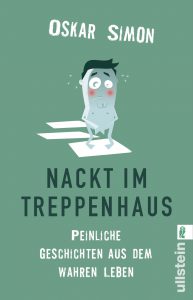 Jeder kennt das Gefühl: Nach einer Ungeschicktheit oder einer Blamage will man am liebsten sofort im Boden versinken. Peinliche Momente sind wie barfuß gegen ein Tischbein zu laufen: ein stechender Schmerz, der nur langsam abklingt und an dem man sich auch viel später noch erinnert. Denn auf den Schmerz folgt postwendend die Scham. Gleichzeitig zählen peinliche Momente zum Witzigsten, was man erzählen kann. Und am Allerlustigsten sind Missgeschicke, die anderen unterlaufen sind.
Jeder kennt das Gefühl: Nach einer Ungeschicktheit oder einer Blamage will man am liebsten sofort im Boden versinken. Peinliche Momente sind wie barfuß gegen ein Tischbein zu laufen: ein stechender Schmerz, der nur langsam abklingt und an dem man sich auch viel später noch erinnert. Denn auf den Schmerz folgt postwendend die Scham. Gleichzeitig zählen peinliche Momente zum Witzigsten, was man erzählen kann. Und am Allerlustigsten sind Missgeschicke, die anderen unterlaufen sind.
Link
„Nackt im Treppenhaus“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

