Ready for Hillary? Schafft es Hillary Clinton im zweiten Anlauf nach 2008, Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu werden – oder sogar ins Weiße Haus einzuziehen? ARD-Korrespondent Ingo Zamperoni widmet sich den Pros und Contras in dieser Frage.
von Ingo Zamperoni

Es gibt diesen alten Witz unter Wanderern in Amerikas Nationalparks. Wenn Du einem Bären begegnest, musst Du nicht schneller sein als das Raubtier. Du musst nur schneller sein als Deine Mitwanderer. Übertragen auf die amerikanische Politik bedeutet das: Du musst kein perfekter Präsidentschaftskandidat sein, du musst nur einen Tick besser sein als Deine Mitbewerber. Zumindest in den Augen des Wahlvolks.
Als am 13. Oktober 2015 erstmals die Kandidaten der Demokraten für die Nominierung für das Weiße Haus gemeinsam auf einer Bühne in Las Vegas standen, um vor einem Millionenpublikum ihre erste Fernsehdebatte zu bestreiten, wurde die ganze Misere der Demokratischen Partei sichtbar. Ganze fünf Kandidaten waren zu der Ansicht gekommen, dass sie das Land am besten führen könnten. Und man hatte den Eindruck, mindestens zwei davon waren nur zur Debatte eingeladen worden, damit es nicht ganz so armselig aussehen würde. Allein Bernie Sanders, der knorrige Senator aus Vermont, konnte an diesem Abend auch nur annähernd der Frau Paroli bieten, die zwischen diesen Männern in der Mitte souverän und motiviert den Schaukampf für sich entschied: Hillary Clinton. Das also war das Aufgebot der Demokraten für das mächtigste Amt der Welt: vier weiße Männer von überschaubarem politischen Erfolg und eine Frau im besten Rentenalter, die schon einmal acht Jahre im Weißen Haus verbracht hatte (wenn auch in anderer Funktion). Man mag von dem Zirkus, den die anderthalb Dutzend republikanischen Präsidentschaftsbewerber demgegenüber veranstaltet haben, halten, was man mag. Aber immerhin hatten sie eine bunte Mischung im Angebot.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, welchen Enthusiasmus vor allem bei jüngeren, bis dahin politisch wenig engagierten Wählern Barack Obamas Kandidatur und Wahl im Herbst 2008 ausgelöst hatte. Damals ging ich davon aus, dass dies eine ganze Generation von jungen, ehrgeizigen Nachwuchspolitikern hervorbringen würde, angefacht von der Obama-Change-Hope-Botschaft, die die politische Landschaft prägen würden – zumindest das künftige Bild der Demokratischen Partei. Acht Jahre später scheint davon nicht viel übrig zu sein.
Allerdings ist es sehr gut möglich, dass der Grund für diese dünne Kandidatendecke bei den Demokraten keine geringere als Hillary Clinton selbst ist. Eigentlich reicht in den USA längst nur der Vorname, wie bei einem Popstar, und jeder weiß, wer gemeint ist. Ready for Hillary! Man muss weit in der Geschichte dieser Nation zurückgehen, um eine Präsidentschaftswahl zu finden, bei der ein Kandidat, der nicht der Amtsinhaber ist, so früh als haushoher, quasi gesetzter Präsidentschaftskandidat gehandelt wurde wie in diesem Fall. Im Prinzip begannen die Spekulationen um Hillarys möglichen Run 2016 mit ihrem Ausstieg aus dem ersten Obama-Kabinett, in dem sie vier Jahre als Außenministerin ihr internationales Profil schärfen konnte. Lange hatte sie sich geziert, hatte abgewiegelt, Gerüchte dementiert. Vielleicht hatte sie kokettiert, um das Interesse an ihr köcheln zu lassen. Vielleicht hatte sie aber wirklich Zeit gebraucht, um zu einem Entschluss zu kommen. Vizepräsident Joe Biden hatte es, als er Gerüchten um seine Kandidatur eine Absage erteilte, in etwa so formuliert: Du musst dieses Amt wirklich wollen, und du musst dafür alles geben, was du in dir hast. Würde sie sich das wirklich noch einmal antun wollen? Die Strapazen des monatelangen Vorwahlkampf-Marathons? Und dann das aufzehrende Amt erst?
Das Rennen ums Weiße Haus dürfte ein schmutziges werden
Als Anfang 2015 immer noch keine klaren Signale aus dem Clinton-Lager kamen, wurde das Grummeln in der Demokratischen Partei unüberhörbar. Denn so lange sie sich nicht öffentlich erklärt hatte, traute sich offenbar auch kein anderer, den Hut in den Ring zu werfen. Clinton paralysierte ihre Partei. Die Haltung war wohl, dass sich eine Kandidatur gegen sie kaum lohnen würde. Falls sie aber doch nicht wollte, wurde es immer später für die anderen, die notwendige Maschinerie in Gang zu setzen. Insofern gab es sicherlich eine Menge Erleichterung bei den Demokraten, als es im April 2015 endlich so weit war und Hillary Clinton ohne viel Pomp per Internet-Video ihre Kandidatur offiziell bekannt gab.
Nun also ein zweiter Anlauf auf die Geschichtsbücher – sie wäre nicht nur die erste Frau im Oval Office, sondern auch die erste First Lady, die als Chefin ins Weiße Haus zurückkehren würde. Rein auf dem Papier ist die gelernte Juristin die Qualifizierteste von allen. Niemand hat eine breitere politische Erfahrung im Lebenslauf vorzuweisen. Nach den unrühmlichen Turbulenzen gegen Ende von Bill Clintons Amtszeit strampelte sie sich aus dem Schatten ihres Mannes frei und erkämpfte sich den Senatsposten für den wichtigen US-Bundesstaat New York – zwei Mal. Direkt danach reiste sie als oberste Diplomatin ihres Landes um den Globus wie kein Amtsvorgänger vor ihr. Sie ist mit allen innen- wie außenpolitischen Wassern gewaschen. Besonders bei den Fernsehdebatten mit ihren Konkurrenten zeigte Clinton, dass das nicht ihr „erstes Rodeo“ war, wie die Amerikaner es so schön formulieren. Attacken parierte sie souverän, sie ließ sich kaum aus der Ruhe bringen und führte mit Leidenschaft ihre Argumente auf. Insbesondere bei außenpolitischen Belangen konnte ihr kaum einer das Wasser reichen. Die Expertise aus vielen Wahlkämpfen, erst an der Seite ihres Mannes, später auf eigenen Füßen, kam ihr unheimlich zugute. Die wird sie auch im direkten Duell mit dem Kandidaten der Republikaner, Donald Trump, brauchen. Der hat gezeigt, welch unangenehmer Gegner er sein kann. Das Rennen ums Weiße Haus dürfte ein schmutziges werden.
Zumal es einiges gibt, das gegen Hillary Clinton spricht. Da ist zunächst schlicht der historische Kontext. Es ist traditionell äußerst schwer für eine Partei, nach einer voll ausgeschöpften Amtszeit von zweimal vier Jahren das Weiße Haus ein drittes Mal in Folge zu erobern. Das politische Pendel im amerikanischen Zwei-Parteien-System schwingt eben um Ausgleich bemüht.
Hinzu kommt, dass 2016 kein gutes Jahr für politische Insider ist. Das wird besonders deutlich beim Blick auf die republikanischen Bewerber, die sich geradezu verbogen haben, um nicht mit dem „bösen, korrupten, selbstgefälligen“ Washingtoner Politbetrieb unter einen Hut gekehrt zu werden. Der Frust bei Wählern über nicht gehaltene Politiker-Versprechen und über einen polarisierten Kongress, der scheinbar das Land lieber an die Wand fahren lässt, als sich auf Kompromisse zu einigen, ist so gewaltig wie lange nicht mehr und führt dazu, dass Anti-Establishment-Kandidaten erstaunlich hoch in der Wählergunst liegen. Dass sich bei den Republikanern mit Donald Trump ein Kandidat durchgesetzt hat, der nie zuvor ein politisches Amt bekleidet hat, ist hierfür das sichtbarste Zeichen. Politische Erfahrung wirkt fast wie ein Makel, denn sie steht in den Augen vieler dafür, dass Politiker, wenn sie in Washington angekommen sind, letztlich doch unter dem Einfluss mächtiger Lobbygruppen und reicher Geldgeber einknicken und eher deren oder eigene Interessen vertreten als die der Wähler.
Clinton versucht, die Fehler von 2008 zu vermeiden
Diese Haltung findet sich übrigens auf beiden Seiten. Der Erfolg von Bernie Sanders vor allem bei den jüngeren demokratischen Wählern basiert auch darauf, dass er als unabhängiger von Interessensvertretern rüberkommt, weil er keine finanzstarken Einzelsponsoren hinter sich hat, keine Verbindung pflegt zu Wall-Street-Großbanken und keinen speziell auf ihn ausgerichteten Super-PAC hat (eine Wahlkampf-Organisation, die für einen Kandidaten unbegrenzt Wahlkampfspenden einsammeln und einsetzen kann; allerdings gibt es einige Super-PACs, die Sanders indirekt unterstützen, etwa von Gewerkschaften). Vielmehr speist sich Sanders´ Wahlkampfkasse von beeindruckend vielen Kleinspenden.
Zuletzt bleibt auch Hillary Clintons Alter ein Fragezeichen. Wie sehr spielt für die Wähler die Tatsache eine Rolle, dass sie am Wahlabend 69 Jahre alt wäre? Nur Ronald Reagan war bei Amtseinführung älter. Zwar ist Alter an sich kein Gegenargument, zudem wirkt Clinton deutlich jünger, als sie ist – bei Auftritten präsentiert sie sich energisch und klar. Aber die körperliche und psychische Belastung dieses Amtes ist enorm. Wer sich ein Bild davon machen will, muss nur Obama-Photos von 2008 und heute vergleichen. Nicht umsonst werfen demokratische Strategen Szenarien auf, nach denen Clinton vielleicht nach der ersten Amtszeit von sich aus Schluss machen könnte; die „gläserne Decke“ hätte sie ja so oder so durchbrochen und müsste niemandem mehr etwas mit einem zweiten Wahlsieg beweisen. Andererseits: Die besonders mit begeisterten Jugendlichen gefüllten Hallen bei Sanders-Veranstaltungen zeigen, dass Millenials ihrer Großeltern-Generation gegenüber politisch nicht grundsätzlich abgeneigt sind.
Was bei diesem zweiten Anlauf auffällt, ist das Bemühen der Clinton-Kampagne, die Fehler von 2008 zu vermeiden. Die Parallelen sind ja nicht zu übersehen. Auch damals stand Hillary Clinton monatelang im Vorfeld der ersten Vorwahlen als die „unumgängliche“ Kandidatin so gut wie fest – sie galt als haushohe Favoritin, deren Nominierung nur eine Formsache schien. Clinton war sich zu siegessicher und unterschätzte das Begeisterungspotential eines Junior-Senators aus Illinois. Über eine solche Hybris will sie diesmal partout nicht stolpern. Auch die vielen Querelen und Streitigkeiten innerhalb ihres damaligen Wahlkampfteams scheinen bisher weitgehend auszubleiben. Clintons Wahlkampfmanager John Podesta hat sorgfältig ausgewählt beim Aufstellen des aktuellen Teams, zwischenzeitliche Querschießer kompromisslos gefeuert und die Truppe gut organisiert und vor allem aber auf Linie gebracht, damit keine Interna ungeprüft nach außen dringen – schon gar nicht an die Presse.

Womit wir bei einem weiteren entscheidenden Punkt wären: Clintons Verhältnis zu Journalisten. Trotz aller Bemühungen um Neuanfänge wird dieses wohl nie ein herzliches werden. Gleich zu Beginn ihrer Kampagne verärgerte sie Reporter, weil sie bei ersten Wahlkampfveranstaltungen keine Fragen zuließ mit dem Argument, sich nur auf die Wähler konzentrieren zu wollen. Eine fragwürdige Strategie, die darin gipfelte, dass bei einer Straßenparade Mitarbeiter mit einem Seil um sie herum liefen und sie quasi „umzäunten“ – offiziell aus Sicherheitsgründen, doch es wirkte vielmehr, als wolle ihr Team sie vor Journalisten und deren Fragen abschirmen. Wie der PR-Abteilung ihres Teams die Botschaft dieses Bildes nicht klar sein konnte, ist mir ein Rätsel. Natürlich fragten Journalisten daraufhin noch genervter als zuvor – ganz abgesehen davon, dass es absurd aussah, wie eine sich volksnah gerierende Kandidatin winkend und lächelnd in einem Cordon der Abgrenzung marschierte.
Was für ein Geschenk für Clinton ist demnach der Hype um das breite republikanische Bewerberfeld und das Phänomen Donald Trump. Denn kaum etwas hat seit Beginn der Wahlkampfsaison die US-Medien mehr elektrisiert. Die Fernsehdebatten bescherten den TV-Sendern Rekordquoten, entsprechend sind Sendungen und Schlagzeilen voll von Trump und seinen absurden Äußerungen – eine sich selbst befeuernde Spirale. Je besser die Quote, desto mehr Raum bekommt Trump. Je mehr mediale Präsenz, desto höher steigen seine Umfragewerte. Das führt zu einem entscheidenden Nebeneffekt: Die von Trump angeführten Republikaner ziehen die mediale Aufmerksamkeit auf sich und lassen weniger Raum und Zeit für Journalisten, sich auf Clinton einzuschießen.
Dabei ist es nicht so, dass es keine offenen Fragen zu Hillary Clinton gäbe. Im Gegenteil. Welchen Einfluss – oder gar Gefallen – könnten etwa nationale und internationale Organisationen und Geschäftsleute durch großzügige Millionenspenden an die Bill, Hillary und Chelsea Clinton-Stiftung erhalten haben? Wie sehr wirkt sich Hillary Clintons Nähe zur Wall Street und ihre jahrzehntelang kultivierte Verbindung zu Mäzenen, Großspendern und Investoren bei einer Wahl aus, die zunehmend von der Wut einfacher Bürger auf den Einfluss von Großkapital und der „oberen 10 Prozent“ bestimmt ist?
Was ist mit den E-Mails?
Vor allem aber: Was ist mit dem Umstand, dass sie als US-Außenministerin einen privaten E-Mail-Server für ihren gesamten – also auch dienstlichen – E-Mail-Verkehr nutzte? Erst nach monatelanger, öffentlicher Auseinandersetzung räumte sie in einem Interview ein, dabei einen Fehler begangen zu haben, und entschuldigte sich. Zuvor hatte sie Informationen nur scheibchenweise rausgerückt. Das Krisenmanagement war katastrophal. Ihre Äußerungen wirkten herablassend, wenn sie dazu befragt wurde – eine Manier, mit der beide Clintons schon oft aufgefallen sind, wenn sie sich mit unbequemen Fragen zu ihrem Verhalten konfrontiert sahen. Seit sogar das FBI prüft, ob Clinton und ihre Mitarbeiter auch Geheimdokumente auf diese Weise verschickt und so die nationale Sicherheit gefährdet haben könnten, ist klar: Das Thema lässt sich nicht einfach wegdrücken.
Aus juristischer Sicht mag Clinton am Ende auf der sicheren Seite sein. Aber bei einer Wahl geht es nicht darum, ob etwas rechtens ist, sondern, ob es in den Augen der Wähler richtig ist. Da geht es weniger um Ratio als vielmehr um Emotionen. Und hier liegt Clintons größtes Problem – eins, das sie selbst und ihre Berater immer wieder zu unterschätzen scheinen: die öffentliche Wahrnehmung. Die Sache mit dem E-Mail-Server verstärkte und erinnerte die Amerikaner nämlich an all die Dinge, die sie an den Clintons nicht mögen. Etwa, dass sie den Eindruck vermitteln, als würden die Regeln für alle anderen, aber nicht für sie gelten. Als litten sie unter Verfolgungswahn. Als würden sie irgendwie immer etwas zu verbergen haben oder unter den Teppich kehren – ein Eindruck, der völlig unbegründet sein mag, unterschwellig jedoch in der Öffentlichkeit hängen bleibt. Baggage nennen die Amerikaner so etwas. Und dies wirkt sich wie Gift auf die wichtigste Währung im Wahlkampf aus: auf die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Wähler. Im Dezember 2015 ergab eine Umfrage der Quinnipiac University, dass 60 Prozent der Wähler Hillary Clinton weder für ehrlich noch für vertrauenswürdig halten. Unter den wichtigen Wechselwählern waren es sogar 68 Prozent.

In diese Kerbe dürfte ihr republikanischer Gegner Donald Trump mit Vorliebe einschlagen. Kaum etwas bringt Konservative mehr in Wallung als die Vorstellung, nach Präsident Obama wieder die Clintons im Weißen Haus zu sehen. Der Name Clinton hat enormes Mobilisierungspotential unter Republikanern. Und darauf wird es ankommen: wie sehr die beiden Lager ihre Basis an die Wahlurnen treiben können. Es gibt sogar wilde Verschwörungstheorien, dass die Republikaner noch Dinge mit Skandalpotential im Köcher haben, um sie kurz vor der Wahl platzen zu lassen. Allein die Tatsache, dass sich diese Gerüchte in der Öffentlichkeit halten und nicht völlig ausgeschlossen werden, sagt viel aus.
Allerdings haben sich die Republikaner oft genug die Zähne an Hillary Clinton ausgebissen. Selten wurde das deutlicher als im Oktober 2015, als ihre Feinde im Kongress sie erneut vor den Benghazi-Untersuchungsausschuss zerrten. In einem elfstündigen Marathonverhör versuchten die Republikaner, ihr eine Mitschuld am Tod von drei Amerikanern bei der Erstürmung des US-Konsulats im lybischen Benghazi in die Schuhe zu schieben. Vergebens. Im Gegenteil, die republikanischen Abgeordneten wirkten kleinlich, verbittert, verbohrt, während sich Clinton nicht erschüttern ließ, als tough rüber kam und souverän an Format gewann.
Um auf das Bild vom Anfang zurückzukommen: Die ehemalige Außenministerin muss gar nicht so viel richtig machen. Sie darf nur nicht viel falsch machen. Dann könnte es sein, dass die Umstände trotz aller erwähnten Widrigkeiten für sie sprechen. Der republikanische Vorwahlkampf mit seinen ausländerfeindlichen Auswüchsen und seiner Angst schürenden Rhetorik hat die konservativen Kandidaten so stark nach rechts gezogen, dass es schwer für Trump werden dürfte, bei der Wahl im November glaubhaft genug für die Wechselwähler wieder in die Mitte rudern zu können. Zumal die Republikaner im Grunde genommen eine geteilte Partei geworden sind, in der ein radikaler Tea-Party-Flügel und gemäßigtere Konservative sich fast mehr gegenseitig bekämpfen als die demokratische Opposition.
Clinton kann auf viele Stimmen von Minderheiten setzen
Gleichzeitig gilt Hillary Clinton zwar als Falkin, die aber von der Popularität von Bernie Sanders und seinem Wettern gegen die Macht der Banken und der Wall Street sowie von seinen Programmen für sozial schwache Bürger nach links gezogen wird und dort viele Wählerschichten ansprechen kann. Entsprechend tritt sie als Kämpferin für die Belange der ausgebeuteten Mittelschicht auf, jener Millionen von Amerikanern also, die hart arbeiten und dennoch kaum auf einen grünen Zweig kommen. Das ist ihr vor acht Jahren schon ganz gut gelungen. Allerdings war es da zu spät, um das Ruder noch herumzureißen. Dieses Mal setzt sie von Anfang an darauf.
Hinzu kommt, dass Clinton auf viele Stimmen von Minderheiten setzen kann – auf die der afro-amerikanischen Wähler traditionell fast schon monopolartig, aber auch auf die der Hispanics. Dafür hat beinahe im Alleingang Donald Trump gesorgt, als er eine Mauer an der US-mexikanischen Grenze forderte, ebenso wie die Ausweisung von elf Millionen Menschen (meist Latinos), die sich illegal in den USA aufhalten. Gerade die rasant wachsende Wählerschicht der Hispanics wird genau hinschauen, welche Kandidaten wo stehen beim Thema Immigration.
Hillary Clinton besetzt eine ganze Reihe von Themen ganz im Sinne eines progressiven Zeitgeistes in den USA (vor allem bei Demokraten, aber auch generell bei jüngeren Wählern, die sich weniger dogmatisch an Parteilinien orientieren und mehr pragmatisch an Themen): Obamas Klimaschutzmaßnahmen unterstützt sie genauso wie seine Initiativen gegen Waffengewalt und gegen zu leichten Zugang zu Schusswaffen. Sogar beim Thema gleichgeschlechtliche Ehe hat sie eine Kehrtwende hingelegt (wie die Mehrheit der Amerikaner auch). Als Kandidatin 2008 war sie noch dagegen, im März 2013 verkündete sie ihre Unterstützung dafür.
Und Bill?
Noch ein Punkt, der natürlich immer im Raum steht: Was ist mit Bill? Hillary mag als die diszipliniertere, vielleicht auch klügere Hälfte des Clinton-Power-Gespanns gelten, die Sympathien liegen aber eher beim 42. Präsidenten der USA. Zwar beschreiben enge Freunde auch sie privat als lustig, bei Auftritten wie in der Comedy-Sendung Saturday Night Live blitzte ihr trockener Humor auch durch. Das gewinnendere Wesen in der Öffentlichkeit jedoch hat er. Kann sein Charisma erfolgreich im Wahlkampf eingesetzt werden? Vor acht Jahren erwies Bill seiner Frau einen Bärendienst, als er sich mit Reportern anlegte oder Positionen nicht ganz im Interesse der Wahlkampfstrategie vertrat. Letztlich ist das Pfund, das er mitbringt, aber zu wuchtig, um darauf zu verzichten. Solange er sie nicht überschattet, kann er ein echter Pluspunkt sein. Gemeinsam waren die Clintons stets am stärksten.
Bleibt die Frage, wie Bill bezeichnet würde, sollte das Paar tatsächlich nach Washington zurückkehren. First Husband? First Gentleman? Traditionell werden Alt-Präsidenten in den USA nach wie vor mit Mr. President angesprochen. Das könnte zu kuriosen Verwirrungen im Weißen Haus führen. Es wäre zumindest gewöhnungsbedürftig. Aber das wäre eine Mrs. President für die Amerikaner ohnehin.
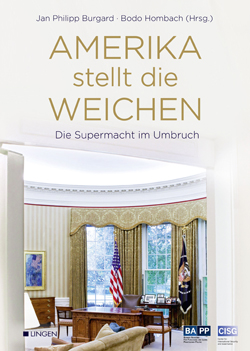 Dieser Text basiert auf einem Beitrag des Autors in Amerika stellt die Weichen. Die Supermacht im Umbruch (Hg. v. Jan Philipp Burgard und Bodo Hombach. Lingen, Köln 2016) und wurde für die vorliegende Veröffentlichung leicht gekürzt und aktualisiert. Wir danken dem Verlag für die Bereitstellung des Textes.
Dieser Text basiert auf einem Beitrag des Autors in Amerika stellt die Weichen. Die Supermacht im Umbruch (Hg. v. Jan Philipp Burgard und Bodo Hombach. Lingen, Köln 2016) und wurde für die vorliegende Veröffentlichung leicht gekürzt und aktualisiert. Wir danken dem Verlag für die Bereitstellung des Textes.
Das Buch
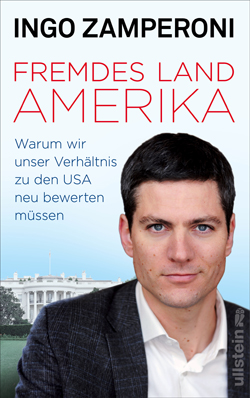 Ingo Zamperoni war stets fasziniert von den USA. Er ist es heute noch – nun aber mit einem nüchternen Blick auf die Realitäten des Landes. Sein dortiges Studium und seine journalistische Tätigkeit haben ihm gezeigt: Vieles an Amerika kann man bewundern, etwa den ausgeprägten Altruismus oder die Innovationsbereitschaft. Gleichzeitig gibt es Dinge, die wir anders sehen – vom Waffengesetz bis hin zur Geheimdiensttätigkeit. Doch trotz aller Missklänge und Differenzen haben die deutsch-amerikanischen Beziehungen nach wie vor zentrale Bedeutung für die Zukunft unseres Landes. Denn die großen Herausforderungen durch Terror, Kriege, Flucht und Finanzkrisen können Deutschland und Amerika nur gemeinsam meistern – egal, ob mit Hillary Clinton oder einem anderen US-Präsidenten. Je besser wir einander verstehen, desto leichter können wir eine Freundschaft wiederbeleben, auf die beide Länder nicht verzichten können.
Ingo Zamperoni war stets fasziniert von den USA. Er ist es heute noch – nun aber mit einem nüchternen Blick auf die Realitäten des Landes. Sein dortiges Studium und seine journalistische Tätigkeit haben ihm gezeigt: Vieles an Amerika kann man bewundern, etwa den ausgeprägten Altruismus oder die Innovationsbereitschaft. Gleichzeitig gibt es Dinge, die wir anders sehen – vom Waffengesetz bis hin zur Geheimdiensttätigkeit. Doch trotz aller Missklänge und Differenzen haben die deutsch-amerikanischen Beziehungen nach wie vor zentrale Bedeutung für die Zukunft unseres Landes. Denn die großen Herausforderungen durch Terror, Kriege, Flucht und Finanzkrisen können Deutschland und Amerika nur gemeinsam meistern – egal, ob mit Hillary Clinton oder einem anderen US-Präsidenten. Je besser wir einander verstehen, desto leichter können wir eine Freundschaft wiederbeleben, auf die beide Länder nicht verzichten können.


Wer politisch „denkt“, hat mit dem Denken – sofern es das menschliche Zusammenleben im weitesten Sinne betrifft – noch gar nicht angefangen, denn nicht die „hohe Politik“, sondern die Arbeitsteilung erhob den Menschen über den Tierzustand und allein die Qualität der makroökonomischen Grundordnung bestimmt den Grad der Zivilisiertheit, die der Kulturmensch erreichen kann. Die Makroökonomie ist die Basis allen menschlichen Zusammenlebens und das Geld ist die grundlegendste zwischenmenschliche Beziehung.
http://opium-des-volkes.blogspot.de/2015/09/die-idiotie-vom-unverzichtbaren-zins.html