Bei der Fußball-EM in Frankreich zählt „Die Mannschaft” als amtierender Weltmeister zu den Topfavoriten. Dabei sah es 2000 und 2004 eher so aus, als würde die Fußballnation Deutschland bald in der Bedeutungslosigkeit versinken. Dass sich das Blatt gewendet hat, ist auch tiefgreifenden Veränderungen in der Talentförderung zu verdanken – und der rot-grünen Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die ganz nebenbei den Talentpool für die DFB-Elf erweiterte.
von Raphael Honigstein

Fußballgeschichten werden permanent neu geschrieben und umgeschrieben, weitererzählt, ergänzt und verfälscht. Alltägliche Episoden erscheinen später plötzlich als Schlüsselmomente. Aus Schlüsselmomenten werden Meilensteine. Das Ende einer Ära, der Anfang einer Ära. Die Dunkelheit vor dem Licht, das Licht vor der Dunkelheit.
Entsprechend verhält es sich auch mit der EM 2000, Deutschlands Katastrophenturnier – noch heute erinnern sich viele, mit welch lächerlicher Leichtigkeit Portugals Reserveteam Oliver Kahn in Rotterdam mit drei Toren demütigte. Aus der schlimmsten Erniedrigung der deutschen Nationalelf wurde über die Jahre das Beste, was dem deutschen Fußball passieren konnte: ein Schock, der die lange überfälligen Veränderungen ermöglichte. „Das bittere Aus in der Vorrunde bei der EM 2000 war der Schlüsselmoment: Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stand der deutsche Fußball am Abgrund – es fehlte ihm jegliche professionelle Basis. Was folgte, war eine Revolution der Jugendarbeit”, stand 2011 sogar in einer offiziellen Broschüre der Deutschen Fußball-Liga.
Es gibt einige Gründe, warum den schwarzen Nächten der EM 2000 heute eine solch reinigende Wirkung zugesprochen wird. Zum einen ist ein schmerzhaftes Versagen deutlich leichter zu ertragen, wenn man sich selbst überzeugen kann, dass es letztlich einem guten Zweck diente. Zum anderen, und das ist entscheidender, haben in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit vor dem Jahr 2000 keine relevanten Reformen im deutschen Fußball stattgefunden.
Dietrich Weise erinnert sich vage, dass bereits 1999 erstmals ein deutscher Kongress für Jugend-Trainer stattfand, auf dem er auch sein Programm vorstellte. Aber niemand berichtete darüber. „Es gab kein Interesse an dem Thema”, so Ulf Schott. „Alle redeten davon, wie wichtig doch die Talentförderung sei. Denn mit so einer positiven Sache wollte doch jeder in Verbindung gebracht werden. Aber wenn es darum ging, unsere neuen Ideen umzusetzen, wurde es schwer.” Immerhin leuchtete den Bundesligaklub sein, das der Aufbau von Nachwuchsakademien zwingend notwendig war. Sie stimmten Weises und Schotts Programm zu – Monate vor der EM 2000.
Der DFB schrieb den 18 Erstligisten verpflichtend vor, ab der Saison 2001/02 sogenannte Nachwuchsleistungszentren zu führen. „Es war zu ihrem eigenen Vorteil, aber bis zu einem gewissen Grad mussten wir sie dazu zwingen”, erinnert sich Andreas Rettig. Es ging, wie so oft, vor allem ums Geld. „Was
wird es denn kosten? Ist das wirklich notwendig? Das waren die typischen Reaktionen”, so Schott. Aber es gab auch ideologischen Widerstand gegen eine neue Eliteförderung. „Diesem Prinzip der Auslese will der SV Werder Bremen nicht folgen”, erklärte Werders Manager Willi Lemke, ein überzeugter Sozialdemokrat, im Jahr 1998. „Wir haben auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag! Wir sind dazu verpflichtet, den Kindern eine Freizeitbeschäftigung anzubieten, ihre Leistungsbereitschaft zu fördern, ihnen solidarisches Verhalten und Teamgeist beizubringen.”
Im Jahr 2000 allerdings hatte die Mehrheit der Klubs verstanden, dass Veränderungen unabdingbar waren, sagt Volker Kersting, der seit 1990 bei einem der innovativsten Nachwuchsförderer, dem FSV Mainz 05, als Chef der Jugendabteilung arbeitet. „Jeder konnte sehen, wie wir international zurückfielen. Der DFB rannte mit seinen Vorschlägen offene Türen ein.”

Nach dem desaströsen Auftritt der deutschen Nationalelf bei der EM 2000 blieben denen, die einfach so weitermachen wollten, keine Argumente mehr. „Der Aufschrei nach der EM war riesig”, sagt Schott. „Alle Welt verlangte nach Reformen, erst recht nachdem Deutschland das Recht zugesprochen wurde, die WM 2006 auszurichten. Was die wenigsten wussten, war, dass viele der Reformen in der Praxis schon umgesetzt wurden. Aber die Medien und die Öffentlichkeit hatten sich bis zur EM 2000 für die Arbeit an der Basis ja nicht interessiert.” Tatsächlich wurde die entscheidende Wende nicht im Jahr 2000, sondern bereits 1998 vollzogen.
Im Oktober 2000 wurden die Änderungen auf einer Sitzung der 36 deutschen Erst- und Zweitligaklubs offiziell abgesegnet – jener Tagung, auf der die Bundesligaklubs auch eine eigene, vom Deutschen Fußball-Bund weitgehend unabhängige Firma gründeten, die Deutsche Fußball-Liga (DFL). Aus Angst vor der finanziellen Belastung wehrten sich die Zweitligisten zunächst gegen die Gründung der Nachwuchsleistungszentren. Es bedurfte einiger Überredungskunst, sie auf Linie zu bringen. Ab der Saison 2002/03 würden Profiklubs in Deutschland ihre Lizenz für die Bundesligen nur erhalten, wenn sie ein Nachwuchsleistungszentrum führten. In den folgenden zwei Jahren investierten die Bundesligaklubs über 150 Millionen Euro in den Aufbau der Nachwuchszentren.
Nun lag es am DFB, seinerseits die Strukturen der Nachwuchsförderung weiter zu verbessern. Das Training der Elf- und Zwölfjährigen an den Stützpunkten wurde aus der Obhut der Regionalverbände genommen und dem nationalen Verband unterstellt; die Lehrpläne wurden dementsprechend zentralisiert, das Netzwerk auf 366 Stützpunkte ausgebaut. Jedes Jahr durchliefen mehr als 600.000 Kinder das Stützpunkttraining der 1300 DFB-Trainer. Das Jahresbudget wurde auf 25,2 Millionen Euro erhöht. „Eine Million mehr oder weniger – auf einmal war das kein Problem mehr”, sagt Weise. Plötzlich schien es nichts Wichtigeres zu geben als die Talentförderung. „Jugendarbeit muss der zentrale Punkt unseres Wirkens sein”, erklärte Gerhard Mayer-Vorfelder, der Egidius Braun 2001 als DFB-Präsident abgelöst hatte. „Alles Erdenkliche muss getan werden, damit wir wieder eine Nationalmannschaft haben, die 2006 mit den Großen der Welt mithalten kann.”
Gelegentlich äußerte sich Mayer-Vorfelder unbeholfen oder auch verstörend nationalistisch, wenn er über den Mangel an einheimischen Talenten in der Bundesliga sprach. Insbesondere irritierte seine Bemerkung über die „nur zwei Germanen”, die in einer Bundesligapartie zwischen Energie Cottbus und Bayern München mitgewirkt hatten. So hatte man im Deutschland der Dreißiger- und Vierzigerjahre gesprochen. Andererseits wurden unter Präsident Mayer-Vorfelder die Möglichkeiten des neuen Staatsbürgerschaftsrechts voll ausgeschöpft, das die Regierung von Bundeskanzler Gerhard Schröder im Jahr 2000 reformiert hatte.
Nach dem neuen Einbürgerungsrecht musste niemand mehr eine deutsche Abstammung nachweisen, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Diese Norm stammte noch aus dem Kaiserreich und hatte Hunderttausenden Immigranten, die zum Teil in der dritten Generation in Deutschland lebten, die Chance verwehrt, einen deutschen Pass zu erhalten. Schröders rot-grüne Koalition ermöglichte es Kindern von Ausländern, die mindestens acht Jahre in Deutschland lebten, die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Zudem wurde es einfacher, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu erhalten. Für die deutsche Fußball-Nationalelf bedeutete dies, dass sich mit einem Schlag ein ganz neuer Talentpool auftat. „Wir müssen das Maximale aus den Möglichkeiten machen, die uns die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglicht”, ließ Mayer-Vorfelder verlauten. Dazu wurde kein spezielles Programm ins Leben gerufen, sagt Schott, aber der DFB bemühte sich fortan in einzelnen Fällen mit besonderer Fürsorge um talentierte Immigrantenkinder.
Bis dahin hatte man viele feine Fußballer an den Türkischen Fußball-Verband verloren. Bei der WM 2002 waren gleich drei Deutschtürken, Yildiray Bastürk, Ilhan Mansiz und Ümit Davala, Schlüsselspieler in jener türkischen Nationalelf, die den dritten Platz belegte. Der Türkische Fußball-Verband hatte eigens in Dortmund ein Büro eingerichtet, um Talente unter den drei Millionen Bürgern türkischer Abstammung in Deutschland zu finden und zu rekrutieren. „Der DFB interessierte sich doch jahrelang überhaupt nicht für diese Jungs”, so Erdal Keser, der ehemalige Bundesligastürmer von Borussia Dortmund, der das Scouting des türkischen Verbandes in Europa leitet.

Unterdessen trieb der DFB seine Offensive in der Talentförderung weiter voran. Eine spezielle, hochwertige Ausbildung für Jugend- und Kindertrainer wurde 2003 eingeführt. Ein Jahr später fiel der Startschuss zur Jugend-Bundesliga, in der sich A-Jugend-Teams in drei regionalen Gruppen auf höchstem Niveau messen konnten. Die Bundesliga für B-Jugend-Teams folgte 2007. „Die Leute reden nicht viel darüber, aber ich glaube, die Einführung der Jugend-Bundesligen war ein entscheidender Schritt des Reformprozesses”, sagt Ralf
Rangnick, der, bevor er einer von Deutschlands herausragenden Profitrainern wurde, Jugendmannschaften beim VfB Stuttgart trainiert hatte: „Wochenende für Wochenende spielen die besten Jugendlichen nun gegen ihresgleichen. Das hebt zwangsläufig das Tempo und die Qualität ihres Spiels und macht es für die Vereine möglich, die besten Jugendtrainer besser zu vergleichen und einzuschätzen. Außerdem zwingt es die Vereine indirekt dazu, die Jugendtrainer sorgfältiger auszuwählen, weil die Leistung der Jugendteams nun viel mehr beachtet wird.”
***
Dietrich Weise ging 2001 mit 67 Jahren in den Ruhestand. „Ich wollte nicht, dass auf dem Gang geflüstert wurde: ‚Was macht der Alte noch hier?‘” Seine Mission war zu Ende. „Als ich den WM-Triumph des Löw-Teams im Sommer 2014 verfolgt habe, dachte ich mir hin und wieder: ‚Mensch! Mensch! Mensch! Daran hast du auch einen kleinen Anteil, da hast du auch mitgearbeitet.‘ Unser Fußball, den wir heute spielen, beruht auf diesen Ideen. Mindestens zehn Spieler, die heutzutage eine gute Rolle in der Nationalelf spielen, hätten wir sonst nie entdeckt. Toni Kroos zum Beispiel wurde so entdeckt, er stammt aus
einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern.”
Ulf Schott, Weises treuer Begleiter auf der Reise zu einem neuen deutschen Fußball, wurde 2012 DFB-Direktor für Jugend- und Talentförderung. „Wir haben den Grundstein gelegt, unsere Ideen waren der Anfang. Alles, was danach kam, hat den Prozess kontinuierlich optimiert”, sagt er. „Aber mir gefällt es nicht, wenn die Leute sagen, nach 1998 hätte es eine Revolution gegeben. Das Rad musste nicht neu erfunden werden. Das Rad existierte schon. Denn selbstverständlich gab es schon eine Jugendarbeit in Deutschland, selbstverständlich hatten schon lange auch andere im Jugendfußball gute Ideen,
so wie es immer Menschen mit tollen Ideen geben wird. Das Entscheidende ist, dass diese Menschen in der Lage sind, ihre Ideen umsetzen zu können. Dafür brauchst du die Geschichte auf deiner Seite. Du musst die Gelegenheit bekommen, die Dinge zu entwickeln und fortzuführen. 1998, 2000 und 2006 waren solche historischen Momente.”
Der vorliegende Beitrag ist ein Auszug aus Der vierte Stern. Wie sich der deutsche Fußball neu erfand.
Das Buch
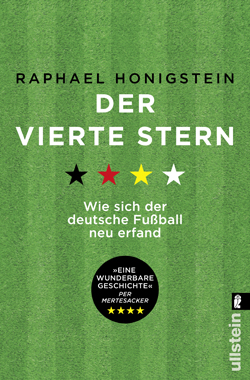 Raphael Honigstein, SZ-Korrespondent in London, Fußball-Experte und Sportreporter-Koryphäe, hat eine brillante und spannend zu lesende Analyse über die Entwicklung der deutschen Fußball-Nationalelf geschrieben: vom Rumpelfußball der frühen 2000er über das Sommermärchen 2006 bis hin zum Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien 2014. Wie ist den Verantwortlichen die Transformation gelungen – von einer unattraktiven, aber effizienten Spielweise hin zu berauschendem Offensivfußball? Welche Änderungen im Talente-Scouting und der Jugendförderung hat der DFB vollzogen? Für sein Buch ist Honigstein viel gereist – von Kalifornien bis Stuttgart, von München ins Maracanã, von Dortmund nach Durban – und hat mit den wichtigsten Vertretern und Protagonisten des DFB sowie den Stars der Mannschaft gesprochen.
Raphael Honigstein, SZ-Korrespondent in London, Fußball-Experte und Sportreporter-Koryphäe, hat eine brillante und spannend zu lesende Analyse über die Entwicklung der deutschen Fußball-Nationalelf geschrieben: vom Rumpelfußball der frühen 2000er über das Sommermärchen 2006 bis hin zum Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien 2014. Wie ist den Verantwortlichen die Transformation gelungen – von einer unattraktiven, aber effizienten Spielweise hin zu berauschendem Offensivfußball? Welche Änderungen im Talente-Scouting und der Jugendförderung hat der DFB vollzogen? Für sein Buch ist Honigstein viel gereist – von Kalifornien bis Stuttgart, von München ins Maracanã, von Dortmund nach Durban – und hat mit den wichtigsten Vertretern und Protagonisten des DFB sowie den Stars der Mannschaft gesprochen.
Links
Der vierte Stern auf den Seiten der Ullstein Buchverlage
Raphael Honigstein bei Facebook und Twitter
Für Presseanfragen: Benjamin Vieth (benjamin.vieth@ullstein-buchverlage.de)

