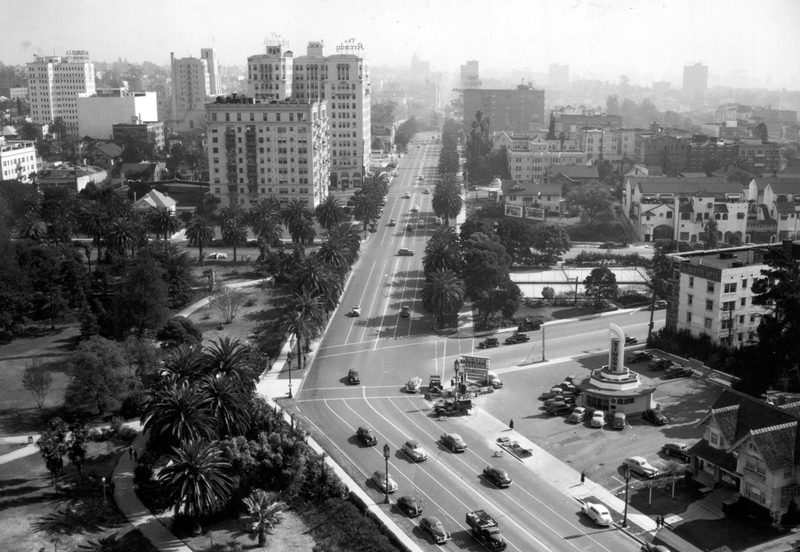Im zweiten Teil der Serie „Ellroys Amerika“ schreibt James Ellroy über seine Heimat Los Angeles und über die Hintergründe des L.A.-Quartetts und der darauf folgenden Unterwelt-USA-Trilogie.
Teil 1 der Serie gibt es hier.
von James Ellroy, aus dem Englischen von Stephen Tree
„Die meiste Fiktion wird durch Geografie bestimmt und ist von Autobiografie durchdrungen.“
Das hat Ross Macdonald geschrieben. Was Autoren ermutigt, an einem Ort zu bleiben, und zugleich eine verschlüsselte Warnung darstellt. Was sie lehrt, Autobiografisches nur sehr maßvoll einzubringen und andere eingehend darzustellen.
Geschichte ist die menschliche Wanderung durch die Zeit. Deren fiktive Abbildung eine intensiv realisierte Perspektive fordert. Ich lebe im Heute und halte mich im Damals auf. Einige meiner fiktiven Damals habe ich bewusst erlebt, andere fanden vor meiner Geburt statt. Ich schreibe Fiktionen aus den subjektiven Perspektiven der ersten und dritten Person Singular und nehme dabei eine Reihe von Standpunkten ein. Ich denke in der Sprache der Zeit und schreibe, als ob dies immer noch ihre Zeit wäre. Ich lasse mir Ross Macdonalds Rat gesagt sein und bleibe an einem Ort.
Meine Karriere ist durch vorgegebene Örtlichkeit und Todesdaten definiert. Erstere umfasst Los Angeles und Amerika im Allgemeinen. Letztere den genauen Zeitpunkt, an dem meine Mutter und Elizabeth Short starben. Beides zusammen hat mein verzweifeltes Bedürfnis zur Folge, mein gegenwärtiges Leben verlassen und im Dort und Damals leben zu wollen.
„Lebend bin ich ihr nie begegnet.“
Der erste Satz meines ersten Romans des L.A.-Quartetts. Der Erzähler ist ein ehemaliger Boxer-Bulle namens Bucky Bleichert. Die Frau, der Bleichert niemals begegnet ist, ist Elizabeth Short. Cherchez la femme. Ich begann meine Karriere als historischer Autor mit dem Nachsinnen über eine unerreichbare Frau.
„Die Schwarze Dahlie“ deckt die Zeit von 1946-49 ab. Dem folgt Blutschatten. Das Buch, das 1950 spielt, beschreibt eine fiktive Rotenangst in Hollywood. Blutschatten hatte schon fast den großen Weitblick. Ich beginne, den Schwung der Geschichte zu erfassen und die Art und Weise zu beherrschen, wie sie zu Papier zu bringen ist. Ein Augenblick der Offenbarung führte zu Blutschatten. Mir war ein Licht aufgegangen. Ein Telex hatte klappernd gemeldet: „Was immer du dir ausdenken kannst, kannst du auch ausführen.“ Eine Einsicht, die diesen Größenwahnsinnigen verblüffte.
Nach Blutschatten folgte L.A. Confidential: Stadt der Teufel. Das Buch deckte die Jahre 50 bis 58 ab und war noch umfassender angelegt. Ich trat in Ross Macdonalds Fußstapfen. Ort. Die Sprache des Geburtsrechts.
Ich komme aus L.A. und habe damals L.A. für die ganze Welt gehalten. Eine fremdenfeindliche, größenwahnsinnige Geisteshaltung. Meine L.A.-Romane verweisen auf langfristige Zugehörigkeit. Ich habe L.A. nie analysiert oder dekonstruiert oder Epigramme über seine Bedeutung geschmiedet. Ich komme von dort. Ich bin dort geboren. Ich wurde im Epizentrum des Film noir auf dem Höhepunkt der Film-noir-Ära gezeugt. Ich hatte Glück. Mama und Papa haben mich an einem coolen Ort gekriegt.
Das L.A.-Quartett endet mit White Jazz. Ein Roman, mit dem ich in aller Form Anspruch auf meinen Geburtsort erhebe und in dem ich dessen Sprache meine tiefempfundene Referenz erweise. Der Erzähler ist ein korrupter Bulle namens Dave „der Vollstrecker“ Klein. Das Leben von Lieutenant Klein bricht zusammen. Wir sind im Spätherbst 58, es geht auf 1959 zu. Alle Fäden der vorigen drei Romane laufen bei diesem bösen Mann zusammen. Klein schreibt in gebrochenen Sätzen, während er unausweichlich auf seinen psychischen Zusammenbruch zusteuert. Er ist ein rassistischer Slumlord, der Worte in der Art des schwarzen Be-Bop von sich schleudert. Kleins Ausweg besteht darin, sich als Opfer darzubieten, um so Erlösung zu erlangen. Das L.A.-Quartett endet, wie es beginnt. Ein einsamer Mann blickt aus dem Heute zurück. Er steht am Rande der Ewigkeit und denkt an eine Frau.
Cherchez la femme.
Dem kann ich nicht entkommen.
Und will auch gar nicht.
Ich habe gewusst, dass ich das L.A.-Damals im Rahmen meiner Möglichkeiten ausgeschöpft hatte. Ich hatte den Kriminalroman mit dem historischen Roman verbunden. Ich hatte eine Elegie auf meine Heimatstadt geschrieben und mich in deren Sprache gebadet. Ich wollte raus aus L.A. Ich wollte den Kriminalroman, den historischen Roman und den politischen Roman miteinander verbinden. Ich dachte mir die Unterwelt-USA-Trilogie aus.
Die Serie greift die Sechziger frontal an. Die Reise dauert von 58 bis 72. Sie erstreckt sich über das ganze Land, mit Exkursionen ins Ausland. L.A. kommt und geht. Nun dient es nur noch umherschweifenden Bösewichten als Heimathafen. Amerikanischer Thriller schildert Jack Kennedys Aufstieg und Fall. Wir sehen ihn durch die Augen seiner Mörder. Amerikanischer Albtraum reicht vom Dallas des Jahres 63 bis zu den Morden an Martin Luther King und Robert Kennedy. Der Erzählstil orientiert sich an Dave Kleins Be-Bop-Kadenzen in White Jazz. Die Trilogie war Ausdruck größenwahnsinniger Expansion und einer nachdrücklichen Behauptung meiner Identität. Das L.A.-Quartett besagte: „Ich komme aus Los Angeles.“ Die Unterwelt-USA-Trilogie erklärte: „Ich bin Amerikaner.“
Blut will fließen vervollständigt die Serie. Der Held ist ein junger Spanner, der als Privatdetektiv arbeitet. Er ist noch jungfräulich und hält Ausschau nach Frauen. Er bekommt mehr, als er haben wollte, und wird zur zusammenfassenden Stimme einer Epoche. Er ist ein Trottel und ein Mistkerl. Er hat sich bei der großen Party reingedrängt. Er hat die Sechziger leergemolken und wird 1972 an Land gespült. Er war immer die Fliege an der Wand. Von keinem ernst genommen. Aber er hat überlebt. Die Großkopfeten sind alle tot oder haben ihren Schwung verloren. Irgendeiner überlebt immer, um die Geschichte zu erzählen, und was es mit ihr auf sich hatte.
Das ist meine Aufgabe. Ich bin der Bursche, der die Wochenschauen abspult und deren Bilder auf Papier bannt. Ich bin ein Flüchtling aus dem Heute, der ins Damals zurückgreift. Ich bin der Größenwahnsinnige am Schreibtisch, der ständig Vollgas gibt.
Ich hatte meine geschichtliche Ader ausgeschöpft. Sieben große Romane. Kriminalfälle als Geschichte, Geschichte als Kriminalfall. Ein Loblied auf meine Heimatstadt. Unsere Nation in extremis. Sprache – stets fruchtbar, sich stets verändernd, sich stetig in mir weiter entwickelnd.
2008 wurde ich 60. Ich sah mir die Welt in diesem besonderen Augenblick an und empfand sie als unappetitlich. Ich habe nie einen Computer benutzt oder ein Handy besessen. Ich lebe im Heute und atme im Damals und schreibe lange Romane mit der Hand. Ich bin ein literarischer Pionier und ein privater Reaktionär. Die Welt des Heute ist das, vor dem ich mich verstecke. Die Welt des Damals der Ort, den ich umfange.
„Letztlich besitze ich bloß meinen Geburtsort, von dessen Sprache ich besessen bin.“
2006 bin ich nach L.A. zurückgekehrt. Da gehe ich immer hin, wenn Frauen sich von mir scheiden lassen. Ich habe meine letzten sieben Romane bedacht und meinen nächsten Zug überlegt. Ich saß an meinem Schreibtisch. Ich überlegte mir Straßenszenen und brütete. An einem kühlen Samstagabend erfolgte ein synaptischer Schub.
Die japanische Internierung, 1941-42. Die ungerechte, aber verständliche Reaktion auf Pearl Harbor.
Sich windende Bergstraßen in den Sierras. Schneebestäubte Pinienbäume. Ein US-Army-Bus, der Richtung Manzanar fährt. Japanischstämmige Amerikaner in Handschellen, denen die Geschichte übel mitspielt.
Das sah ich ganz klar. Ich dachte an Bob Takahashi.
Damals, im Oktober 62. Ich war ein vierzehnjähriger Frischling auf der Fairfax High School. Die kubanische Raketenkrise tobte. JFK und die Russkis spielten Katz und Maus und hatten die Welt zum Einsatz genommen.
Bob Takahashi war vor kurzem aus der Belmont High an die Fairfax gewechselt. Er trug flauschige „Sir-Guy“-Hemden, spitze Stiefel und weit ausgestellte Khakihosen. Belmont galt als Highschool der bösen Jugendlichen. Bob war angeblich ein Schläger für die Straßengang der „Motos“. Ein Name, der sich von den Detektivromanen um „Mr. Moto“ ableitete.
Der böse Bob und ich quasselten in der Freistunde. Wir beide fanden die Vorstellung eines Nuklearkrieges toll. Bob meinte, dass dies 10.000 Pearl Harbors gleichkäme. Wir schmissen mit Papierknalltüten und machten explosive Geräusche.
Bob hat mir von den Internierungen erzählt. Er war nach dem Krieg geboren und hatte es durch seine Verwandten mitbekommen. Die Bomben trafen Pearl Harbor am 7. Dezember. Am selben Tag schlägt die Bombenangst in L.A. ein. Das FBI hatte bereits eine Liste mit Angehörigen einer japanischen „Fünften Kolonne“ zusammengestellt. Mit diesem Begriff wurden mutmaßliche Faschisten und deren subversive Verwandte bezeichnet. Man hatte eine Riesen-Angst vor Industrie-Sabotage und vor See- und Luftangriffen. Der Munson-Bericht flog in den Papierkorb. Die örtlichen Razzien begannen.
FDR hatte einen Mann namens Curtis Munson zur Küste geschickt. Im Hinblick auf den drohenden Konflikt zwischen der USA und Japan. Munson verbrachte einige Zeit in den japanischen Enklaven und erstattete Bericht. Er verteidigte die kalifornischen Japaner vehement und beschrieb sie als ergreifend loyale Amerikaner. Das war im November.
7. Dezember – Pearl Harbor wird bombardiert.
Die richterliche Haftprüfung wird außer Kraft gesetzt. Besitz beschlagnahmt. Vermögen umstandslos eingezogen. Ganze Familien in die Stallungen der Pferderennbahn Santa Anita eingesperrt.
2008 hatte ich zum ersten Mal an die Internierung gedacht. Und war 1962 zum ersten Mal darauf hingewiesen worden. Ich rollte hin und her durch die Zeiten, bis ich es kapierte.
Der Größenwahnsinnige war auf eine Goldader gestoßen. Du darfst und musst wieder heim.
Ich würde das Zweite L.A.-Quartett schreiben und es im Los Angeles des Zweiten Weltkriegs spielen lassen. Mit echten und fiktiven Figuren aus dem L.A.-Quartett und der Unterwelt-USA-Trilogie, die in meiner Heimatstadt während der Kriegsjahre als deutlich jüngere Leute die Handlung bestimmen würden. Die vier Romane würden sich nahtlos an meine sieben bisherigen Romane anschließen. Die abgedeckte Zeitspanne würde insgesamt 31 Jahre umfassen. Kleinere Figuren aus den ersten beiden Werkgruppen würden im Mittelpunkt stehen, die dortigen Hauptfiguren zu Co-Stars herabgestuft.
Im richtigen Leben habe ich L.A. verlassen, bin durch Amerika gezogen und wieder nach L.A. zurückgekehrt. Mein wirkliches Leben und mein fiktives Leben waren nun untrennbar miteinander verflochten. Ich begriff L.A. als Fait accompli. Als ein Urteil auf lebenslänglich. Ich war vor 25 Jahren fortgezogen. Für so etwas wie einen Arbeitsurlaub. Ich kehrte zurück, wurde 60 und hatte eine Vision. T.S. Eliot schrieb: „In meinem Anfang ist mein Ende“ und „In meinem Ende ist mein Anfang“. Das ersetzte Ross Macdonalds „Letztlich besitze ich bloß meinen Geburtsort, von dessen Sprache ich besessen bin“. Ein Geburtsrecht, das durch den Einfall eines Samstagabends erweitert worden war.
Übernächste Woche geht es im dritten und letzten Teil von Ellroys Amerika um das Zweite L.A.-Quartett, die Ereignisse von Pearl Harbor und deren Auswirkungen auf das Amerika der Vierziger Jahre.