Donald Trump feiert Geburtstag. 70 Jahre wird der designierte republikanische Präsidentschaftskandidat, von denen er bereits über 40 als ebenso prominente wie kontroverse Person verbracht hat. Wie sich die öffentliche Wahrnehmung von Donald Trump verändert hat und welche gesellschaftlichen Voraussetzungen das Phänomen Trump hervorgebracht haben, das beschreibt Michael D’Antonio in seiner gerade erschienenen Biografie.
von Michael D’Antonio

In vielerlei Hinsicht ist Donald Trump seit fast vierzig Jahren ein Gesprächsthema gewesen. Niemand in der Geschäftswelt ist schon seit so langer Zeit so bekannt – weder Bill Gates noch Steve Jobs noch Warren Buffett. Sein Name, der zuerst mit publicityträchtigen Immobilienprojekten im Manhattan der Siebzigerjahre in Verbindung gebracht wurde, entwickelte sich bald zu einem Synonym für Erfolg, der sich durch Wohlstand und Luxus definierte. Der Schriftzug TRUMP, den er auf Wolkenkratzer, Casinos und Linienflugzeuge malen ließ (meist in goldenen Großbuchstaben), wurde zu einer echten persönlichen Marke, die einen einzigen Mann mit einer scheinbar endlosen Zahl von Angeboten verknüpfte. Nach und nach wurde dieses Markenzeichen auch für Hotels, Möbel, Krawatten und Fleischprodukte verwendet – also für fast alles, was man als hochwertig, teuer und erstklassig verkaufen kann.
Die Art von Klasse, die Trump bieten wollte, definierte sich nicht über sozialen Status, sondern über Geld. In seinem Eifer, sich mit seinen Angeboten an Neureiche und Möchtegerne zu wenden, ließ er diejenigen links liegen, die Mitglieder des von ihm so genannten »lucky sperm club« (sinngemäß etwa: Club der durch Geburt Privilegierten) waren. Dabei ignorierte er den Umstand, dass er selbst in eine der reichsten Familien des Landes hineingeboren worden war. Trump stellte sich als der reiche Freund eines jeden Normalbürgers dar, der Mitglieder der High Society mied – wenn er sie nicht gerade brauchte, um teure Apartments zu verkaufen. Bei solchen Gelegenheiten ließ er die Rolle des Anti-Snobs fallen und bezog sich bereitwillig auf die Astors, Whitneys, Vanderbilts und andere Mitglieder des Geldadels eines vergangenen Zeitalters. Es verstand sich jedoch von selbst, dass er diese Namen aus kommerziellem Interesse im Munde führte und sein Herz eigentlich für die Mittelklasse schlug – also für die Menschen, die seine Fernsehsendungen sahen, seine Produkte kauften und ihn vielleicht sogar wählen würden, falls er sich jemals für die Präsidentschaftskandidatur entscheiden sollte.
Nach den besten verfügbaren Daten kennen heute 96 Prozent der US-Bevölkerung den Namen „Trump”, aber die meisten mögen ihn nicht. Henry Shafer von der Firma, die Prominente mit dem „Q Score” einstuft, bezeichnet Trump als einen „Quasi-Prominenten, den zu hassen die Leute lieben”. Im Jahr 2014 hatten 61 Prozent der in Trumps Heimatstadt New York befragten Umfrageteilnehmer eine negative Meinung von ihm. Für Comedians ist er eine unwiderstehliche Zielscheibe. Jon Stewart, der ehemalige Star der jahrelang ausgestrahlten satirischen Nachrichtensendung The Daily Show, machte ihn routinemäßig zum Ziel seiner Attacken – so nannte er ihn zum Beispiel einmal „Fuckface von Clownstick”. Bekanntlich hat der Fernsehmoderator und Comedian Bill Maher Trump fünf Millionen Dollar angeboten, falls er beweisen könne, dass er nicht „das Ergebnis einer sexuellen Begegnung zwischen seiner Mutter und einem Orang-Utan” sei.
[…]
Obwohl er wie eine einzigartige und völlig moderne Figur wirkt, entstammt Donald Trump tatsächlich der langen Tradition des Landes mit ihren reichen, aber rauen Leistungsmenschen, über die Alexis de Tocqueville 1831 schrieb: „Die Liebe zum Geld ist entweder das Hauptmotiv oder der Hintergedanke bei allem, was ein Amerikaner tut.” Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren die Reichen in den Vereinigten Staaten dermaßen wohlhabend geworden, dass ihre Macht und ihr Einfluss der europäischen Aristokratie gleichkamen.
[…]
Das erste Gilded Age schwand in diversen Rezessionen und Börsenpaniken und verging schließlich, als es ungefähr 65 Jahre alt war, nach dem Börsencrash von 1929. Aus den Ruinen der darauffolgenden Weltwirtschaftskrise erwuchs ein sichereres Finanzsystem, ein progressiveres Steuersystem und die US-Sozialversicherung. In den nachfolgenden Jahrzehnten wuchs die Mittelklasse mit beispielloser Geschwindigkeit. Eine neue Ära des Wohlstands brach 1946 an, also dem Jahr, in dem Donald Trump geboren wurde. (Was ihn zu einem Gründungsmitglied der Babyboomer-Generation macht.) Als der Zweite Weltkrieg beendet war, lagen die wirtschaftlichen Konkurrenten der Vereinigten Staaten in Ruinen, und über zehn Millionen US-Soldaten kehrten heim, um sich wieder in einem zivilen Leben einzurichten. Als die Exportmärkte nach immer mehr Waren verlangten und die inländische Nachfrage nach Konsumgütern explodierte, begann eine goldene Ära. Millionen von heimgekehrten Soldaten gründeten Familien, die Wohnungen brauchten, und Immobilienentwickler wie Trumps Vater Fred wurden reich, indem sie sie bauten. Durch clevere Geschäftspraktiken und schiere Entschlossenheit hatte Fred es bis 1975 – dem Jahr, in dem er siebzig wurde – zu einem Vermögen von schätzungsweise 100 Millionen Dollar gebracht.
Die goldenen Nachkriegsjahre, die es Männern wie Fred Trump ermöglicht hatten, ein finanzielles Wunder zu erleben, waren gekennzeichnet durch ein beispielloses Maß an Gleichheit, da die verschiedenen Einkommensgruppen – Ober-, Mittel- und Unterschicht – jeweils einen angemessenen Anteil der expandierenden Wirtschaft für sich beanspruchen konnten und die Einkommensunterschiede, die sie trennten, weitgehend konstant blieben. Dieser erfreuliche Zustand hielt bis zur Rezession der Jahre 1973–75 an. Dann ließen jahrelange wirtschaftliche Stagnation und Krisen eine konservative politische Bewegung erstarken, die entschlossen war, durch Steuersenkungen und Deregulierung das Entstehen neuer großer Vermögen zu fördern. Theoretisch sollte eine Flut des Wohlstands, die einigen wenigen zufloss, „alle Boote heben” und so die Mittelschicht retten.
Als Ronald Reagan 1980 zum Präsidenten gewählt wurde, bekamen zündelnde Konservative, was sie wollten. Washington begann die Steuersätze, die Reichen auferlegt wurden, zu senken und die Regulierungen für Industriebetriebe und Finanzinstitutionen zu lockern. Das alles wurde im Namen von Wachstum und Gerechtigkeit für die Reichen getan. Um den letzteren Punkt zu betonen, schenkte Präsident Reagans Budgetdirektor David Stockman jedem Kabinettsmitglied ein Exemplar seines neuen Lieblingsbuches Wealth and Poverty (Reichtum und Armut) von George Gilder, das die moralische Rechtfertigung für das Anhäufen großer Reichtümer verkündete. Gilder feierte die Unternehmer und verunglimpfte die Armen mit der Behauptung, „die heutigen Armen – die Weißen noch mehr als die Schwarzen – weigern sich, hart zu arbeiten”. Um Gilders Überzeugungen in praktische Politik umzusetzen, beschnitt die Reagan-Regierung soziale Programme, senkte Steuern und strebte danach, die Unternehmen von lästigen Regulierungen zu befreien. So begann das zweite Gilded Age der Vereinigten Staaten.
[…]
Trumps Boeing 757, die oft am La Guardia-Flughafen an einer Stelle geparkt wird, wo sie so auffällig ist wie ein Werbeplakat, verkündet seinen Status als reicher und erfolgreicher Mann. Kaum jemand würde heute bestreiten, dass Reichtum gleichbedeutend mit Erfolg ist. Im neuen Gilded Age haben im Jahr 2006 in einer von der Pew Organization durchgeführten Umfrage 81 Prozent der befragten Studenten, die ein College-Studium beginnen, angegeben, ihr wichtigstes Ziel im Leben sei es, reich zu werden; das ist ein ungefähr doppelt so hoher Anteil wie in den Sechzigerjahren. In derselben Umfrage antwortete über die Hälfte der Teilnehmer, eines ihrer wichtigsten Ziele sei es, berühmt zu werden. Weniger als ein Drittel gaben an, sie wollten „anderen Menschen helfen, die Hilfe brauchen”.
Begabung und Intelligenz werden im Streben nach Erfolg nach wie vor für notwendig gehalten, aber wie schon in der Vergangenheit wird höherer Bildung und Intellektualität weit weniger Wert beigemessen. Unternehmer und Erfinder, die ihr Studium abbrachen und unglaublich erfolgreich wurden, werden bewundert. (Microsoft-Gründer Bill Gates ist einer von ihnen.) Mit noch mehr Aufmerksamkeit werden Menschen überhäuft, die nicht nur Reichtum, sondern auch großen Ruhm erlangen. Niemand hat diese Ziele in so hohem Maße erreicht wie Donald Trump, der – fast buchstäblich – zum Gesicht des modernen Erfolgs wurde.
Dutzende von Männern und Frauen, deren Vermögen um ein Vielfaches größer ist als jenes von Trump, sind außerhalb der Welt der Milliardäre völlig unbekannt. Donald Bren, Dan Duncan und Leonard Blavatnik waren im Jahr 2014 allesamt über 50 Ränge weiter oben auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt zu finden, aber sie können in jeder amerikanischen Stadt durch die Straßen gehen, ohne bemerkt oder behelligt zu werden. Trump kann nirgendwo hingehen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Bemerkenswerter ist jedoch, dass seine Berühmtheit bereits seit über vier Jahrzehnten anhält, über diverse Phasen von Erfolg, Versagen, Schande und Triumph hinweg. Indem er sich in ein Problem nach dem anderen stürzt und sich mit beispielloser Unverfrorenheit äußert, hat er sich zu einem der meistzitierten Männer seiner Zeit gemacht. In den frühen Jahren seiner Bekanntheit genoss Trump so breite öffentliche Zustimmung, dass die US-Gallup-Umfrage ergab, dass er in der Liste der meistbewunderten Männer der Achtzigerjahre an siebter Stelle landete – nur der Papst, der polnische Volksheld Lech Walesa und die vier noch lebenden US-Präsidenten liefen ihm den Rang ab.
[…]
Was soll man nur von einem erwachsenen Mann halten, der, wenn er sich mit einer Frau streitet, so tief sinkt, dass er über ihr Aussehen spottet, und der so stolz von seiner früheren Kampflust spricht? Und welchen Schluss soll man daraus ziehen, wenn derselbe Mann einer der prominentesten Menschen der Welt ist und privat so großzügig, dass er einmal einem todgeweihten Kind einen Scheck über 50 000 Dollar in die Hand gedrückt hat, damit es die letzten Monate seines Lebens genießen kann? Wenn man dieses Bild um seine Unverwüstlichkeit ergänzt, die es ihm ermöglicht hat, nach zahllosen Niederlagen immer wieder ein Comeback hinzulegen, und um seinen grenzenlosen Optimismus, erhält man eine so bezwingende Figur, dass man ihn nicht einfach wegen seiner prahlerischen Persönlichkeit abtun kann.
Tatsächlich ist Donald Trump trotz all seiner Exzesse ein perfekt an seine Zeit angepasster Mensch. Nachdem er in Tom Wolfes „Me Decade” (Ich-Jahrzehnt) der Siebzigerjahre herangewachsen war, hat er einen sehr effektiven Selbstdarsteller aus sich gemacht, in einer Stadt, in der es von solchen Leuten nur so wimmelt. In den Achtzigerjahren, als der fiktive Gordon Gekko seinen Leitspruch „Gier ist gut” verkündete, lud Trump die Presse – und durch sie die Öffentlichkeit –, ein, seinen luxuriösen Lebensstil zu beobachten und zu beneiden, den er seinem eigenen kompromisslosen Profitstreben zu verdanken hatte. Dann, nach ein paar Skandalen und sehr öffentlich ausgelebten geschäftlichen Schwierigkeiten, verbrachte er die Neunzigerjahre damit, die amerikanischste aller Leistungen ins Werk zu setzen – ein Comeback. In dieser Hinsicht hatte er eine Menge mit anderen bemerkenswerten Männern gemein, so zum Beispiel mit kompromittierten Evangelisten, dem verurteilten Anleihenhändler Michael Milken und dem aus seinem Amt enthobenen Präsidenten Bill Clinton. In den Neunzigerjahren bewiesen diese Männer, dass Bekanntheit einem Menschen helfen kann, fast jede Blamage hinter sich zu lassen.
[…]
In seinem Büro im 26. Stock, hoch über den Straßenschluchten von Manhattan, grummelt Trump, dies werde zweifellos ein „schlechtes Buch” werden, womit er meint, dass es wahrscheinlich seine Geschichte nicht als glänzendes Beispiel eines unternehmerischen Genies erzählen wird. „Die Leute wollen inspiriert werden”, sagt er, „sie wollen aufgebaut werden. Wenn man ihnen das gibt, dann bekommt man einen Bestseller.” Aber ein „gutes Buch” liegt im Auge des Lesers, und Donald Trump ist vielleicht am wenigsten qualifiziert, um sich selbst zu beurteilen. Dennoch mag sein Gespür für das, was die Öffentlichkeit haben will, in unserer Zeit unübertroffen sein. Seit Jahrzehnten hat niemand mehr so hartnäckig wie er die Aufmerksamkeit der Nation gefesselt. Trump beginnt jeden Tag damit, einen Pressebericht zu sichten, in dem genau aufgeführt ist, wo und wie oft sein Name in der weltweiten Presse erwähnt wurde. Diese Berichte sind meist so umfangreich, dass er sie nicht wirklich durchlesen kann, aber das Gewicht des Papierstapels gibt seinem empfindlichen Ego ein Gefühl dafür, wie wichtig er an jenem Tag ist. Dieses Bedürfnis, bemerkt zu werden, und sein Drang, es zu befriedigen, macht ihn zu einer einzigartigen Figur, die genau zu betrachten sich lohnt.
Das Buch
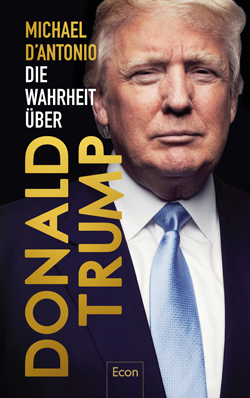 Es ist höchste Zeit, sich ernsthaft mit Donald Trump auseinanderzusetzen. Michael D’Antonios Biographie Die Wahrheit über Donald Trump zeigt ihn in seinem ganzen Größenwahn, Narzissmus und seiner unfassbaren Selbstverliebtheit. Gleichzeitig wird deutlich, wie erschreckend dünnhäutig und aggressiv Trump auf jede Kritik und Provokation reagiert und wie emotional instabil er ist. Es lässt sich nur erahnen, wie schwierig die außenpolitische Abstimmung mit ihm als möglichem Präsidenten werden könnte. D’Antonio erklärt aber auch, warum Trumps Beliebtheit bei den Wählern kein Zufall ist. Er ordnet dessen Aufstieg, Fall und Comeback in den Kontext größerer gesellschaftlicher Entwicklungen in den USA ein und liefert damit eine Analyse über die Biographie hinaus.
Es ist höchste Zeit, sich ernsthaft mit Donald Trump auseinanderzusetzen. Michael D’Antonios Biographie Die Wahrheit über Donald Trump zeigt ihn in seinem ganzen Größenwahn, Narzissmus und seiner unfassbaren Selbstverliebtheit. Gleichzeitig wird deutlich, wie erschreckend dünnhäutig und aggressiv Trump auf jede Kritik und Provokation reagiert und wie emotional instabil er ist. Es lässt sich nur erahnen, wie schwierig die außenpolitische Abstimmung mit ihm als möglichem Präsidenten werden könnte. D’Antonio erklärt aber auch, warum Trumps Beliebtheit bei den Wählern kein Zufall ist. Er ordnet dessen Aufstieg, Fall und Comeback in den Kontext größerer gesellschaftlicher Entwicklungen in den USA ein und liefert damit eine Analyse über die Biographie hinaus.
Links
Die Wahrheit über Donald Trump auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

