Wie kann es sein, dass der freie Markt nicht nur den allgemeinen Wohlstand mehrt, sondern auch so viele Dinge hervorbringt die uns nicht gut tun, manchmal sogar gefährlich sind? Dieser Frage sind die beiden Nobelpreisträger George Akerlof und Robert J. Shiller nachgegangen. Sie stellen fest: Täuschung und Manipulation gehören zum freien Markt dazu. Hier zeigt Robert Shiller am Beispiel des Volkswagen-Skandals, was Phishing ist und welche Mechanismen dem Markt zur Verfügung stehen, um Täuschung und Manipulation zu begegnen.
von Robert J. Shiller
 Foto: Richard Bartz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Foto: Richard Bartz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
George Akerlof und ich vertreten in unserem Buch Phishing for Fools: Manipulation und Täuschung in der freien Marktwirtschaft die These, dass die moderne Wirtschaft von Trickserei beherrscht wird, und dass Wettbewerb und Unternehmergeist die Verstärkung und breite Vermarktung dieser Trickserei sicherstellen. Wir benutzen den aus dem Internet bekannten Begriff Phishing als Metapher für all diese Formen der Trickserei und des Betrugs, die natürlich auch jenseits des Internets weitreichende Auswirkungen haben.
Entscheidend ist dabei, dass Manipulation und Täuschung immer allgegenwärtig sein werden, wenn die Zivilgesellschaft – der Teil der Gesellschaft, der nicht auf Profit aus ist, sondern eine bessere Welt gestalten will – nicht eingreift. Tatsächlich gibt es eine solche Zivilgesellschaft in gesunden Staaten und sie hat in ihnen eine wesentliche Rolle gespielt, seit der lateinische Begriff der societas civilis vor über 2000 Jahren geprägt wurde.
Es ist hilfreich, ein Fallbeispiel zu betrachten, um besser einschätzen zu können, wie unser Wirtschaftssystem des freien Marktes in der Praxis so gut funktionieren kann, obwohl es so angreifbar ist durch Manipulation und Täuschung:
2009 begann die Volkswagen AG, einen besonderen Chip in ihre Dieselfahrzeuge einzubauen, der als „illegale Abschalteinrichtung” bezeichnet wird. Diese Chips stellen fest, ob das Auto einem Emissionstest unterzogen wird. Wenn das Auto getestet wird, stellt die illegale Abschalteinrichtung sicher, dass es automatisch sauberer fährt. Als diese Tatsache 2015 ans Licht kam, wurde Volkswagen des Betruges angeklagt. Der damalige VW-Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn behauptete, keine Kenntnis dieser Chips zu haben. Es ist natürlich keine Überraschung, dass er nichts wusste. Seine Angestellten, die ihn nur mit ihren Erfolgen bei der Entwicklung eines erfolgreichen Automodells beeindrucken wollten, hatten keinerlei Anreiz, ihn darüber zu informieren.
In modernen Gesellschaften verlassen wir uns auf Mechanismen, um solche Taten zu enthüllen, auf Behörden, die gegen die entsprechenden Personen ermitteln und sie einer Bestrafung zuführen, und schließlich auf das Urteil der öffentlichen Meinung, die dafür sorgt, dass es bald keine Nachfrage mehr nach den Produkten solcher Firmen gibt. Wie also funktioniert dies in der Praxis und wie entdecken wir einen solchen Betrug?
Es gibt staatliche Untersuchungsstellen, die besondere Maßnahmen hätten ergreifen können, um solch einen Chip zu finden. Aber das taten sie nicht: Der Skandal wurde nicht durch die Regierung aufgedeckt. Laut der Berichterstattung fanden die entscheidenden Versuche an einer Universität statt, der West Virginia University. Aber warum testete diese Universität die Autos von Volkswagen? Nun ja, sie bekam ihrerseits Zuwendungen des International Council on Clean Transportation, einer Non-Profit-Organisation in den Vereinigten Staaten, um die staatlich durchgeführten Tests zu überprüfen und ihre eigenen Kontrollen durchzuführen.
Der ICCT wurde seinerseits von wieder anderen Stiftungen finanziert. Spender des ICCT waren die William and Flora Hewlett Stiftung und die David and Lucille Packard Stiftung. William Hewlett und David Packard, die Geschäftsleute hinter diesen Stiftungen, waren zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr am Leben. William Hewlett starb 2001, David Packard schon 1996. Aber ihre Ideen waren noch wirksam. 1939 hatten Hewlett und Packard, damals junge Männer frisch von der Uni in Stanford, das Informationstechnologie-Unternehmen Hewlett Packard gegründet und damit Karriere gemacht. Sie waren beide Ingenieure und hatten in all diesen Jahren der Erfahrung etwas gelernt. Sie und ihre Frauen gründeten vor ihrem Tod Stiftungen in Bereichen, in denen sie etwas beitragen konnten. Als Geschäftsführer von Unternehmen müssen Hewlett und Packard gewusst haben, dass Unternehmen Fehler machen, wenn man sie allein machen lässt, und sie wussten auch, wie man so etwas unterbinden kann.
In einem Phishing-Gleichgewicht wird jeder Betrug wie dieser nach den Regeln der Wirtschaft ausgenutzt werden. Zwar werden Manager, die normalerweise nicht weniger Schwierigkeiten mit moralischen Fragen haben als unsereiner, für gewöhnlich nicht zu begeisterten Betrügern werden. Üblicherweise ziehen sie ihr Selbstwertgefühl aus sozialverträglichen Handlungen. Aber in einem Wettbewerbsgleichgewicht werden die Wettbewerber auch phishen, die Gewinnspannen sind schmal und es mag Managern wie ein Ding der Unmöglichkeit erscheinen, nicht das zu tun, was alle anderen auch tun. Phishing kann dann zur Frage des Überlebens für ein Unternehmen werden.
Dieser Kampf ums Überleben in der Wirtschaft ist in weiten Teilen eine gute Sache, denn es spornt Manager an, ihren Kunden immer bessere Produkte zu liefern. Aber er kann auch sehr schiefgehen, wie das Beispiel Volkswagen zeigt. Zum Glück kann das Gute in der menschlichen Natur sich durchsetzen, zumindest, wenn die Bedingungen dafür stimmen, und es gibt Helden, die aufstehen und das Richtige tun. Hewlett und Packard gelang das noch nach ihrem Tod.
Ein Mensch, der in einer freien Gesellschaft lebt, wird in ruhigen und nachdenklichen Momenten darüber staunen, was der Sinn und Zweck all dieses Ringens ist. Er wird aus Prinzip versuchen, Ungerechtigkeiten zu beheben und den Kampf gegen das Phishing-Gleichgewicht aufnehmen. Und dies ist der Grund, aus dem der Kapitalismus funktioniert. Das Buch, das George Akerlof und ich geschrieben haben, ist das Zeugnis des immerwährenden Kampfes gegen die allgegenwärtige Ausbreitung des Phishing-Gleichgewichts, ein Ringen, das sehr real ist und das die erfolgreiche kapitalistische Wirtschaft kennzeichnet.
Das Buch
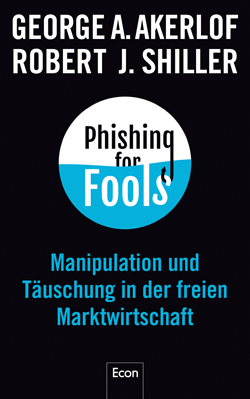 Seit Adam Smith ist eine der zentralen Thesen der Wirtschaftswissenschaften, dass freie Märkte und freier Wettbewerb die besten Voraussetzungen für allgemeinen Wohlstand sind. Die Wirtschaftsnobelpreisträger George A. Akerlof und Robert J. Shiller üben radikal neue Kritik an dieser Theorie der sich selbst regulierenden Märkte. Sie beweisen erstmals mit Fokus auf die Anbieterseite, dass auch Manipulation und Täuschung feste Bestandteile jedes Marktes sind. An zahlreichen anschaulichen Fallbeispielen machen sie klar, dass wir ständig verleitet werden für Dinge, die wir nicht wollen, zu viel zu bezahlen und mehr Geld auszugeben als wir haben.
Seit Adam Smith ist eine der zentralen Thesen der Wirtschaftswissenschaften, dass freie Märkte und freier Wettbewerb die besten Voraussetzungen für allgemeinen Wohlstand sind. Die Wirtschaftsnobelpreisträger George A. Akerlof und Robert J. Shiller üben radikal neue Kritik an dieser Theorie der sich selbst regulierenden Märkte. Sie beweisen erstmals mit Fokus auf die Anbieterseite, dass auch Manipulation und Täuschung feste Bestandteile jedes Marktes sind. An zahlreichen anschaulichen Fallbeispielen machen sie klar, dass wir ständig verleitet werden für Dinge, die wir nicht wollen, zu viel zu bezahlen und mehr Geld auszugeben als wir haben.
Solange Profite erzielt werden können, werden Verkäufer uns manipulieren, unsere psychologischen Schwächen ausnutzen und uns in unserem Unwissen täuschen. Anstatt von sich aus gutartig zu sein und immer die besten Produkte hervorzubringen, sind Märkte voller Tricks und Fallen. Finanzkrisen sind deswegen kein Zufall.
Phishing for Fools erzählt zugleich von Menschen, die sich gegen den Betrug in der Wirtschaft gewandt haben und wie wir ihm durch mehr Wissen, Reformen und Regulierungen begegnen können.
Links
Phishing for Fools auf den Seiten der Ullstein Buchverlage
Robert J. Shiller bei Twitter

