Aleppo – seit dem heutigen 13. Dezember wieder unter Kontrolle der syrischen Regierung und ihrer Verbündeten – ist zum Symbol für die Ausweglosigkeit des zerstörerischen Konflikts in Syrien geworden. Außenminister Frank-Walter Steinmeier beschreibt die Unwägbarkeiten und Widersprüche, mit denen sich die Außenpolitik in Syrien und im gesamten Nahen Osten schon vor Beginn des Krieges auseinandersetzen musste, und die heute erst Recht eine Lösung unmöglich erscheinen lassen. Ein Plädoyer wider die einfachen Antworten.
von Frank-Walter Steinmeier
Nur ein einziges Mal habe ich – buchstäblich schon in der Luft, unterwegs im Flugzeug – eine Reise abgebrochen.
Das war im August 2006. Die geplante Reiseroute hatte es in sich: Israel, Jordanien, Syrien, Saudi-Arabien. Im Westen wurde heiß diskutiert, wie mit dem noch relativ jungen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad umzugehen sei. Die damalige US-Außenpolitik unter George W. Bush sah die Welt nur nach einem Schema: Achse des Bösen, Achse des Guten – und die Amerikaner waren sich sicher, auf welche Seite Syrien gehörte. Ich hingegen warb dafür, zumindest Angebote zu formulieren, um Syrien in Verantwortung einzubinden, etwa für die Sicherheit im Nahen Osten, statt das Land unmittelbar an die Seite und damit unter den Einfluss des Iran zu stellen. Damit kein Missverständnis entsteht: Syrien war schon unter Baschars Vater Hafiz al-Assad ein autoritäres Regime, in dem Polizei und Geheimdienste, nicht Wahlen und demokratisch legitimierte Institutionen als Instrumente der Herrschaft dienten. Daran hätte sich wohl auch unter Baschar so schnell nichts geändert, da ist nichts zu beschönigen. Dennoch müssen wir uns auch im Westen rückblickend fragen, ob wir die Chancen für Veränderung nach Hafiz’ Tod genügend ausgeleuchtet haben. Baschar al-Assad war zum Zeitpunkt des Irakkrieges erst zwei Jahre im Amt. Das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater galt als distanziert. Nie war Baschar für Positionen im syrischen Regime vorgesehen, anders als seine Brüder hatte er keine militärische Ausbildung erhalten und gab seinen Beruf als Augenarzt in London nur widerwillig auf. In den frühen Zeiten seiner Rückkehr, nach dem Tod von Bruder Basil, galt er sogar als Reformer, war geprägt durch seine Ausbildung im Westen. Über seine Frau, eine in Großbritannien geborene und aufgewachsene Sunnitin, hieß es, die Umstellung vom Shopping in Londoner Boutiquen auf den Suq von Damaskus sei ihr äußerst schwergefallen.
Ich wollte mir jedenfalls selbst einen Eindruck machen und hatte Gespräche in Damaskus vereinbart. In Jerusalem, wieder einmal im Hotel King David, erreichte mich ein Anruf des damaligen französischen Präsidenten, Jacques Chirac. Eindringlich warnte er mich vor einer Reise nach Syrien. Ich setzte die Reise fort. Auf der nächsten Station, Jordanien, klingelte wieder mein Telefon, die amerikanische Außenministerin Condoleezza Rice rief durchs Telefon – ich werde die Tonlage nicht vergessen: „Frank, I urge you not to go!“ Ich setzte meine Termine fort. Schließlich, während der Audienz beim jordanischen König, dem letzten Termin vor Abflug nach Damaskus, erreichten uns Agenturmeldungen von einer Rede, die Assad in Damaskus gehalten hatte. Heftige verbale Angriffe auf Israel, so hörten wir, seien in der Rede enthalten gewesen.
Schon mussten wir zum Flughafen aufbrechen, während meine Leute eilig versuchten, ein klareres Bild der Aussagen zusammenzustellen. Um Irritationen zu vermeiden, gab ich Anweisung zum Abflug – aber ohne den Zielflughafen zu bestätigen. Im Flugzeug erhielt ich aus Damaskus, hastig ins Deutsche übersetzt, den Wortlaut von Assads Rede: Tiraden über den „Feind Israel“ waren darin enthalten, und lautstarke Unterstützung für Hisbollah. Mir war klar: Unter diesen Umständen war ein Gespräch mit Assad das falsche Zeichen. Nur wenn die syrische Regierung ihrerseits Bereitschaft zur Konfliktlösung signalisierte, wäre ein Gesprächsangebot sinnvoll.
Über Amman kreisend, erläuterte ich den mitreisenden Journalisten meine Entscheidung, unser Flieger drehte ab und nahm einen Tag früher als geplant Kurs in Richtung Dschidda in Saudi-Arabien. Unser Generalkonsulat vor Ort bereitete eilig den vorgezogenen Empfang vor, wenige Stunden später saß ich in einem improvisierten Fernsehstudio, in Wahrheit eher eine Besenkammer, und erklärte in mehreren Liveschaltungen mit deutschen Nachrichtenmagazinen, wie ein möglicher Schritt nach vorn – wieder einmal! – ein kleines Stückchen ferner gerückt war.
An solche Momente muss ich heute denken, zehn Jahre später, wo die internationale Gemeinschaft vor der syrischen Katastrophe steht. Im sechsten Jahr tobt der Bürgerkrieg, Hunderttausende Todesopfer hat er gefordert, Millionen, die Haus und Hof verloren haben; viele von ihnen haben in Deutschland Zuflucht gefunden. Solche Momente meine ich, wenn ich von dieser syrischen Katastrophe als einer „Chronik der verpassten Chancen“ spreche. Vermutlich haben wir Lösungen verpasst oder zumindest ausgelassen, lange bevor der Krieg begann. Jahre später, nachdem das Assad-Regime die Proteste des Jahres 2011 blutig niedergeschlagen hatte, boten die Vereinten Nationen den wohl erfahrensten und klügsten Vermittler auf, den die Welt zu bieten hat: Kofi Annan. Er verhandelte intensiv mit Regierung und Opposition, erarbeitete Vorschläge für einen politischen Prozess, für die wir in der heutigen Lage wahrscheinlich dankbar wären. Doch der Sicherheitsrat entzog seine Unterstützung, die Vetomächte schoben sich gegenseitig Schuld zu. Frustriert trat Annan als Syrien-Sondervermittler im Sommer 2012 zurück.
Auch später, zurück im Amt des Außenministers, habe ich internationale Syrien-Konferenzen erlebt, bei denen die versammelte Weltgemeinschaft am Reißbrett Szenarien für eine Zeit nach Assad entwarf. Doch Assad war noch da, und er ist es bis heute. Aber nach fünf Jahren Bürgerkrieg sind Lösungsszenarien, die einmal möglich waren, nicht mehr denkbar, nachdem dieser Diktator zum Massenmörder am eigenen Volk geworden ist. Der Syrien-Konflikt hat sich zu einem erbitterten Stellvertreterkonflikt ausgewachsen, mit Hunderten kämpfenden Gruppierungen verschiedenster Couleur, darunter nicht wenigen islamistischen Extremisten; ethnischen und religiösen Minderheiten, die zwischen den Fronten stehen oder ihre Chance gekommen sehen wie beispielsweise die Kurden; einer grenzüberschreitenden Terrororganisation, die mordend ein islamistisches Kalifat errichten will; Regionalmächten, allen voran Saudi-Arabien und Iran, die auf fremdem Boden um Vorherrschaft ringen; externen Akteuren mit eigenen Interessen und Historien, nicht zuletzt die USA, Russland und wir Europäer … Keine Vereinfachung, keine Schablone und keine Realitäts-Ausblendung werden helfen, um Schneisen eines möglichen Lösungsweges in dieses Dickicht zu schlagen.
 Pressekonferenz nach Abschluss der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, Wien, Juli 2015. Copyright Thomas Imo / photothek.net
Pressekonferenz nach Abschluss der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, Wien, Juli 2015. Copyright Thomas Imo / photothek.net
Durch die Einigung im Atomstreit mit dem Iran hat sich dafür im Sommer 2015 zumindest ein Türspalt geöffnet. Schon mit dem Tag der Vereinbarung begann eine neue Phase unserer Bemühungen. Denn uns war klar: Es braucht die Verantwortung dieser Verhandlungsparteien auch für einen Lösungsweg für Syrien. Das umfasst die sogenannten E3+3, also die USA, Russland und China sowie Frankreich, Großbritannien und Deutschland, aber vor allem auch die Staaten in der Region. Fortan haben wir uns bemüht, die beiden Kontrahenten Iran und Saudi-Arabien miteinander an den Tisch zu bekommen. Mehrfach pendelte ich zwischen Riad und Teheran. Es ist uns schließlich gelungen, sie alle, die regionalen und überregionalen Parteien, in ein Syrien-Format einzubinden, das in Wien, New York und München getagt hat. Doch der politische Prozess bleibt mühsam, und bei jedem Besuch in der Region spüre ich erneut, wie tief die Gräben sind.
In zwei Begegnungen im vergangenen Jahr traten diese Gräben ganz zugespitzt zutage, und in beiden ging es um Bücher. In Teheran fragte ich nach stundenlangen ergebnislosen Verhandlungen den Nationalen Sicherheitsberater, ob er denn glaube, dass der Konflikt mit den Saudis überhaupt jemals zu lösen sei. Er sah mich entgeistert an, so, als müsse er mir das kleine Einmaleins erklären, und empfahl mir schließlich ein Buch über Saudi-Arabien. „Lesen Sie das!“, sagte er, „dann verstehen Sie, was das für welche sind!“ Ich antwortete: „Oh, ich habe gehört, dass es in Saudi-Arabien ganze Bibliotheken mit Büchern gibt, die zeigen, wie die Iraner so sind. Nur bringt uns das weiter?“
Bald darauf traf ich in Riad den stellvertretenden saudischen Kronprinzen. Natürlich sprachen auch wir über die regionale Sicherheitslage und nach kurzer Zeit – wer hätte es gedacht – war es umgekehrt an ihm, mir ein Buch voller Enthüllungen über den Iran zu empfehlen. Die Situation war so frappierend parallel, dass ich mir ein Schmunzeln verkneifen musste. Ich entschied mich stattdessen, ihm von unseren Erfahrungen in Europa zu erzählen: welche tiefen Feindschaften uns einst getrennt und wie wir sie überwunden haben, Schritt um Schritt. Und ich sagte ihm: Wenn wir Konflikte lösen wollen, dann dürfen wir uns nicht an vermeintlich ewige Wahrheiten binden. Denn in jedem Konflikt existieren mehrere Wahrheiten, mindestens eine auf jeder Seite. Ich berichtete von Willy Brandts Ostpolitik und seinem Motto: „Du musst die Welt nehmen, wie sie ist, aber du darfst sie nicht so lassen.“ Wir unterhielten uns noch eine ganze Weile über die Geschichte unserer jeweiligen Regionen, und am Ende unseres Gespräches fragte mich der stellvertretende Kronprinz, ob ich ihm denn meinerseits ein Buch über Europa empfehlen möge. Natürlich bin ich dem gerne nachgekommen, und eine Woche später schickte ich dem saudischen Botschafter in Berlin den zweiten Band, in englischer Übersetzung, von Heinrich August Winklers Der lange Weg nach Westen.
Fast nie, und erst recht nicht im Mittleren Osten, helfen Schwarzweißmuster, Schablonen von Gut und Böse, um Konflikte zu verstehen, geschweige denn zu lösen. Doch wird leider kaum eine andere Region der Welt so sehr in Schwarzweiß betrachtet wie der arabische Raum. Grautöne und Schattierungen tauchen kaum auf in den Bildern, die Menschen sich von dieser Region machen, von Farbtönen ganz zu schweigen. Nicht ohne Grund war der Titel der Rede, die ich Anfang 2015 in der Region gehalten habe: „Wider die einfachen Antworten!“ Und nicht ohne Grund hatten wir Tunis als den Ort für die Rede ausgesucht. In Tunesien hatte der Arabische Frühling seinen Anfang, und das durch einen radikalen Akt. Am 17. Dezember 2010 setzte der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi in der Stadt Sidi Bouzid aus Protest gegen die Schikanen der Obrigkeit sich selbst in Brand.
Als ich am 23. Januar 2015 nach Tunis kam, stand die junge Demokratie an einem kritischen Punkt. Die demokratische und muslimische Verfassung, ein Novum in der Region, war ratifiziert, freie Wahlen waren abgehalten worden, nun steckte Tunis im schwierigen Prozess der Koalitionsbildung. Die Lage war angespannt. Zwei Wochen zuvor, am 7. Januar, hatten islamistische Terroristen die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris angegriffen und zwölf Menschen ermordet, darunter drei Tunesier. Die Attentäter waren französische Muslime, und in Europa keimte eine hitzige Debatte über den Islam und seine Verträglichkeit mit der Demokratie auf – eine Debatte, die in keinem Land so unmittelbar ausgetragen wurde wie in Tunesien. Sehr bewusst entschied ich mich in meiner Rede, den Stier bei den Hörnern zu packen und über den Islam und die Demokratie, über Religion und Gesellschaft zu sprechen.
 Im Bardo-Museum, Tunis, Januar 2015. Copyright: Thomas Trutschel/ photothek.net
Im Bardo-Museum, Tunis, Januar 2015. Copyright: Thomas Trutschel/ photothek.net
Einen Tag vor meiner Rede hatte unsere deutsche Delegation das Nationalmuseum von Bardo besucht. Es ist das größte archäologische Museum in Tunesien und eines der bedeutendsten Nordafrikas. Das Museum ist ein farbenfroher, reichverzierter Palast, kombiniert mit einem eleganten Neubau aus glattem Sandstein und viel Glas. Im Zentrum der Ausstellung, die wir besuchten, standen drei deutsche Künstler, Impressionisten, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Tunis gereist waren und sich vom Licht, den Farben und Gerüchen inspirieren ließen. In ihren Bildern wurden diese Eindrücke zu etwas Abstraktem, aber sehr Eindrücklichen. Die Gemälde und ihr Museumsort brannten sich uns ins Gedächtnis. Nur wenige Wochen später, zurück in Berlin, sahen wir beides in den Fernsehnachrichten wieder. Am 18. März 2015 drangen Terroristen ins Bardo ein und nahmen die Museumsbesucher als Geiseln. Einige der Geiseln verschickten Fotos über Twitter; man sah verängstigte Menschen auf dem Boden kauern. Sofort erkannte ich die Räume wieder, in denen wir gerade erst die Gemälde bestaunt hatten. 22 Geiseln wurden an diesem Tag getötet.
Wie sich herausstellte, war einer der Attentäter Student in Tunis gewesen, ein junger Mensch wie die, an die ich meine Rede gerichtet hatte. Es wäre nicht mal unmöglich, dass dieser junge Mann im Publikum gesessen hat. In meiner Rede sagte ich: „Wer, wenn nicht Sie, kann Vorurteile abbauen und entschieden dagegenhalten, wenn Feindbilder geschürt werden? Sie, Ihre Generation, kann dafür sorgen, dass Tunesien, das schon eine geographische Brücke zwischen Europa und der arabischen Welt ist, auch eine Brücke der Verständigung wird!“
Sehe ich das anders, nach dem Anschlag und weiteren Anschlägen, die noch folgten? Gibt es noch Hoffnung? In erbitterten und vertrackten Konflikten wie in jener Region ist Hoffnung die falsche Kategorie. Was für Menschen unerträglich ist, kann nicht so bleiben. Und weil es nicht so bleiben darf, müssen wir unsere Bemühungen gerade dann steigern, wenn das Ziel in größere Ferne zu rücken droht. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen ist für viele eben keine wohlfeile Formel, sondern Überlebensfrage. Niemand kann einen solchen Anspruch alleine schultern, auch wir können das nicht! Aber dass wir Deutschen mit unseren Möglichkeiten daran mitwirken, darauf setzen sehr viele, gerade in dieser konfliktbeladenen Region. Dieser Verantwortung dürfen wir uns nicht entziehen.
Dieser Text ist ein Auszug aus dem gerade bei Propyläen erschienenen Buch Flugschreiber. Notizen aus der Außenpolitik in Krisenzeiten von Frank-Walter Steinmeier.
Das Buch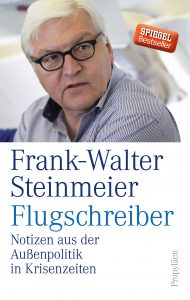
Wir leben in turbulenten Zeiten. Internationale Krisen häufen sich, und sie rücken näher an Europa heran. An die Deutschen richten sich wachsende Erwartungen, zur Lösung internationaler Konflikte beizutragen, und sie nehmen sie ernst. Frank-Walter Steinmeier, einer der erfahrensten Außenpolitiker unseres Landes, steht als Diplomat, Vermittler und Krisenmanager für diesen Wandel. In seinem Buch gibt er Einblick in den Alltag des deutschen Außenministers in Krisenzeiten.
Link
Flugschreiber. Notizen aus der Außenpolitik in Krisenzeiten auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

