Vogelschutz geht uns alle an, meint der Zugvogelforscher Peter Berthold, denn wir alle spüren den Verlust an Artenvielfalt. Wir alle können ihn aber auch verhindern – ob im heimischen Garten, auf dem Balkon oder an der begrünten Hauswand. Wie wir gleich damit beginnen können, erklärt Peter Berthold in seinem Essay.
von Peter Berthold

Wir haben in Deutschland seit 1800 rund 80 Prozent der einst bei uns vorkommenden Vogelindividuen verloren – genauer gesagt zerwirtschaftet, von unseren Insekten gar dieselbe Menge allein in den letzten 30 Jahren vernichtet, und aus ähnlichen Restbeständen setzt sich auch die übrige verbliebene Arten-„Vielfalt“ der freilebenden Tier- und Pflanzengruppen zusammen – mit weiterhin fallender Tendenz. Schlagworte wie Bienen- und Eschensterben, Birnenverfall und „Stummer Frühling“ in Bezug auf die Vogelwelt sind symptomatisch geworden für die Biodiversitätskrise in aller Welt, die längst auch in Deutschland Ausmaße einer Biodiversitätskrankheit angenommen hat, die auch für unsere nächsten Generationen Lebensbedrohung anzeigt.
Selbst aktiv werden, statt abzuwarten
Von Staat und Regierung Abhilfe zu erwarten, ist sinnlos – das tun wir seit über 150 Jahren, und Maßnahmen sind über das Feuerwehrprinzip – versuchen zu löschen, wenn’s irgendwo brennt – nie hinausgekommen. Inzwischen ist das Problem der Biodiversitätsverarmung so übermächtig geworden, dass sich keine Partei daranwagt, wohl wissend, dass sie mit drastischen Maßnahmen und Milliarden Aufwand ihre Existenz riskieren würde. Die ganze Hilflosigkeit unseres Umweltministeriums zum Beispiel zeigt sich in jüngsten Scheingefechten wie gereimten Zweizeilern über Missstände in der Tierhaltung („Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein“) oder geplanten Maßnahmen gegen Geruchsbelästigung durch Abfälle in der Landwirtschaft.
Uns bleiben derzeit zwei Möglichkeiten: Abzuwarten, bis der Biodiversitätsschwund aufgrund immer weniger stabiler Ökosysteme auch Lücken in unsere Bevölkerung reißt, dann werden endlich – aber vielleicht zu spät – drastische Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Oder in einer Vielzahl von Bürgerinitiativen die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen – das gilt ausnahmslos für jedermann.
Noch können wir den Wettlauf gegen den Artenschwund gewinnen
Da aufgrund des zunehmenden Leistungsdrucks auf unsere landwirtschaftlich genutzten Flächen eine generelle Reökologisierung der Nutzgebiete ausscheidet, bietet sich die Einrichtung neuer hochwertiger Lebensräume für freilebende Tiere und Pflanzen auf sogenanntem Öd- und Unland an. Derartige „Oasen aus Menschenhand“, am besten im Gebiet jeder politischen Gemeinde auf rund zehn Prozent ihrer Flächen geschaffen, würden einen bundesweiten Biotopverbund ergeben, der große Teile unserer Artenvielfalt stabilisieren und sogar wieder vermehren könnte. Der inzwischen seit über zehn Jahren durchgeführte Großversuch „Biotopverbund Bodensee“ zeigt ermutigende erstaunlich positive Ergebnisse und wird nun ab 2017 bundesweit umgesetzt. Dabei ist viel Bürgerengagement gefragt. Je rascher die Umsetzung erfolgt, desto größer ist die Chance, dass wir die derzeit noch recht hohe Regenerationsfähigkeit unserer Restbestände an Arten nutzen können. Noch bestehen Aussichten, dass wir damit den Wettlauf gegen den kontinuierlich fortschreitenden Artenschwund gewinnen könnten.
Die Schaffung größerer neuer Biotope ist zeitaufwendig und kostenträchtig und damit nicht jedermanns Sache. Leichter zu bewältigende Möglichkeiten bieten sich für Besitzer von Haus- und Schrebergärten oder auch von Balkonen – durch naturnahe Gestaltung. Die etwa 15 Millionen Gärten in Deutschland machen immerhin etwa 4 Prozent unserer Landesfläche aus – das entspricht ziemlich genau der Gesamtfläche aller unserer Naturschutzgebiete! Würde nur ein Zehntel dieser Gärten naturnah gestaltet, könnte darin eine nahezu unvorstellbar große Anzahl wildlebender Pflanzen und Tiere mit uns zusammen existieren – darunter beispielsweise bis zu 30 Millionen Singvogel-Paare, was rund der Hälfte der derzeit insgesamt in Deutschland noch vorkommenden Vogelindividuen entspricht. Da würde sich ein Umdenken im Gartenbau also wahrhaft lohnen!
Und das heißt natürlich nicht etwa, auf den Nutzgarten mit Gemüse, Obst usw. zu verzichten, sondern nur, ihn sinnvoll in ein Gesamtkonzept einzugliedern. Wichtigste Elemente dafür sind: Abschied vom kurz geschorenen, artenarmen „Psychopathen-Rasen“, dafür artenreiche Blühwiesen voller Wildblumen und im Gefolge Insekten sowie Sämereien für Vögel und andere Nutznießer. Alle bei uns vorkommenden Vegetationsschichten von (einheimischen) Bäumen über Sträucher und Stauden bis zu einjährigen Kräutern sollten nach Möglichkeit Platz finden. Riesige Grünflächen lassen sich vor allem auch durch eine Vielzahl von Kletterpflanzen an Hauswänden, auf Dächern, Garagen, Schuppen usw. erzielen, die für viele Tiere ideale Lebensräume mit günstigem Mikroklima bieten. Efeu zum Beispiel ist eine Pflanze mit einer ganzen Palette von günstigen Eigenschaften für die Artenvielfalt.
Nahrung und Nistplätze
Für viele Naturfreunde ist besonders Vogelreichtum im Garten Ausdruck einer einigermaßen intakten und erfreulichen Umwelt. Er lässt sich in unserer heutigen Zeit, in der Sämereien durch die weitgehende Ausrottung von Wildkräutern („Unkräutern“) sowie Insekten selten geworden sind, durch naturnahe Gartengestaltung allein nicht mehr erreichen. Um diesen Vogelreichtum zu erhalten, sollte zum Einen eine ganzjährig betriebene Vogelfutterstelle eingerichtet werden, die vor allem zur Brutzeit, also von März/April bis August besonders wichtig ist. Zum anderen ist das Bereitstellen möglichst vieler Nisthilfen wichtig, vor allem Nistkästen. Für eine optimale Versorgung unserer Gartenvögel mit Futter rund ums Jahr sind viele Details zu beachten, so zum Beispiel, dass Fettfutter – etwa Meisenknödel – im Sommerhalbjahr ganz besonders wichtig sind. Vögel brauchen zum Fliegen nämlich Fett, das sie direkt in ihren Brustmuskeln „verbrennen“, und während der Jungenaufzucht müssen sie sehr viel fliegen. Steht ihnen derartiges Futter an Fütterungen im Garten zur Verfügung, können sie die heute schwer zu beschaffenden Insekten weitgehend an ihre Jungen verfüttern, deren Chancen damit steigen, auch bei knappem Insektenangebot flügge zu werden. Und damit Vögel im naturnah gestalteten Garten auch brüten können, sollte man bei etwa 500 Quadratmetern Fläche 10 bis 20 Nistkästen anbieten, sodass möglichst viele Paare ein passendes Zuhause finden.
Wer weder Garten noch Balkon besitzt, kann dennoch viel zur Rettung von Artenvielfalt beitragen, wenn er nur möchte. Wie das möglich ist? Durch Tätigwerden im Stadtpark, beim Autofahren, durch gezielte Ernährung und Essgewohnheiten. Wer sein Umweltbewusstsein von den rein auf uns Menschen bezogenen Perspektiven auf ein Naturschutzbewusstsein erweitert, das auch all unsere Mitlebewesen mit einbezieht, wird immer Wege finden, die dazu beitragen können, Artenvielfalt zu bewahren.
Das können wir ab sofort tun:
Wir können uns einer der Bürgerinitiativen in unserem Umfeld anschließen, die sich aktiv für den Vogelschutz einsetzen
Wir können unseren eigenen Garten naturnah gestalten und ihn so zum geeigneten Lebensraum für Vögel machen
Wir brauchen keinen „Psychopathen-Rasen“, sondern Blühwiesen mit Wildpflanzen, Obstbäumen, Sträuchern, Stauden und Kräutern.
Je strukturierter ein Naturgarten durch das Nebeneinander verschiedener Vegeatationsschichten ist, desto mehr Arten von Tieren und Pflanzen können ihn besiedeln.
Am besten ist es, einheimische und standortgemäße Pflanzen anzusiedeln. Sie bringen zum einen eine angepasste Begleitfauna mit – vor allem Insekten, die sie bestäuben oder auf ihnen leben, Vögel, die ihre Beeren verzehren und ihre Samen verbreiten. Zum anderen sind sie meist relativ robust und pflegeleicht.
Auch wer keinen Garten hat, kann etwas tun: Balkone lassen sich mit einiger Phantasie mit üppig grünenden und blühenden Pflanzen in Kästen und Kübeln sommers wie winters als vogel- und allgemein tierfreundliche Oase gestalten. Gleiches gilt für einen Dachgarten, selbst auf dem Dach einer Garage oder Werkstatt.
Wir können zur besseren Versorgung beitragen, indem wir vor allem im Sommerhalbjahr Meisenknödel aufhängen.
Damit unsere Gartenvögel auch brüten können, sollten wir ihnen ein passendes Zuhause bieten. Bei einer Fläche von 500 Quadratmetern können das 10 bis 20 Nistkästen sein.
Mehr zu dem Thema auf dem resonanzboden
Zehn Botschaften gegen den Klimawandel
Selber machen? Über die Eigenständigkeit und das Gemeinwesen
Das Buch 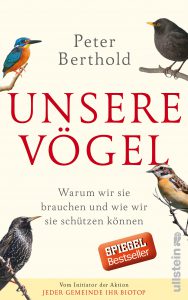
Vögel faszinieren uns auf vielfältige Weise. Und sie sind uns ans Herz gewachsen. Doch Vögel sind auch unsere wichtigsten Bioindikatoren. Ihr zunehmendes Verschwinden zeigt uns, dass es um ihren und unseren Lebensraum in diesem Land (und weltweit) nicht gut bestellt ist. Denn das Artensterben hat inzwischen alle Gruppen von Tieren und Pflanzen erfasst und macht auch vor dem Menschen nicht Halt. Es wird höchste Zeit, daran etwas zu ändern. Peter Berthold, Deutschlands renommiertester Ornithologe, schlägt Alarm: Er zeigt uns, wie gefährdet die faszinierende Vielfalt unserer Vogelwelt ist und was wir alle konkret dafür tun können, um sie zu erhalten.
Links
„Unsere Vögel“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

