Als Kind macht Jo McMillans Mutter im Frühjahr 1945 eine Erfahrung, die sie nachhaltig prägt – die ihre Wahrnehmung von Krieg und dessen Auswirkungen auf Zwischenmenschlichkeit verändert. Ein Text über Heimat, Vertrauen und die Wichtigkeit von spontanen Gesten.
von Jo McMillan

Meine Mutter wuchs in Angst vor den Deutschen auf. Aber der erste, dem sie tatsächlich begegnete, befand sich in einem Kriegsgefangenenlager in der Londoner Peripherie, das als The Dumps bekannt war. Es war im außergewöhnlich milden Februar des Jahres 1945, einem der wärmsten jemals verzeichneten. Und vielleicht war es genau das, was meine Mutter dorthin zog, in ihrem übergroßen Sommerkleid und ihren Schuhen, in die sie erst noch hineinwachsen musste. Das muss auch dieser deutsche Gefangene gefühlt haben. Er lehnte mit seinen kaputten Stiefeln und einer Uniform, die dem Mann passte, der er mal gewesen war, am Zaun. In seinem Rücken schien hell die Sonne, sein Schatten ruhte langgestreckt im Gras auf der anderen Seite des Maschendrahts.
Meine Mutter weiß nicht genau, warum sie zu ihm hinging. Vielleicht, weil sie der Wärme dieses Tages erlag oder weil sie allein und unbeobachtet waren, oder weil sie dachte, dass er nett und nicht etwa deutsch aussah. Als sie näher kam, griff er in seine Tasche und hielt ihr etwas hin. Was sollte meine Mutter tun? Sie wusste, dass sie keine Süßigkeiten von Fremden annehmen sollte und von Deutschen schon gar nicht. Sie vergifteten sie, wie alle sagten. Aber die Rationierung dauerte schon länger, als sie zurückdenken konnte, und der Gedanke an das Süße war stärker als der Gedanke an den Tod. Außerdem war an deutschem Karamell zu sterben in ihrer Vorstellung nur eine weitere von hunderten Möglichkeiten, wie ihr Leben enden konnte. Meine Mutter schaute ihn an, sah das Gelb seiner müden Augen und nahm das Bonbon. Sie packte es aus, aß es und starb nicht. Es war ein seltener Akt menschlicher Güte in sechs Jahren Krieg.

Isobel McMillan kurz nach dem Krieg
Wenn ich heute mit meiner Mutter spreche, dann als Frau mittleren Alters zu einer alten Frau. Wir haben jetzt beide eine lange Vergangenheit – mehr Vergangenheit als Zukunft. Wir haben genug Abstand, um zurückzublicken und zu erkennen, die Muster zu entdecken, zu verstehen, was uns geformt hat. Meine Mutter sagt immer, sie sei „ein Kind dieses Krieges“. Im Laufe ihres Lebens hat es viele gegeben, aber der, den sie meint, begann im Jahr 1939, als sie zwei Jahre alt war, und er prägte alles, was noch kommen sollte.
Als die deutschen Luftangriffe auf London begannen, wurde ihre Familie auseinandergerissen – die Kinder ausquartiert, Umsiedler auf der Suche nach Zuflucht vor den Bomben. Die beiden älteren Geschwister meiner Mutter wurden nach Yorkshire geschickt. Sie selbst und ihre Schwester Margaret erhielten Gasmasken und eine Nummer und wurden nach Paddington gebracht, wo man sie in einen Zug voll winkender und weinender Kinder steckte. Sie hatten Marmeladenbrote, aber ihnen war so schlecht, dass sie keinen Bissen anrührten, während London und ihr Zuhause in der Ferne zusammenschrumpften. Der Zug fuhr die Südküste entlang.
Sie sahen zum ersten Mal das Meer. Es sollte blau sein, war aber in Wirklichkeit schwarz. Hier endete England, und hier endete die Welt, die sie gekannt hatten.
Der Zug hielt in einer kleinen Stadt in Devon. Bomben gab es hier keine, stattdessen eine Reihe wachsamer und angespannter Frauen, die die Arme über ihren Kittelschürzen verschränkten und aussahen, als würden sie bei der erstbesten Gelegenheit in die Luft gehen. Sie beäugten die Kinder und schätzten ab, wieviel Ärger sie wohl machen würden. Dann zeigten sie auf das eine, das sie haben wollten. Und das war’s.
Meine Mutter und Margaret wurden in entgegengesetzte Richtungen geschickt. Aber die Mädchen weinten so sehr, dass die ach so fromme Mrs Tranter daraufhin beschloss, zwei Seelen bei sich aufzunehmen, auch wenn sie sie nicht ganz satt bekommen konnte. Nach zwei Wochen des Bettnässens riss sie sie allerdings eines Nachts aus ihren Gebeten und schickte sie fort. Mrs Nicholson nahm sie stattdessen. Sie sammelte Umsiedler, nahm ihr Hab und Gut an sich und stopfte die Kinder zu sechst in ein Bett. Wenn es dunkel wurde, bebte die Wand von den Geräuschen der Männer, denen sie es besorgte.
Später mussten sie dann noch einmal umziehen, zu einem Mann, dem es gefiel, meine Mutter zu baden, der sie auszog, sie in eine Wanne packte, die zu nah am Feuer stand, und ihr auftrug, nicht zu schreien.
Die meisten Tage verbrachten meine Mutter und ihre Schwester an der Strandmauer, wo sie durch die Stacheldrahtwände auf die Wellen schauten und darauf warteten, dass die Deutschen kamen. Während sie so warteten, veranstalteten sie manchmal Schneckenwettrennen. So langsam vergeht die Zeit, wenn man ein Kind ist und der Krieg nicht vorübergehen will.
Das ist der Krieg, sagt meine Mutter: Angst und Warten. Auf Schlimmes und Schlimmstes. Beides wird geschehen. Du weißt nur nicht, welches wem.
Da waren sie also: meine dreijährige Mutter, die trotz aller Verlorenheit und Verwirrung erwachsen zu sein versuchte, und Margaret, die versuchte, gleichzeitig Schwester, Mutter und Freundin zu sein, obwohl sie in Wirklichkeit ein sieben Jahre altes Mädchen war, das einfach nur nach Hause wollte.

Isobel und Margaret McMillan, 1940
Als ich das letzte Mal in London war, fand ich meine Mutter in gedrückter Stimmung vor. Margaret war gerade gestorben. Sie war die letzte Verbliebene von ihren Geschwistern, und nun war die Familie also noch einmal auseinandergerissen worden, diesmal für immer. Meine Mutter erzählte von der Vergangenheit, vom Krieg und davon, wie er sie geformt und gezeichnet hatte – die Wahrnehmung von sich selbst, von Sicherheit, davon, wem man vertrauen konnte und wie man überlebt, wie er das Verhältnis zu ihrer Schwester und zu mir geprägt hatte, wie wichtig menschliche Güte ist.
„Ein Akt, ein einziger Akt, kann soviel bewirken”, sagte sie. „Und du wirst ihn nie vergessen.“
Dann erzählte sie mir die Geschichte von dem Kriegsgefangenen und den Dumps, die ich schon so viele Male gehört habe. Während Churchill, Roosevelt und Stalin in Jalta tagten und Millionen von Flüchtlingen die fragmentierte Landkarte Europas durchquerten, gab am Rande von London ein deutscher Mann einem englischen Mädchen ein Bonbon.
Abgesehen davon, dass es nicht einfach ein Bonbon war.
Das Bonbon war nur ein Vorwand.
Vielleicht dachte er, dass dieses Mädchen, dessen Namen er nicht kannte und dessen Sprache er nicht sprach, älter aussah als sie tatsächlich war. Oder dass sie ihn an jemand erinnerte, vielleicht an seine Tochter. Oder dass dieser Krieg sie prägen und dass sie diese Begegnung ihr Leben lang nicht vergessen würde. Und dass sie sich, wenn die Sprache auf die Angst und das Warten und die Verstorbenen kam, auch daran erinnern und davon sprechen würde.
Meine Mutter und ich plauderten miteinander, während im Fernsehen das Nachmittagsprogramm lief – größtenteils Gameshows mit niedrigen Einsätzen, bei denen es nicht viel zu verlieren gab. Und wie der Nachmittag verging, machte das Unterhaltungsprogramm den Nachrichten Platz. Die Schlagzeilen waren der Flüchtlingskrise gewidmet. Kamerafahrten durch das zertrümmerte Syrien. Dann verzweifelte Eltern, die winkende und weinende Kinder in ein Boot setzten und sie mit dem Versprechen auf ein baldiges Wiedersehen der schwarzen See anvertrauten.
Ich blickte zu meiner Mutter herüber. Sie konnte ihre Augen nicht vom Bildschirm lösen. Ihr Gesicht wirkte wie eingefroren, wenn nicht sogar krank. Ich nahm die Fernbedienung und wollte gerade zu einem fiktiven TV-Drama mit zahlreichen Werbeunterbrechungen umschalten – ein eleganter Mord in einem englischen Dorf, der rechtzeitig zum Tee aufgeklärt sein würde.
Aber sie hielt mich davon ab.
„Es neigt sich, schau … nach rechts … geht unter …” Sie meinte damit das Boot, hätte aber genauso gut von Europa sprechen können.
Im Fernsehen warteten Reihen von Flüchtlingen hinter Stacheldraht. Der Bericht schaltete nach Deutschland, wo erschöpfte Menschen eine Nummer und ein Bett in einem Schlafsaal erhielten. Wir sahen, wie sie um gebrauchtes Schuhwerk baten, während sie in Flip-Flops im Berliner Winter ausharrten.
Dann trat David Cameron auf, um gegen Schengen und Dublin und Quoten zu wettern – um „für Großbritannien zu kämpfen“, wie er es ausdrückte. Meine Mutter hievte sich aus ihrem Sessel und schlurfte in Pantoffeln davon. „Ich kann den Mann nicht ertragen. Die haben Namen und Gesichter, diese Quoten, und Familien und Berufe.” Dann, über ihre Schulter hinweg an den Fernseher gerichtet: „Und jetzt nichts mehr“.
Als sie zurückkam, hielt sie ein Paar Wanderstiefel in den Händen. „Die passen doch noch in dein Gepäck, nicht wahr?”
Das war keine Frage.
Meine Mutter reichte sie mir – Stiefel, mit dicken Sohlen und zusätzlicher Verstärkung, die einen durch alles hindurchbringen. „Ich hoffe, sie fühlen sich darin sicher.“ Sie hielt inne. „Ich hoffe nur, sie fühlen sich sicher. Alle. Es ist doch sicher, nicht wahr? In Deutschland?“
Als der Moment des Aufbruchs gekommen war, drückte mich meine Mutter, umklammerte mich, hielt mich fest. Das hat sie schon immer so gemacht. Sie ist mit der Angst vor Abschieden aufgewachsen: Die Welt war so ungewiss, und es konnte einfach alles passieren.
„Ich werde dich wiedersehen?“
„Es ist nur Berlin.“
„Bald. Lass es bald sein.“
Dann verabschiedete sie mich. „Und gib gut Acht, Jo“. Und sie meinte damit nicht nur die Rückreise, sie meinte auf unsere Menschlichkeit, auf unser Mitgefühl, auf das europäische Gemeinschaftsgefühl.
Das Buch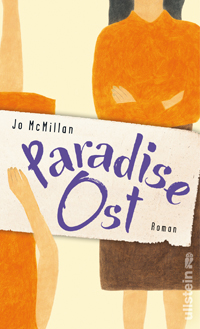
Als Jess mit ihrer Mutter Ende der 70er Jahre nach Ost-Berlin kommt, ist die Engländerin überrascht davon, wie anders die Welt jenseits des Eisernen Vorhangs aussieht. Für ihre Mutter geht ein Lebenstraum in Erfüllung: Endlich ist für die glühende Kommunistin der Sozialismus tatsächlich real existierend, ist die Lehrerin geachtet und nicht mehr belächelte Minderheit. Jess hingegen erfährt bald, was es heißt, im Land der Gleichen anders zu sein. Aus anfangs kuriosen Unterschieden werden kaum auszuhaltende Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit, und bald steht Jess vor einer schweren Entscheidung – zwischen ihrer Mutter und ihrer Freiheit.
Links
Paradise Ost auf den Seiten der Ullstein Buchverlage
Jo McMillans offizielle Website

