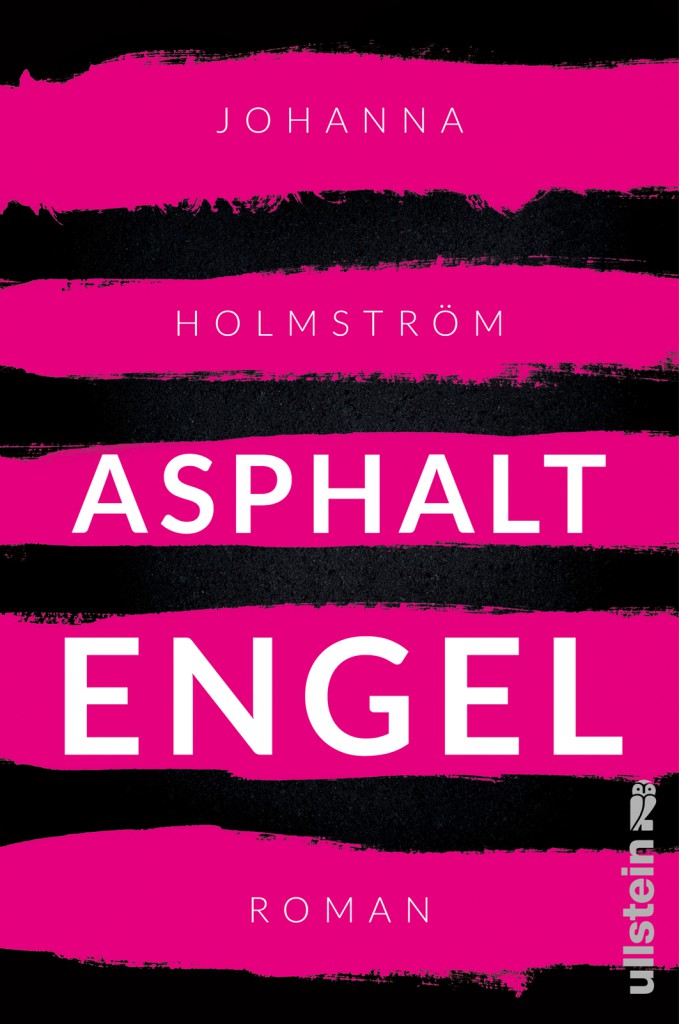Die Autorinnen Johanna Holmström und Antje Rávic Strubel im Gespräch über Migration, Religion, Feminismus, Politik und mehr. Allesamt Themen, die in Holmströms aktuellem Roman „Asphaltengel“ thematisiert und anhand verschiedener Figuren illustriert werden ohne jedoch dabei in die gängigen Klischeefallen zu tappen.
Antje Rávic Strubel: „Asphaltengel“ hat mich begeistert. Was für eine erhellende und aufregende Lektüre! Zum einen erzählst du eine ungewöhnliche und spannende Coming-of-Age Geschichte mit lebensnahen Figuren, die mich in ein Helsinki entführten, wie ich es noch nicht kannte.
Zum anderen hinterfragst du die Rolle der Frau in unserer westlichen Gesellschaft und zwar, indem du sie über die Rolle der islamischen Frau spiegelst. Es geht also im weitesten Sinne auch um die Konstruktion des Anderen. Es geht darum, wie wir uns in unseren europäischen Gesellschaften über „die Anderen“, also Flüchtlinge oder Migranten definieren. Du veranschaulichst diese Mechanismen an den Geschichten dreier muslimischer finnischer Mädchen in Helsinki, die sich alle unterschiedlich in diesem Finnland verorten. Die Schule ist wie ein Übungsgelände für das spätere Leben. Hier werden Prinzipien des Ein-und Ausschlusses trainiert. Warum etwa ist jemand erst der Star der Klasse und wird plötzlich zum Außenseiter?
Und schließlich schätze ich deinen Roman sehr, weil er – und das mag etwas groß klingen, aber ich halte es für zutreffend –, ein wichtiger Beitrag ist zu einer der größten moralischen Herausforderungen unserer Zeit: der Gender-Gleichberechtigung. Und zwar weltweit.
Du hast in einem Interview gesagt, die Idee zu dem Buch sei dir nach einer Internetdiskussion gekommen. Statt deinen Zorn im Internet zu verpulvern, hast du lieber einen Roman geschrieben. Was hatte es damit auf sich?
Johanna Holmström: Die Online-Diskussion gestaltete sich sehr konfrontativ. Da ging es nur um Schwarz oder Weiß, richtig oder falsch. Entweder bist du für uns oder gegen uns. Und egal, welche Worte ich benutzte, das Ganze richtete sich auf merkwürdige Weise gegen mich.
ARS: Worum genau ging es?
JH: Damals standen in Finnland Wahlen an, und die Perussuomalaiset, also die rechtspopulistische Partei der „Wahren Finnen“, waren gerade auf dem Vormarsch. Sie haben eine stark rassistische Agenda. Es ging um Einwanderung und die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung, um den Islam und all das.
Ich habe mich online mit ein oder zwei Sätzen an der Debatte beteiligt, mußte aber feststellen, dass man sofort attackiert oder zurückgewiesen wird, wenn man die Meinung der anderen nicht teilt. Unabhängig von dem, was man sagt. Das schien mir also nicht der richtige Weg, irgendetwas zu ändern oder irgendwen zu erreichen. So kam mir der Gedanke, dass es gut wäre, darüber zu schreiben. Ich habe daraufhin recherchiert und festgestellt, dass zum Thema Einwanderung in Finnland so gut wie keine Romane existierten. Und da dachte ich: Wenn sonst niemand darüber schreibt, muß ich das tun. Während der sechs Jahre, die ich an dem Buch gearbeitet habe, habe ich ständig darauf gewartet, dass mir jemand zuvorkommt und etwas Vergleichbares macht. Aber da tat sich nichts.
ARS: Wie bist du vorgegangen? Hattest du zuerst die Figuren im Sinn? Oder war da erstmal dein Anliegen, aus dem sich schließlich eine Geschichte mit ihren Figuren entwickelte?
JH: Da ich lange mit einem arabischen Mann, einem Algerier, verheiratet gewesen bin, wollte ich über eine gemischte Familie schreiben. Diese Situation kannte ich aus eigener Erfahrung. Auch sollte es um finnische Muslime und Frauen gehen. Von den Figuren, glaube ich, war Sarah zuerst da. Dann kam ihre Tochter Leila, die Schwester Samira usw. Vor allem brauchte ich eine glaubwürdige Konstellation. Ich hätte nicht über eine Familie schreiben können, die aus einem fremden Land nach Finnland kommt oder die hier keine Wurzeln hat. Dafür wäre ich nicht die richtige Autorin gewesen. Es sollte also um Finnen, genauer um verschiedene Arten von Finnen gehen.
ARS: Dadurch machst du den Zugang für finnische LeserInnen leichter. Aber nicht nur. Die Mutter ist Finnin, die zum Islam konvertiert ist, und als Konvertitin nimmt sie eine besonders strenge, fast radikale religiöse Haltung ein. An der Figur der Mutter verdeutlichst du, dass die Religion und die Unterdrückung der Frau zwei verschiedene Dinge sind. Oft wird ja der Islam selbst als rückständig und repressiv angesehen. Die Mutter benutzt nun aber die Religion, um sich aus der stereotypen Frauenrolle zu befreien, in der ihr tunesischer Ehemann sie gern sehen würde, der weitaus weniger religiös ist als sie. Nicht die Religion ist also schuld, sondern der männliche Blick. Ist die Religion für die Mutter ein Werkzeug zur Emanzipation?
JH: Ja, das war durchaus meine Absicht. Wie du bereits angedeutet hast, greift sie in der Kommunikation mit ihrem Mann zu einer Sprache, die ihr Mann spricht und die er verstehen sollte, um sich aus der bedrückenden Situation ihrer Ehe zu befreien. Sie bemächtigt sich der Religion, indem sie sie auf eine Weise interpretiert, die sie für feministisch hält. Sie versucht, dem männlichen Blick zu entgehen. Einem Blick, von dem sie weiß, dass er ohnehin immer da ist, weil wir nicht in einer wirklich gleichberechtigten Gesellschaft leben. Eine Frau ist immer ein Körper. Sie versucht also, die Kontrolle über ihren eigenen Körper zurückzugewinnen und selbst zu entscheiden, was die Männer von ihr sehen dürfen und was nicht. Das ist ihre Interpretation von Feminismus.
ARS: Das Kopftuchtragen als eine Form der Selbstermächtigung.
JH: Ich glaube, dass es für die Finnen eine echte Herausforderung war, so etwas zu lesen. In der Online-Diskussion, von der ich erzählt habe, ging es genau darum. Mir wurde gesagt, dass ich über die finnischen Verhältnisse und die Stellung der Frau in der finnischen Gesellschaft froh sein sollte. Andernfalls könne ich ja nach Saudi-Arabien gehen, wo Frauen verkauft werden. Das hat tatsächlich ein Mann zu mir gesagt. Ich fand das sehr chauvinistisch. Man wird also vor die Wahl gestellt, sich mit dem, was man hat, zufriedenzugeben oder seine Sachen zu packen.
ARS: Da scheint es so, als würde das Thema Emanzipation benutzt, um die eigene westliche Überlegenheit gegenüber einer scheinbar rückständigen Kultur herauszustreichen.
JH: Das hat mich zusätzlich zum Schreiben angespornt. Denn genau so empfinde ich die Lage, und genau so stellt sie sich in Finnland dar. Wir Frauen sollen uns hier mit 80 oder 90 Prozent dessen zufriedengeben, was die Männer haben.
ARS: Während des Lesens wird klar, dass es, egal, ob die Frau sich bedeckt oder enthüllt, ob sie also Kopftuch oder Stringtanga trägt, immer um Unterwerfung geht. Der Frau wird vorgeschrieben, wie sie sich zu kleiden, wie sie auszusehen hat. Darin sind die unterschiedlichsten Kulturen sehr gleich.
JH: Richtig. Es gibt immer jemanden, der ihnen sagt, was sie zu bedecken oder zu enthüllen haben, was sie tragen oder nicht tragen sollen, wie sie zu sein oder nicht zu sein haben. Was zählt, ist der Wunsch der anderen.
ARS: Das machst du besonders anschaulich über Samira. Samira verbringt die Hälfte des Romans im Koma. Sie wurde von der Treppe gestoßen und so schwer verletzt, dass sie monatelang ohne Bewußtsein ist. Was von ihr bleibt, ist der Körper. Sie hat keine Handlungsmacht, keine Sprache. Sie ist nur als Körper anwesend, der dann sogar verheiratet wird. Das ist ein tragischer, aber auch absurder Moment in deinem Buch.
JH: Genau. Ich wollte dieses fiktionale Experiment wagen, da so eine Heirat theoretisch nicht ausgeschlossen ist. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich schon gab, aber nach islamischer Praxis wäre es möglich. Es ist der Vater, der seine Einwilligung geben muss und der seine Tochter ohne deren Zustimmung verheiraten kann.
Fängt man allerdings erst mal an, darüber nachzudenken, stellt sich die Sache ganz schön kompliziert dar. Einerseits sagt Samira nichts und ist komplett passiv, andererseits bekommt sie genau dadurch das, was sie will. Sie will diesen Mann, Piter, den sie unter normalen Umständen nie hätte heiraten dürfen. Das fand ich witzig.
ARS: Es hat mich sehr gefreut, dass sie nicht sterben muß.
JH: Sie erwacht und bekommt, was sie will.
ARS: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auf diesen merkwürdigen Piter zu sprechen kommen. Er ist ein Neo-Nazi, aber nachdem er Samira vor seinen Kumpels rettet und sich in sie verliebt, konvertiert er zum Islam. Er ist für mich der ungewöhnlichste Konvertit des Buches. Es sind ja insgesamt drei, außer ihm noch die Mutter und Jasmina, die ursprünglich Christin ist. Alle konvertieren aus unterschiedlichen Gründen. Diese Religionswechsel sagen auch etwas über unser Verständnis von Identität aus. Wir können uns jederzeit neu zusammensetzen, auch der Glaube gilt nicht lebenslang. Aber ist Piters Geschichte wahrscheinlich?
JH: Piter ist für mich ein Opportunist. Er ist jemand, der immer in die Rolle schlüpft, die sich gerade anbietet. Darin hat er viel mit Politikern gemein. Das ist die Aufgabe, die ihm im Roman zukommt. Er ist von nichts und niemandem wirklich überzeugt und folgt einfach nur seinem eigenen Plan, indem er sich wandelt.
ARS: Gut, aber was bedeutet es, dass sich Samira ausgerechnet ihn aussucht?
JH: Das lässt sich nicht einfach beantworten. Vielleicht repräsentiert er etwas, von dem sie niemals geglaubt hätte, es je zu bekommen: einen finnischen Ehemann.
ARS: Ihr Verhältnis scheint mir auch ein gegenseitiges Spiegeln darzustellen; man sucht im Anderen sich selbst. Und dazu braucht man den scheinbar größten Gegensatz. Gewöhnlich führt das zu Abgrenzung und Haß, wie du es am Beispiel des Neonazis ja vorführst. Und gleichzeitig steckt eben auch das genaue Gegenteil darin.
JH: Es ist natürlich auch aus einem Machtaspekt heraus interessant. In welchem Maße kann man einen anderen Menschen dazu bringen, sich für einen selbst zu ändern? Samira erkennt, dass Piter wankelmütig ist, dass sie ihn kontrollieren und ändern könnte. Ich habe festgestellt, dass viele muslimische Männer, die eine finnische Frau heiraten, versuchen, sie zu ändern, sie auf gewisse Weise zu konvertieren. Und Samira ist eben eine Frau, die genau das mit einem Mann versucht.
ARS: Jasmina dagegen kommt aus einer christlichen Einwandererfamilie und konvertiert als Christin zum Islam. Sie bekommt es mit stereotypen Wahrnehmungen zu tun, die so übermächtig sind, dass sie den einzigen Ausweg schließlich darin sieht, in das Herkunftsland ihrer Eltern zurückzukehren. Einmal in der Schublade der Ausländerin erwarte niemand mehr etwas von ihr, außer dass sie stehle und Drogen nehme, heißt es an einer Stelle. Ihre Eltern machen in vorauseilendem Gehorsam mit und denken gar nicht daran, sie auf eine Uni zu schicken. Immer wieder muß sie in der Öffentlichkeit erklären, dass sie in Finnland geboren wurde. Diese Stereotype sind so stark, dass Samira sie sogar selbst reproduziert. Nachdem sie von ihrem Bruder verprügelt wurde, erzählt sie Leila, dass finnische Sicherheitskräfte sie zusammengeschlagen hätten. Anscheinend eine ausweglose Situation, vor allem, weil sie jede Möglichkeit einer persönlichen Entwicklung zu vereiteln scheint.
JH: Ich wollte, dass Jasmina eine Christin ist, um klarzumachen, dass eine frauenfeindliche Gesellschaft nicht zwangsläufig islamisch ist. Jasmina stammt zwar aus einer christlichen Familie, aber die Konstellationen sind die gleichen. Auch hier sind es die Männer, die das Sagen haben. Darin liegt ein Überraschungsmoment. Patriarchale Strukturen sind also keine Frage der Religion, sondern der Kultur. Und ich habe im gesamten Buch darzustellen versucht, dass nicht die Religion die Probleme verursacht – sie kann unter Umständen sogar zu ihrer Lösung beitragen –, sondern die Kultur, die patriarchale Kultur. Wir begegnen ihr überall wieder. Das wird nur gern mit der Religion vermischt. Im Islam wird das aufgrund der Kleiderordnung, aufgrund dessen, was die Frauen tragen, so augenscheinlich. Würden sie alle Miniröcke tragen, wäre es weniger offensichtlich.
ARS: Wie gesagt: Miniröcke sind das Gleiche in grün.
JH: In der christlichen Kultur ist das Problem durch den westlichen Kleidungsstil weniger sichtbar. Daher wird dem Kopftuch auch soviel Aufmerksamkeit geschenkt, weil es eben so auffällig, so angreifbar ist. Ich glaube nicht, dass es den arabischen Frauen, würde man sie alle vom Kopftuch befreien, von heute auf morgen besser gehen würde. Es geht im Prinzip nicht um die Kleidung. Es geht um die gesellschaftlichen Strukturen.
Beim Kopftuch, über das ständig geredet wird, handelt es sich um ein kulturelles Phänomen. Im Islam geht es kaum um Kleidungsstücke. Die Leute glauben aber, dass es der Koran ist, der den Frauen den Schleier verordnet. Das stimmt nicht. Die weibliche Beschneidung, die Genitalverstümmelung, ist ein weiteres Beispiel. Die Leute gehen davon aus, dass das vom Koran vorgeschrieben wird. Auch das trifft nicht zu. Es handelt sich um eine kulturelle Praxis. Trotzdem sind sich die Leute sicher, dass es im Koran steht. Wenn man dort nachschaut, wird man aber nichts darüber finden. Es wird nur in einigen eher unsicheren Quellen wie den Erzählungen über das Leben des Propheten erwähnt. Diese Verwirrung wollte ich thematisieren, um den Unterschied zwischen Kultur und Religion klarzumachen.
ARS: Indem du von verschiedenen Frauen erzählst, die alle ganz eigene Vorstellungen davon haben, warum sie ein Kopftuch tragen oder nicht, nimmst du dem Kopftuch das Abstrakte, das Mythische. Das Kopftuch wird ja gern mit der Unterdrückung im Islam oder mit einer muslimischen Bedrohung der europäischen Werte gleichgesetzt. Selten fragt man nach individuellen Geschichten, nach der Realität der Frauen, die sich dafür entscheiden, ein Kopftuch zu tragen.
Deshalb fand ich es interessant, aus wie vielen Blickwinkeln du das Phänomen betrachtest. Witzig ist natürlich, dass Leila lieber eine Kapuze trägt.
JH: Ich habe mit Konvertitinnen und islamischen Frauen gesprochen. Und alle haben mir erzählt, dass die Gründe für das Tragen des Kopftuchs vielfältig sind. Es gibt auch genug Frauen, die sich dafür entscheiden, es nicht zu tragen.
ARS: Es wird öfter gefordert, der Koran müsse stärker auf die heutige Zeit hin gelesen werden. Glaubst Du, dass sich dadurch auch einige der Missverständnisse und Vorurteile gegenüber der islamischen Kultur ausräumen ließen?
JH: Ja. Was ich während meiner Recherchen zu dem Roman vielleicht am interessantesten fand, waren die feministischen Deutungen des Korans. In den 90er Jahren hat erstmals eine Frau den Koran aus weiblicher Sicht gelesen. Sie machte unter anderem klar, dass die Religion ursprünglich eine progressive Kraft gewesen sei, keine reaktionäre. Sie stand im Dienste des Wandels, die Gesellschaft sollte sich positiv durch sie verändern. Mit dem Tod des Propheten war dieser Prozess keineswegs abgeschlossen, er sollte fortgesetzt werden. Es gibt in der Religion selbst also nichts, was gegen Entwicklung, Fortschritt oder Veränderungen spricht. Man muss natürlich die gesellschaftlichen Kräfte berücksichtigen, die sich gegen einen solchen Wandel stellen. Dabei stößt man schnell auf die etablierten, männlich dominierten Strukturen, in denen Männer davon profitieren, dass alles beim Alten bleibt. Oft sind die Menschen auch nicht in der Lage, selbst den Koran zu lesen. Sie müssen an das glauben, was andere ihnen erzählen. Frauen haben noch nicht einmal Zutritt zu den Moscheen. Dadurch sind sie von den sogenannten Vätern abhängig, die ihre eigenen Ziele und Absichten verfolgen. Es gibt auch viele verschiedene Auslegungen des Korans. Je nachdem, mit wem man spricht, hört man eine andere Version. Wenn mir als Bäuerin in einem entlegenen Dorf gesagt wird, dieses oder jenes stünde im Koran und ich das als Analphabetin nicht überprüfen kann, muß ich es glauben. Ich habe keine Möglichkeit, das in Frage zu stellen.
ARS: Vielleicht darf ich an dieser Stelle etwas in Frage stellen. Was mir an der ganzen Kopftuchdebatte aufstößt, ist die Tatsache, dass das Kopftuch kein rein religiöses Symbol ist wie etwa die Kippa, sondern innerhalb eines geschlechtsspezifischen Kontextes getragen wird. Man trägt es nicht, um in Verbindung zu Gott zu treten, sondern wenn Männer zugegen sind. Wie kann es dann trotzdem in einem emanzipatorischen Zusammenhang gelesen werden?
JH: Das Kopftuch wird unterschiedlich interpretiert. Ein Ansatz lautet, dass man es überhaupt nicht ablegen darf. Nicht einmal in Gegenwart anderer Frauen. Deshalb fragt die Friseurin im Roman Leila auch, ob es stimmt, dass sie ihr Haar nicht einmal vor einer anderen Frau entblößen darf. Es gibt aber auch die Auffassung, dass es erlaubt ist, das Koptuch vor den Familienmitgliedern – ob weiblich oder männlich – abzunehmen, weil sie einen als Menschen und nicht aufgrund des Aussehens schätzen. Aber wie du bereits gesagt hast: Es ist eine Genderfrage. Ich glaube, dass Sarah, für die das Kopftuch Ausdruck der Kontrolle über ihren eigenen Körper ist, sich in einer Welt verortet sieht, die sie zur Verhüllung zwingt. In einer idealen Welt hätte sie das nicht nötig. In einer idealen Welt wäre der weibliche Körper nicht sexualisiert, kein Objekt. Aber sie sieht die Welt nicht als eine ideale an. Also trägt sie dieses Kopftuch, um sich vor dem männlichen Blick zu schützen, der ja definitiv vorhanden ist.
ARS: Indem sie sich ihm zugleich unterwirft.
JH: In einer besseren Welt würde sie wahrscheinlich kein Kopftuch tragen.
ARS: Verstehst du dich als politische Schriftstellerin? Du engagierst dich, nimmst an Online-Diskussionen teil. Ist dein Roman auch ein politisches Buch?
JH: Ja, ich denke, dass es sich um ein politisches Buch handelt. Und um ein feministisches. Ich versuche darin unterschiedliche Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man in unserer heutigen Gesellschaft als Frau leben kann. Und die Dinge, die mich antreiben, die mich zum Schreiben bringen, sind genau die Dinge, die ich an unserer Gesellschaft verstörend finde und genauer erkunden möchte. Deshalb wähle ich auch aktuelle Themen. Ja, ich schätze, dass ich beim Schreiben politisch bin. Dennoch möchte ich keine Position beziehen, sondern das gesamte Spektrum abbilden. Ich bin also weder links noch rechts.
ARS: Ich kann den Begriff des Politischen in Bezug auf Literatur auch nur als Engagement oder gesellschaftliche Wachheit verstehen, als den Wunsch, mit dem eigenen Schreiben etwas zu verändern.
JH: Wenn ich die Möglichkeit habe, meine Stimme einzusetzen, um etwas zu erreichen, empfinde ich es gewissermaßen als Verpflichtung, sie auch zu nutzen – denen eine Stimme zu verleihen, die vielleicht selbst nicht für sich sprechen können.
ARS: Wird „Asphaltengel“ denn auch als kritischer Kommentar auf die finnische Gesellschaft gelesen? Oder gilt es vor allem als Geschichte über die migrantische Jugendszene?
JH: Meiner Ansicht nach trifft beides zu. Linda beispielsweise, Leilas beste Freundin, ist eine typische junge, westlich sozialisierte Frau, die sehr viel Wert auf ihre Kleidung legt und Miniröcke trägt. Und ihr geht es damit nicht besonders gut. Und ich thematisiere absichtlich auch die sexuellen Belästigungen auf dem Schulhof, die mit 13 oder 14 anfangen, sobald die Jungs sich für einen interessieren und das nur ausdrücken können, indem sie einen bedrängen. Die Lehrer sagen dazu nichts, finden das offenbar in Ordnung. Man soll sich also schlicht und ergreifend damit abfinden, dass der Körper entblößt und beurteilt, dass man begrapscht wird. Dabei geht das gar nicht in Ordnung, das sind Übergriffe, und wenn sie zu weit gehen, sind sie strafbar. Aber man wird eben schon in einem sehr frühen Alter dazu erzogen, das hinzunehmen.
ARS: Wie wäre es, den Jungs und Männern zu sagen: tut das nicht? Wie wäre es, statt immer nur den Frauen Verhalten und Kleidung vorzuschreiben, den Männern beizubringen, wie sie sich zu verhalten haben? Vorschläge, die du ebenfalls in deinem Buch ansprichst. Es gibt in den USA einen sehr starken feministischen Diskurs, der genau das einfordert. HeForShe beispielsweise ist eine Bewegung, die die Männer stark in die Debatten über Gleichberechtigung einbezieht und unterstützt wird von SchauspielerInnen und der Politik. Es gibt Journalistinnen, die fordern „Don’t rape!“ In Deutschland, scheint mir, gilt Feminismus immer noch als uncool. Auch in Skandinavien habe ich dagegen ganz andere Erfahrungen gemacht.
JH: In Schweden hat der Feminismus Aufwind. Da zeichnen sich neue Wege ab.
ARS: Vor allem unter den jüngeren Schriftstellerinnen, scheint mir, und in der Comicszene.
JH: Ja. Aber in Finnland sieht es ähnlich aus wie in Deutschland. Ich versuche gerade mit einer befreundeten Journalistin eine Anthologie über den Feminismus in Finnland zusammenzustellen, und wir treffen auf heftigen Gegenwind. Als nächstes werde ich versuchen, Geld dafür aufzutreiben und profilierte Autorinnen für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Vielleicht gelingt es uns, eine Diskussion in Gang zu bringen.
ARS: Gibt es nicht mit Astra ein sehr gutes Magazin zumindest auf Finnlandschwedisch?
JH: Mehr als Astra haben wir hier aber eigentlich nicht.
ARS: In Deutschland ist noch immer die Emma die einzige prägende Zeitschrift. Dabei ist es längst an der Zeit für junge starke Stimmen. Aber Deutschland kommt mir in seiner Mentalität oft vor wie ein behäbiger Tanker, übriggeblieben aus dem Industriezeitalter, so ein riesiges, angerostetes, in die Jahre gekommenes Containerschiff, auf dem es undenkbar ist, daß ein männlicher Kapitän von sich behaupten könnte, er sei Feminist. Man muß sich das mal vorstellen; wir klagen über Fachkräftemangel, liegen aber im letzten Global Gender Gap Report noch hinter Nicaragua!
JH: Das sind Statistiken. Nach allem, was ich in Deutschland gesehen und gehört habe, glaube ich, dass wir, also Finnen und Deutsche, eine Menge gemein haben. Vielleicht sind sich also auch die Gesellschaften ein bisschen ähnlich, die Werte etc. Man ist halt ein bisschen hinter Schweden zurück.
ARS: Was hältst du eigentlich von den schönen Fotos der finnischen Künstlerin Rosa Liksom, auf denen sie Frauen in leuchtend blauen Burkas in finnischer Landschaft zeigt?
JH: Ich bin da sehr zwiegespalten. Wahrscheinlich möchte sie das Kleidungsstück „entwaffnen“, indem sie zeigt, dass es überall getragen werden kann.
ARS: Selbst im Schnee bei minus fünfundzwanzig Grad.
JH: Vielleicht wirkt die Burka weniger bedrohlich, wenn man sie in einem vertrauten Zusammenhang platziert. Gleichzeitig weiß man, dass sie für viele Frauen ein Gefängnis ist, dass sie keine Wahl haben. Vor diesem Hintergrund hinterlassen die Bilder bei mir ein ungutes Gefühl. Zu sehen, wie westliche Frauen damit herumspielen und Kunst daraus machen. Sie können die Burka schließlich jederzeit ablegen. Niemand wird sie dafür töten. Das aber ist der Alltag der anderen Frauen. Sie müssen die Burka tragen oder mit schlimmen Konsequenzen rechnen. Ist das lustig? Nein.
ARS: Da hast du recht. Dieser Extremismus ist alles andere als lustig. In deinem Buch thematisierst du gleich mehrere Spielarten von Extremismus, den religiösen, wie den politischen.
JH: Ich wollte verschiedene Möglichkeiten des Extremen darstellen. Auch Linda, Leilas beste Freundin, ist ja extrem in ihrer Fixierung auf Modemarken. Leila ist wahrscheinlich die einzige nicht extreme Figur. Sie ist irgendwo in der Mitte. Aber ja, ich wollte zeigen, dass es keine Rolle spielt, von welcher Ausgangssituation man zum Extremismus findet. Er führt nie zu etwas Gutem und erzeugt jede Menge Konflikte. Niemand ist bereit, sich auf Kompromisse oder Diskussionen einzulassen. Irgendwann kollidieren die extremistischen Positionen miteinander.
ARS: Das bringt uns nochmal zurück zur Schulsituation. Schon hier prallen ja Extreme aufeinander, und die Lehrer schauen meistens tatenlos zu. Leila scheint dazwischen zu stehen. Sie ist nirgendwo verortet, du sagtest, sie ist irgendwo in der Mitte. Sie kommt mir vor wie auf der Flucht. Nur weiß sie selbst nicht, wovor oder wohin sie flieht. Sie macht mit bei diesen wilden Rennen durch die Stadt, ein Sport, ein Hobby? Aber nur ihre Schwester Samira scheint wirklich eine Art Fixpunkt für sie zu sein.
JH: Ein Aspekt des Umherrennens ist, dass man im Dunkeln kaum sagen kann, ob es sich um Männer oder Frauen, um Jungen oder Mädchen handelt, die da durch die Stadt jagen. Sie sehen alle gleich aus und werden als aufdringlich und aggressiv wahrgenommen, obwohl sie es gar nicht sind. Es ist ihre Art, sich die Stadt, die Straße anzueignen, und das auf eine absolut legale Weise, die von den Leuten aber als anstößig und irgendwie auch als verstörend und wenig feminin empfunden wird.
ARS: Auch eine Art der Selbstbehauptung. Eine Möglichkeit, gleich mehreren Kategorisierungen zu entkommen und die Macht über sich zu erlangen. Aber es gibt noch eine andere Außenseiterin, Anna, die ohne ersichtlichen Grund gehasst und immer wieder verprügelt wird. Sie gewinnt Selbstachtung, indem sie bei einem Gesangswettbewerb auftritt.
JH: Die Schilderungen entsprechen mehr oder weniger meinen eigenen Erfahrungen aus der Schulzeit. Abgesehen davon, dass mir diese großen, siegreichen Momente nicht vergönnt waren. Die habe ich mir ausgedacht. Niemand war der “singing star”. Aber ich bin ja schließlich Schriftstellerin geworden (lacht). Trotzdem entspricht das meiste der Realität. Traurig daran ist, dass es auf den finnischen Schulhöfen tatsächlich so zugeht. Wir schneiden zwar bei Pisa gut ab, trotzdem gibt es viele Probleme.
ARS: Ich ging davon aus, dass das finnische System autoritärer organisiert ist als das deutsche, die Lehrer auch mehr Einfluß, mehr Kontrollmöglichkeiten haben.
JH: Meiner Erfahrung nach halten sich die Lehrer aus klasseninternen Streitigkeiten raus, um nicht selbst in den Fokus zu geraten. Sie mischen sich nicht ein. Das Klassenzimmer ist ihr kleines Königreich, aber alles, was sich außerhalb davon abspielt, ist nicht ihr Problem. So habe ich es während meiner Schulzeit erfahren.
ARS: Ich danke dir für den Ausflug in dein literarisches Reich! Ich habe zwar noch eine Menge Zettel vor mir, aber ich glaube, unser Gespräch zeigt schon sehr gut, wie vielschichtig und anregend dein Buch ist. Ich werde leider nicht auf der Buchmesse sein, ich wünsche dir aber viele gute Gespräche, wenig konfrontativ, aber aufregend genug, um dich dazu zu verleiten, den nächsten Roman zu schreiben.
JH: Ich bedanke mich auch für das Interview.
 Antje Rávic Strubel
Antje Rávic Strubel
Antje Rávic Strubel, 1974 in Potsdam geboren, aufgewachsen in Ludwigsfelde, arbeitet nach Ausbildung zur Buchhändlerin und Studium als Übersetzerin und Schriftstellerin und wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet. Sie lebt in Potsdam und veröffentlichte u.a. die Romane „Tupolew 134“, „Kältere Schichten der Luft“ und „Sturz der Tage in die Nacht“. Bei Piper erschienen von ihr die „Gebrauchsanweisung für Schweden“ sowie zuletzt ihre „Gebrauchsanweisung für Potsdam und Brandenburg“. (Quelle: http://www.piper.de/autoren/antje-ravic-strubel-2009)