Wer sich nach Heimat sehnt, ist oftmals überfordert. Und wer sie bewahren will, sollte vorwärts statt rückwärts denken. Ein Essay von Jörn Klare, der 600 Kilometer gewandert ist, um sich seiner Heimat zu nähern.

Schon die eher kämpferischen denn friedlichen Romantiker, die unsere Vorstellung von der Heimat als einem „Wunschort der Geborgenheit“ prägten, taten dies aus dem Gefühl der Überforderung heraus. Die französische Revolution, die Europa entscheidende Reformideen sowie zahlreiche Kriege bescherte, lag damals nur wenige Jahre zurück. Die massiven politischen und ökonomischen, aber auch die kulturellen und sozialen Veränderungen zerstörten über Generationen hinweg gelebte Strukturen oder stellten sie zumindest radikal in Frage. Als sich im Jahr 1806 das jahrhundertelang weitgehend stabile Heilige Römische Reich Deutscher Nation auflöste, verschwanden zweihundertsechzig von dreihundert „Vaterländern“. Die neuen Territorialstaaten bestimmten sich nicht mehr über die Zugehörigkeit zu einem Stamm und wurden meist als beliebig und willkürlich wahrgenommen. Die Sehnsucht nach Überschaubarkeit und Vertrautheit wuchs auf vielen Ebenen. Das Ideal hieß Heimat.
Rechte Heimatvereine gegen die großstädtische Moderne
Einen weiteren Höhepunkt erlebte dieses Wunschbild zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts als Gegenkonzept zur Industrialisierung mit all ihren weitreichenden Folgen. Auch hier ging es der romantischen Prägung entsprechend um die Bewahrung des Althergebrachten in einer sich immer schneller und radikaler wandelnden Welt. In diesem Zeitraum entstanden in ganz Deutschland zahlreiche Heimat-, Trachten-, Geschichts- und Volkskunstvereine, die sich im Sinne des Heimatschutzes gegen die Entwicklungen der großstädtisch geprägten Moderne wandten. Vor allem das vermeintlich künstliche, anonyme und „entnaturalisierte“ Berlin wurde zum Symbol des Unheimatlichen. Schließlich nutzte die NSDAP den Heimatbegriff zur Idealisierung eines „bodenständigen deutschen Volkstums“, das sich gegen vermeintliche Überfremdung zu wehren hatte, um seine „völkische Überlegenheit“ zu behaupten. Sehr früh schon sandten dazu die Heimatbünde den Nazis ihre Ergebenheitsadressen, und gleich 1933 wurde der in Dresden gegründete Deutsche Heimatbund offiziell in den „Reichsbund Volkstum und Heimat“, den Dachverband vieler NS-Kulturorganisationen, eingegliedert. Davon hat sich die Vorstellung von Heimat bis heute nicht wirklich erholt, was sicher auch daran liegt, dass viele der noch heute zahlreichen Heimatvereine diese Zeit, wenn überhaupt, nur zögerlich aufgearbeitet haben.
Heimweh als Zeitweh
Gleichwohl blüht die Karriere der Heimat als Stereotyp einer friedlichen Idylle in diesen Tagen nicht nur wieder am rechten oder auch sehr rechten Rand unserer Gesellschaft auf. Und wäre der Begriff „Heimatschutz“ nicht durch den NSU und seine Gesinnungsgenossen erst mal wieder nachhaltig diskreditiert, würde auch er wohl noch öfter in unseren Ohren klingeln. Wieder geht es um die sehnsuchtsschwangere Glorifizierung einer Zeit, die Überschaubarkeit bot, schon weil erinnerte Vergangenheit abgeschlossen und von daher grundsätzlich überschaubar ist. Heimweh als Zeitweh. Doch Hand aufs Herz: Wer schaut bei den aktuellen Herausforderungen – Klimawandel, globale Wirtschaftskrise, die radikale Digitalisierung aller Lebensbereiche, das Zerbröseln der europäischen Idee, die Kriege am Rand unseres Kontinents und der nun auch uns bedrohende Terrorismus – noch entspannt und frohgemut in die Zukunft? Und dann sind da ja noch die vielen fremden Menschen, die auf ein sicheres und vielleicht sogar besseres Leben in unserer Gesellschaft hoffen und uns allein schon durch ihre Existenz darauf hinweisen, dass der Exportweltmeister Deutschland in einer globalisierten Welt nicht nur bequem die Gewinne einstreichen kann.

Dabei sollte es auch nicht verwundern, dass „Heimat“ und „Schutz“ in den neuen Bundesländern oft ein wenig lauter gebrüllt werden als im Rest des Landes. Denn auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ist die allgemeine Verunsicherung der Menschen wohl noch etwas größer, weil ihnen mit der Wende schon einmal nicht unbedingt geliebte, aber doch vertraute Überschaubarkeit und somit eben Heimat verloren ging. Nachdem sie sich quasi als Migranten im eigenen Land meist mühsam in das für sie neue System der BRD hineingearbeitet haben, ist ihr heimatliches Selbstverständnis häufig um einiges fragiler als in den alten Bundesländern. Und wer sich seiner Heimat selbst nicht sicher ist, tut sich schwerer, sie anderen als Zuflucht anzubieten.
Heimat als Handlungs- und Verantwortungsraum
Nüchtern betrachtet bezieht sich Heimat erst mal auf die Beziehung zwischen Mensch und Raum und changiert subjektiv zwischen Herkunft und Zugehörigkeitsgefühl. Da die Zeit aber nun mal voranschreitet, ist es, bei allem Respekt vor der Neigung zu Sentimentalität und Melancholie, ganz und gar nicht hilfreich, Heimat als ein starres Konstrukt zu begreifen, das angstvoll abgeschottet werden muss. Sie ist mehr als eine Fluchtphantasie, mehr als ein vergangenheitsbestimmter Gegenentwurf zu den Herausforderungen einer schwierigen Gegenwart. Ja, es gilt, Heimat aus der Zwangsjacke der Nostalgiker zu befreien, damit sie als etwas noch zu schaffendes begriffen werden kann. Etwas gemeinsam zu schaffendes! Eben ein politischer Handlungs- und Verantwortungsraum, der von den Menschen, die ihn bewohnen, gestaltet werden kann und muss. Ob es dabei nun um den Ausbau eines Spielplatzes, den Erhalt einer Grundschule, eine Umgehungstraße, den Schutz einkommensschwacher Mieter vor der Verdrängung oder den Widerstand gegen die Fremdbestimmung durch ein globales Wirtschaftsabkommen geht. Und auch der Wunsch nach Mitbestimmung in Bezug auf die Ansiedlung größerer Gruppen unbekannter Menschen ist jenseits aller Apelle an Solidarität und Menschlichkeit grundsätzlich legitim. Widerspruch und auch Streit müssen möglich sein. Allerdings ist es unabdingbar, dass all diese Prozesse im Rahmen des Grundgesetzes stattfinden.
Letztlich ist es für die Zukunftsfähigkeit eines solchen konstruktiven Heimatbegriffes entscheidend, dass es gelingt, jene Flüchtlinge, die bleiben werden, zu integrieren. Und diese Integration ist nur möglich, wenn wir den Heimatsuchenden mit einem Heimatangebot begegnen, das es ihnen ermöglicht, Verantwortung für ihren neuen Lebensraum zu übernehmen. Nur dann können sie ihn als Heimat begreifen, schätzen und entwickeln. Denn die bedrohliche, vor allem aber auch stark thematisierte Gewalt, die von einzelnen Migranten oder auch kleineren Gruppierungen ausgeht, lässt sich durchaus auch als Folge von Ignoranz und Ablehnung durch ihre Umwelt verstehen. Wer sich unter solchen Umständen nicht als Opfer sehen will, neigt zur Rolle des Täters. Sicher ist diese Heimatarbeit ein anstrengender Prozess, der Dialogbereitschaft, Wachheit, Reflexion, Selbstkritik und auch Großzügigkeit erfordert. Doch wer Heimat bewahren will, muss sie öffnen und selbstbewusst entwickeln. Nur dann hat sie eine Zukunft.
Das Buch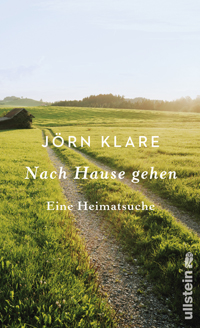
Was genau ist Heimat? Was bedeutet sie? Und warum ist sie wichtig? Jörn Klare geht dem sehr persönlich und ganz wörtlich nach. Von seiner Berliner Haustür aus wandert er an den Ort seiner Kindheit und Jugend am Rand des Ruhrgebiets. Ein Weg über gut 600 Kilometer, erst durch Ostdeutschland, das ihm immer noch fremd ist, dann durch Westdeutschland, das ihm oft nicht mehr vertraut ist. An Orten, die Alte Hölle, Elend oder Wilde Wiesen heißen, begegnet er Menschen, die ihre Heimat lieben, an ihr leiden und für sie kämpfen. Schließlich erreicht er die kleine Stadt, die einst sein Leben war.
Jörn Klares Weg führt zum Ziel. Seine Wanderung durch ein Deutschland, das man kaum kennt, liefert die Grundlage für eine persönliche und großartig geschriebene Auseinandersetzung mit der Frage: Wohin gehöre ich in einer Welt, die sich immer schneller wandelt?
Links
Nach Hause gehen auf den Seiten der Ullstein Buchverlage
Jörn Klares offizielle Website

