Der amerikanische Horror- und Sci-Fi-Autor Theodore Sturgeon (1918-1985) ist einer breiten Öffentlichkeit fast unbekannt – vor allem in Deutschland, wo sein Werk über Jahrzehnte nicht erhältlich war – und doch gilt er unter Kennern als einer der wichtigsten und einflussreichsten Schriftsteller der modernen phantastischen Literatur. Unsere Autorin Nina Blazon ist ein großer Fan seines Schaffens. Hier erzählt sie, wie er sie immer wieder in ihren eigenen Geschichten inspiriert – so auch durch seine bekannteste Kurzgeschichte Biancas Hände von 1947.
„Live long and prosper!“
Wer kennt nicht Mister Spocks Vulkaniergruß aus der Star-Trek-Saga? Zum ersten Mal taucht diese Formel in der Folge Weltraumfieber (Amok time) im Jahr 1967 auf. Schöpfer dieser Worte ist Theodore Sturgeon. Er verfasste das Drehbuch zu dieser legendären Folge, in welcher er der vulkanischen Kultur auch noch eine ganz neue Facette hinzufügte: Er ließ einen von blutgieriger Raserei getriebenen Spock einen archaischen Brautwerbungskampf auf Leben und Tod ausfechten. Und als würde das die vulkanische Charakterzeichnung strengster Emotionslosigkeit nicht schon genug gegen den Strich bürsten, sehen wir in dieser Folge Mister Spock auch noch zum ersten Mal außer sich vor Freude, lachend vor Glück. Typisch Sturgeon: Wo er die Feder ansetzt, ist nichts (und niemand) mehr so, wie man es erwartet. Und trotzdem ist es stimmig und bereichernd für Figuren und Story – vor allem aber für das Herz des Lesers.
„Theodore … wer?“ ist die häufigste Reaktion, wenn ich den Namen meines Lieblingsschriftstellers nenne. „Was hat er denn geschrieben?“
Beide Fragen sind schnell beantwortet: Sturgeon (geboren 1918 in New York, gestorben 1985 in Oregon) verfasste Kurzgeschichten und Romane aus den Genres Science Fiction, Fantasy und Horror. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Biancas Hände (Bianca’s Hands), Die Liebesvögel (The World Well Lost), Bedürfnisse (Need) und Killdozer! (dto.). Zu Lebzeiten erhielt Sturgeon nur wenige Auszeichnungen und ist zumindest hierzulande am ehesten noch Science-Fiction-Fans ein Begriff. In seinem Heimatland kennt man ihn als einen der einflussreichsten Autoren des Golden Age of science fiction. In den 1950ern war Sturgeon sogar der am häufigsten in Anthologien vertretene lebende Autor. Sein Einfluss spiegelt sich in den Werken von Stephen King ebenso wie bei Ray Bradbury und Kurt Vonnegut, die Sturgeons Werk als maßgeblichen Einfluss in ihrem Schreiben bezeichnen. „A wonderful dramatist with the heart of a poet.“ So nannte ihn Leonard Nimoy; Peter S. Beagle verehrt ihn und der Regisseur und Drehbuchautor James Gunn sagt: „Ted was the heart, sometimes the bleeding heart, of science fiction.“
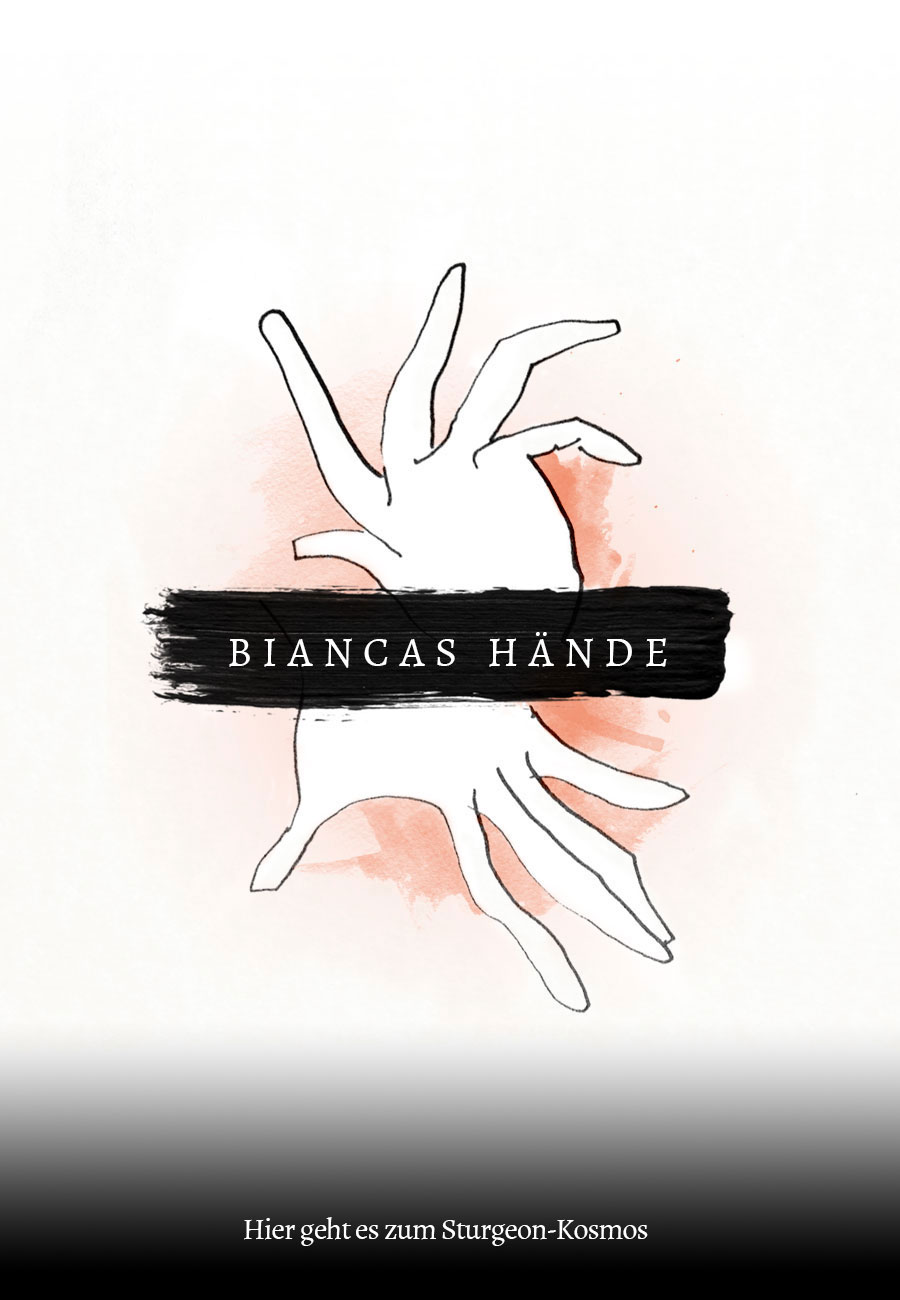
Womit wir wieder beim Herzen wären. Was ist das Besondere an seinen Werken, dass bis heute Leser, Schriftsteller und Filmemacher so nachhaltig berührt, erschüttert und inspiriert – und warum ist er selbst zu Lebzeiten nicht viel bekannter geworden? Möglicherweise, weil er in vielerlei Hinsicht ein Pionier war, eine Art literarischer Beatnik der 1950er, der sich von Faulkner und Joyce inspirieren ließ und mit Metrik experimentierte. Sturgeon spielte mit Stimmungen und Rhythmik, feinnervig, subtil und … hinterhältig. Bei vielen Geschichten zuckt man schon, bevor der Schuss fällt, so genial lenkte er Spannung und Stimmung nur mit Rhythmen und Sprachklang. Mit seinem Willen, schon allein durch die Schönheit der Sprache zu berühren, fiel er in der damaligen Science-Fiction-Literatur deutlich aus dem Rahmen. Noch ungewöhnlicher waren seine Themen. Sturgeon ging es nie um technische Finessen der Raumfahrt oder das Lokalkolorit fremder Planeten,vielmehr richtete er seinen Fokus auf soziale und psychologische Themen, beleuchtete Krieg, Liebe, Sexualität, Ausgrenzung und Entfremdung und erweckte Charaktere zum Leben, die sich jedem bequemen Pauschalurteil entziehen. (Nicht ohne den Leser erst einmal aufs Glatteis zu führen. Aus Erfahrung kann ich sagen: Manchmal dauert es Jahre, um sich auf Händen und Knien vorsichtig wieder an Land zurückzutasten.)
Immer wieder geht es bei Sturgeon um das Gefühl, fremd zu sein. Seine Eroberer sind keine coolen Space Captains, sondern Menschen, die vor Einsamkeit verrückt werden, die mit Ausgrenzung durch andere und mit ihrer eigenen Unzulänglichkeit hadern. Die gezwungen sind, philosophische und moralische Entscheidungen zu treffen, die den Leser noch wochenlang beschäftigen. Auch damit war er seiner Zeit voraus: Niemand zuvor hatte so verletzliche Helden dargestellt, psychologisch ausgefeilt und ambivalent. Helden, die im Jahr X irgendwo im Weltall unterwegs sind und den Lesern dennoch mit ihrer Zerrissenheit und ihrer Charaktertiefe so nahe sind, als würde man Haut an Haut ihren Herzschlag spüren. Immer wieder stellen Sturgeons Außenseiter die Frage danach, wie es sich anfühlt, anders zu sein, wer diese Normen definiert und was es bedeutet – sowohl für den, der anders ist, als auch für „die Anderen“. Dabei verschwimmen häufig auf überraschende Art die Grenzen. Denn ein Alien kann bei Sturgeon jeder sein – der Bewohner eines anderen Planeten oder auch der Mensch in seiner eigenen Gesellschaft. Es geht also gar nicht um Aliens, sondern um „alienation of those felt to be different from the norm“. Wenn, wie in der Story Die Liebesvögel zwei entflohene Bewohner des Planeten Dirbanu auf einem Gefängnisschiff wieder an ihr Heimatland ausgeliefert werden, dann setzt Sturgeon eine Zweimann-Crew ins Cockpit – und das Thema lautet Homosexualität. Nur wir Leser kennen das Geheimnis von Crewmitglied Nummer zwei, der sich nach Nummer eins verzehrt und sich auf keinen Fall offenbaren darf, weil es sein Leben zerstören würde. Aber was, wenn sich herausstellt, dass die zwei außerirdischen Gefangenen an Bord telepathisch begabt sind und sein Geheimnis längst kennen? Wir fürchten um die Gefangenen, verstehen gleichzeitig die Verzweiflung von Nummer zwei und sogar seinen Entschluss, die Mitwisser zu töten – bis er erkennt, dass er nicht der Einzige ist, der sich wegen seiner sexuellen Orientierung verstecken muss. Manche müssen sogar von ihrem Heimatplaneten fliehen, um sein zu können, wer sie wirklich sind. Genau das ist Sturgeon: Es geht bei ihm immer um alles oder nichts. Er hebelt Erwartungen aus, er überrascht. Er schafft es, dass seine Figuren sich im Anderen, im Fremden selbst erkennen. Seine Texte sind Versuchsanordnungen, und nicht immer geht das Experiment gut aus. Vielleicht, so vermuten manche, war Sturgeon auch mit dieser philosophischen Dimension in seinen Genres ein paar Jahrzehnte zu früh dran und ist deswegen in Vergessenheit geraten?
Ich wäre wohl als Jugendliche nicht auf ihn gestoßen, wenn auf dem Cover einer der wenigen deutschen Ausgaben (danke, Goldmann!) nicht ein „Teenie-Trigger“ geprangt hätte – ein blütenweißes Einhorn. Aus vielen Ein horn lautete der kryptische Titel der Anthologie. Und ja, ein Einhorn kommt in einer der Geschichten tatsächlich vor, das war es dann aber schon mit rosa Märchenfaktor. Doch nach dem ersten Schock war ich mittendrin in Sturgeons Kosmos der Außenseiter. In Doch kein Syzygium litt ich mit Leo, der feststellen muss, dass er nur eine erdachte Figur seiner eigenen Traumfrau ist – die sich leider gerade in einen echten Mann verliebt hat. Ich lernte Eine Denkweise kennen, die mich bis in meine Alpträume verfolgte – und konnte den Mörder doch nicht völlig hassen, denn dazu war er mir in seinem Schmerz zu nahe gekommen. Andere Außenseiter liebte ich auf Anhieb und liebe sie bis heute – darunter das Mädchen mit den weißen Händen aus Sturgeons bekanntester Horrorstory Biancas Hände.
In meinem Autorendasein ist Sturgeon eine Inspiration. Ich liebe seinen poetischen, elegischen Stil und die Tatsache, dass in seinen Geschichten nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Ich bin froh, dass das Einhorn mich einst in seine Welt gelockt hat, weil ich darin mehr über die Zwischen- und Grautöne im Leben erfahren habe, als ich mir mit Regalen voller glatter Teenie-Liebesromane jemals hätte anlesen können. Für mich gehörte Sturgeons Welt zum Erwachsenwerden, war ein Herantasten an die menschliche Psyche. Ein Aufdem-Bauch-robben zum Abgrund, um den ersten Blick nach unten zu wagen. Bis heute hüte ich die angegilbte Anthologie wie Gollum seinen Schatz und lese von Zeit zu Zeit darin, erinnere mich daran, dass es immer mehr als nur eine Sichtweise gibt. „Nothing is always absolutely so.“ Dieser Satz wird als Sturgeons Gesetz zitiert. Für mein Schreiben ist er eine Leitlinie, eine Erinnerung daran, es meinen Figuren, den Lesern und vor allem auch mir als Autorin mit dem Urteil nie zu leicht zu machen.
Manche von Sturgeons Figuren haben mich übrigens bis in mein eigenes Schreiben begleitet. Einige, über die ich als Teenager besonders lange nachgedacht habe, lade ich ab und zu in eines meiner Bücher ein. So ist das Mädchen Bela (die serbische Variante des Namens Bianca) aus meinem historischen Roman Totenbraut eine Verbeugung vor Sturgeons Figur aus Biancas Hände. Auch Bela ist „schwachsinnig“ und hat wunderschöne helle Hände. Aber so wie ich mich damals beim Lesen fragte, wie die Geschichte wohl aus Biancas Perspektive aussehen mochte, lasse ich den Leser in Totenbraut erkunden, wer oder was Bela in Wirklichkeit sein könnte. Denn manche Menschen mögen als „schwachsinnig“ gelten. Aber es gibt immer eine Wahrheit hinter der Wahrheit und vielleicht erzählen ihre schönen weißen Hände eine Geschichte, für die es keine Worte braucht. Nur ein offenes Herz und einen scharfen Blick!
In diesem Sinne: Viel Spaß in Sturgeons Kosmos.
Nina Blazon
Weblinks
Die Website des Theodore Sturgeon Trust
Die offizielle Website von Nina Blazon
„Liebten wir” auf den Seiten der Ullstein Buchverlage
„Totenbraut“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

