In ihrem neuen, in Frankreich für den Prix Goncourt nominierten Roman beschreibt Karine Tuil die privaten und beruflichen Verstrickungen eines Soldaten, einer Journalistin, eines Konzernleiters und eines Politikers. So zeichnet sie ein hochaktuelles Bild der französischen Gesellschaft. Die Lektorin Claudia Puls hat die Autorin in Paris zum Interview getroffen und mit ihr darüber gesprochen, welche Relevanz der Gesellschaftsroman gerade heute hat.

„Die Zeit der Ruhelosen“ ist ein Roman über die Mechanismen von Macht, Diskriminierung und sozialem Wettbewerb. Sehr eindringlich stellt sich in diesem Panorama die Frage nach der Identität, danach, was diese ausmacht. Sind das die Themen unserer Zeit? Welche Rolle spielt die Literatur angesichts der Verwerfungen und Probleme der Gegenwart?
Nach meinem Roman „Die Gierigen“ – einem Roman, der sich mit der Besessenheit von Erfolg auseinandersetzt und damit, wie man mit allen Mitteln, auch mit der Lüge, seinen Platz in unserer ultrakompetitiven Gesellschaft erobert – wollte ich in „Die Zeit der Ruhelosen“ etwas genauer die Bruchstelle schildern, die in unserem zivilisierten, eingeengten Dasein angelegt ist: das plötzliche Aufkommen einer harten Prüfung. Trauer, Liebeskummer, berufliches Scheitern – all meine Figuren sind mit einer besonders schwierigen Situation konfrontiert. Sie müssen in einer Gesellschaft existieren und überleben, die von Identitäts- und sozialen Konflikten, von ökonomischen Krisen und dem Verlust der Unschuld gezeichnet ist, dem uns die Kriege und das neue Gesicht des Terrors aussetzen. In Gesellschaften wie unseren wird man permanent auf seine Ängste, die eigenen Schwächen und inneren Zweifel zurückgeworfen; und der Roman ist der Ort, wo das reflektiert, einer eingehenderen Betrachtung unterzogen wird.
Wird der Gesellschaftsroman wieder wichtig – oder gar notwendig?
In „Notes of a Native Man“ schrieb James Baldwin: „Es gehört zur Rolle des Schriftstellers, wie ich ihn begreife, Geisteshaltungen zu erforschen, in die Tiefe zu gehen, bis hinab zu den Quellen.“ Der Gesellschaftsroman ist nicht wichtiger als früher geworden, er war immer schon wichtig, aber wir erleben gerade heftige und bewegte Zeiten, die uns vor besondere moralische und eben auch schriftstellerische Herausforderungen stellen – ich könnte heute keinen nur persönlichen oder rein fiktionalen Text schreiben. Die Fiktion hilft mir, die Realität zu begreifen, und ich arbeite zunehmend dokumentarisch, meine Stoffe nähren sich von tatsächlichen Gegebenheiten. Allerdings läuft diese Konfrontation mit der Realität nicht ohne Reibungsverluste ab.
In „Die Wahrheit der Lügen“ sagt Mario Vargas Llosa, „im Herzen jeder Fiktion glüht ein Protest“. Und genau das ist mein neuer Roman: Ein Protest gegen die Welt, in der wir leben und in der jede Bewegung vom Ende der Unschuld zu künden scheint.
Wie kann ein Gesellschaftsroman in formaler, stilistischer Hinsicht die Komplexität der Gegenwart einfangen?
Zunächst wollte ich einen Roman schreiben, der das moralische und mentale Leid eines Soldaten in den Mittelpunkt rückt. Ich habe also nach sprachlichen Mitteln gesucht, mit denen sich die Gewalt eines Krieges vermitteln lässt. Diese Passagen sind in einem unruhigen, abgehackten Stil geschrieben, dem eine gewisse Brutalität anhaftet. Dort, wo es im Roman um Rassismus geht, habe ich eine Sprache gewählt, die direkter ist und in der unglaubliche Wut mitschwingt. An diesen Stellen habe ich mich am Rhythmus des Rap orientiert. Aber es gibt auch längere Erzählstrecken mit kurzen, elliptischen Sätzen, in denen von Trauer und harten Prüfungen die Rede ist. In solchen Momenten schmerzt jede Regung, und diese Starre, diese Anspannung wollte ich auch sprachlich greifbar machen.
Inspiriert sich der Roman an einer persönlichen Erfahrung oder einem konkreten Ereignis? Was war das auslösende Moment, „Die Zeit der Ruhelosen“ zu schreiben?
Im Sommer 2008 gerieten einige französische Soldaten im Uzbin-Tal in einen Hinterhalt der Taliban und kamen dabei ums Leben. Dieser Zwischenfall hat mich damals sehr beschäftigt. Die Franzosen machten gerade alle Urlaub, während in Afghanistan, im Namen des Kampfes gegen den islamischen Terrorismus, junge Männer um die zwanzig an der Front ihr Leben ließen.
Mein Roman ist aber auch das Resultat von Fragen, die ich an mich selbst gestellt habe: Wie kann man sich in einer Gesellschaft verwirklichen, die so verdorben ist durch identitäre Streitereien und Rassismus? Ist es möglich, wenn man einmal am Abgrund stand, sich in einer Welt, in der sich jeder mit jedem Tag verwundbarer fühlt, ein neues Leben aufzubauen?
Außerdem wollte ich eine Liebesgeschichte schreiben, die sich in einem schwierigen politischen Kontext entwickelt. Liebe, Sexualität und Begehren sind die letzten Freiräume in einer Gesellschaft, die alles kontrollieren will, die der Gefahr der totalen Überwachung und Gewalt ausgesetzt ist.
Sartre schrieb einmal: „Worte sind geladene Pistolen“ – was bedeutet das Schreiben für dich, welche Aufgabe hat Literatur in deinen Augen?
In „Die Zeit der Ruhelosen“ gibt es eine Passage, in der eine der Hauptfiguren, die Journalistin und Schriftstellerin Marion Decker, sagt, dass sie schreibe, weil das Leben nicht zu verstehen ist. Die Literatur erlaubt mir, die Komplexität der Welt zu beschreiben. Ich mag breit angelegte Romane, in denen die verschiedensten Figuren agieren und deren Handlung an unterschiedlichen Orten dieser Welt spielt. Die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind international. Literatur zeigt immer den Konflikt und die Zuspitzung des Konfliktes auf, so hat es der Schriftsteller Philippe Muray formuliert, und ich könnte es nicht besser ausdrücken. Es gibt einige Autoren, deren Werke mich für mein eigenes Schreiben inspirieren. Um nur die wichtigsten zu nennen: Albert Camus, Philip Roth, Wassili Grossman, Kafka, aber auch Joan Didion, Susan Sontag, James Baldwin und Aimé Cesaire.
Was treibt die Figuren in ihrem Inneren an? Oder sind sie vom Schicksal Getriebene?
Ehrgeiz spielt in all meinen Roman eine wichtige Rolle. Ich finde es faszinierend, Figuren unter die Lupe zu nehmen, die hungrig nach Macht sind, und zu zeigen, wie Clan-Strukturen funktionieren, wie soziale Konflikte ablaufen, welche Hindernisse manche Menschen aufgrund ihrer Herkunft überwinden müssen. Genauso interessiert mich die Frage nach Determinismus und Zufall. Vieles im Leben ist durch glückliche Umstände bestimmt.
Es geht in deinem Roman auch um die psychischen Folgen des Kriegs. Wie bist du bei der Recherche vorgegangen?
Ich habe viele Zeugenberichte gelesen und Reportagen gesehen, etwa „Let there be light“ von John Huston oder „Of men and war“ von Laurent Bécue-Renard. Ich habe außerdem mit Soldaten gesprochen, die verletzt heimgekehrt sind, mit Psychiatern, Medizinern und Militärs. Das waren Begegnungen, die mich menschlich sehr geprägt haben.
Das Buch
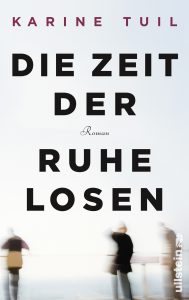 Als Romain Roller von seinem Einsatz aus Afghanistan zurückkehrt, ist er innerlich gebrochen. In einem Luxus-SPA-Hotel auf Zypern, wo man die Soldaten zur mentalen Erholung unterbringt, beginnt er eine Affäre mit der Journalistin Marion Decker, die ihm Momente des Vergessens schenkt. Auch Osman Diboula befindet sich auf Zypern, Romain kennt ihn aus seiner Jugend in Clichy-sous-Bois. Osman stand nach den Unruhen in der Pariser Banlieue im Rampenlicht und hat inzwischen Karriere in der Politik gemacht. Die Rückkehr nach Frankreich bedeutet für alle eine schwere Prüfung. Osman wird Opfer rassistischer Ressentiments im Élysée, Romain fühlt sich seiner Familie entfremdet, und während in ihm der Krieg weiter wütet, sucht er Halt bei Marion. Doch dann erfährt er, dass sie mit einem der mächtigsten Männer des Landes verheiratet ist: mit François Vély, Chef eines großen Konzerns und Sohn eines jüdischen Widerstandskämpfers. Es kommt zu einer Begegnung aller Beteiligten – mit fatalen Konsequenzen.
Als Romain Roller von seinem Einsatz aus Afghanistan zurückkehrt, ist er innerlich gebrochen. In einem Luxus-SPA-Hotel auf Zypern, wo man die Soldaten zur mentalen Erholung unterbringt, beginnt er eine Affäre mit der Journalistin Marion Decker, die ihm Momente des Vergessens schenkt. Auch Osman Diboula befindet sich auf Zypern, Romain kennt ihn aus seiner Jugend in Clichy-sous-Bois. Osman stand nach den Unruhen in der Pariser Banlieue im Rampenlicht und hat inzwischen Karriere in der Politik gemacht. Die Rückkehr nach Frankreich bedeutet für alle eine schwere Prüfung. Osman wird Opfer rassistischer Ressentiments im Élysée, Romain fühlt sich seiner Familie entfremdet, und während in ihm der Krieg weiter wütet, sucht er Halt bei Marion. Doch dann erfährt er, dass sie mit einem der mächtigsten Männer des Landes verheiratet ist: mit François Vély, Chef eines großen Konzerns und Sohn eines jüdischen Widerstandskämpfers. Es kommt zu einer Begegnung aller Beteiligten – mit fatalen Konsequenzen.
Links
„Die Zeit der Ruhelosen“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage


[…] http://www.resonanzboden.com/satzbaustelle/interview-karine-tuil-fiktion-realitaet/ […]