Katja Kettu ist eine der wichtigsten literarischen Stimmen Finnlands. Anlässlich eines längeren Aufenthalts in Berlin hat sie uns im Verlag besucht. Mit Marie Krutmann spricht sie über die enge Verbindung von Sprache und Identität und über die bis heute überlieferten Traditionen finno-ugrischer Volksgruppen wie die der Mari, die eine zentrale Rolle in ihrem neuen, gerade erschienenen Roman „Feuerherz“ spielen.
 Foto: Juliane Junghans
Foto: Juliane Junghans
In deinem Roman „Feuerherz“ geht es um die Geschichte zweier Frauen – Irga und Verna – die zum einen in den 1940er Jahren und zum anderen in der heutigen Zeit, im Jahr 2015, spielt. Beim Lesen ist mir aufgefallen, dass du dich vor allem mit den Themen Macht und Identität beschäftigst und dabei vom großen Ganzen ausgehend immer tiefer ins Detail gehst. Wie bei einer Matroschka, die in ihrem Inneren immer wieder eine kleinere Version von sich enthüllt. Hattest du diese Struktur schon im Kopf, als du mit dem Schreiben begonnen hast?
Bevor ich mit einem neuen Roman anfange, beginne ich als erstes damit, auf ungefähr fünfzig Seiten die Struktur der Geschichte zu entwerfen, ohne zu sehr auf Details und Sprache zu achten. Um diese zu visualisieren, habe ich eine besondere Technik: Ich nehme große Stücke Backpapier, schreibe den Ablauf der Ereignisse und die Entwicklung jeder Figur darauf und hänge sie zusammen an die Wand. So kann ich sehen, welcher Teil der Ereignisse auf den anderen folgt.
Dann habe ich zum Beispiel den Ablauf von Irgas Geschichte und den Ablauf von Alekseij Ignatenkos Geschichte und wenn ich sie nebeneinander lege, sehe ich, wie die beiden sich innerhalb des Romans entwickeln. Aber ich sehe auch den Punkt, an dem eine Figur sich nicht mehr weiter entwickelt. Als Irga ihre Freundin Elna tötet, um aus dem Gefangenenlager zu entkommen, hofft sie, endlich frei zu sein und ihr Leben mit Aleksej fortsetzen zu können, aber das wird nicht geschehen, denn durch die Schuld, mit der sie leben muss, wird sie in ihrer Persönlichkeit nicht mehr weiter wachsen. Sie wird für den Rest ihres Lebens die Rolle einer anderen spielen.
Mir gefällt Dein Bild der Matroschka, denn es zeigt ganz gut, wie alles miteinander verwoben ist. Ich bin immer neugierig darauf, wie kleine Dinge und besonders die kleinen Leute das Gesamtbild beeinflussen können.
Du sagst, dass Irga sich nicht mehr weiterentwickelt, da es für sie kein Leben in Freiheit gibt. Lange Zeit lebt sie als Gefangene im Lager, doch selbst als sie dem entkommt, kann sie nicht in ihr altes Leben und ihre finnische Heimat zurückkehren. Ihre Enkelin Verna dagegen reist extra von Finnland ins russische Mari-Land, um mehr über ihre Familie zu erfahren. Ist Verna in deinen Augen frei?
Im Vergleich zu Irga ist Verna eindeutig freier, denn sie kann reisen und ihr Leben nach ihren Vorstellungen leben. Aber dennoch ist sie nicht ganz frei. Ihr Gefängnis besteht nicht darin, von der Welt da draußen ausgeschlossen zu sein. Es besteht in der Tatsache, dass sie ihre Vergangenheit und die Geschichte ihres Vaters und ihrer Großmutter nicht kennt. Als sie nach Mari-Land reist, um mehr herauszufinden, wollen die Menschen dort nicht mit ihr sprechen und beziehen sie nicht mit in ihr Leben ein. Sie ist wurzellos – und in gewisser Weise auch im Geiste – verloren.
Ich kenne dieses Gefühl, weil ich mich selbst wurzellos fühlte, bevor ich begann, mich mit der Geschichte meiner Großeltern zu beschäftigen und mehr über die finnische Geschichte und die Geschichte Europas und der Welt lernte, und wie darin alle miteinander verbunden sind. Dieses Wissen gab mir das Gefühl, Teil der Menschheit zu sein – im Guten wie im Schlechten.
Würdest du demnach sagen, dass es für die eigene Identitätsentwicklung notwendig ist, seine Wurzeln und die Geschichte seiner Vorfahren und Verwandten zu kennen?
Ich glaube, für einige Menschen ist es so. Für mich ist es ganz sicher so. Man kann sein Leben sowohl horizontal als auch vertikal leben – und beides kann gut funktionieren. Aber für mich war es sehr wichtig, mehr über die Vergangenheit zu wissen. In meiner Kindheit gab es viele Geheimnisse in der Familie, daher habe ich oft nicht verstanden, warum manche Dinge um mich herum geschahen. Es fühlte sich an wie ein Puzzle, bei dem man mir nur ein paar Teile gegeben hatte und von dem ich nie das ganze Bild sehen konnte. Also machte ich mich auf die Suchen nach den fehlenden Teilen – und habe die Suche mein ganzes Leben lang nicht aufgegeben. Nicht nur, was meine eigene Familie angeht – ich interessiere mich bei allen Menschen dafür, was geschah, wo es geschah und warum es geschah. Warum vergessen wir so schnell und wiederholen unsere Fehler?
Du meinst also, wir sollten über die Vergangenheit Bescheid wissen, damit wir nicht die Fehler anderer Generationen wiederholen?
Ja, auch das. In meiner Familie gibt es eine düstere Geschichte: Meine beiden Großväter sind am selben Tag geboren, wie ich – dem 10. April. Einer der beiden kam ganz gut durch den zweiten Weltkrieg und ich erinnere mich an ihn als den freundlichen Opa, der seine Enkelkinder alle in seinem Haus willkommen hieß. Dagegen war mein anderer Großvater kein besonders heldenhafter Mensch, würde ich sagen. Während des Krieges versuchte er der Front zu entkommen, was als Schande gilt.
Aber es stellte sich heraus, dass dies eine kluge Entscheidung war, denn alle in seiner Kompanie kamen um – und er überlebte. Aber er litt sehr unter einem posttraumatischen Stresssyndrom, wurde gewalttätig und war alkoholkrank – und irgendwann beging er Selbstmord. Ich glaube, diese beiden Seiten meiner Familie leben in mir weiter. Und ich versuche immer, den Mittelweg zwischen beiden Seiten zu finden. Das meine ich, wenn ich sage, dass die Vergangenheit uns immer beeinflusst.
 Foto: Juliane Junghans
Foto: Juliane Junghans
Das Dorf Lawra in Mari-Land wird zum Zentrum deines Romans, da dort die beiden Generationen von Irga und Verna aufeinandertreffen. Was ist das Besondere am Volk der Mari?
Das Volk der Mari ist faszinierend, weil sie die letzten Heiden Europas sind. Ich habe sie in ihrem Dorf besucht und sie üben immer noch ihre alte Religion aus. Ich habe mich gefragt, wie sie sie so lange am Leben erhalten konnten – während sie zwischen Menschen mit orthodoxem Glauben und mit Muslimen zusammenlebten, in der Sowjetunion und unter den Kommunisten. Sie praktizieren ihren Glauben nicht sehr offen, aber dennoch! Die alte finno-ugrische Religion ist dem früheren Glauben in Finnland außerdem sehr ähnlich. Wir hatten ebenfalls heilige Bäume und glaubten auch an heilige Welten. In meiner Kindheit nannte man die Eberesche und ihre Beeren heilig, aber wirklich daran glauben tut in unserer Zeit niemand mehr. Uns ist es nicht gelungen, die alte Naturreligion über Jahrhunderte am Leben zu halten.
Ein anderer Aspekt der Mari-Kultur, den ich besonders interessant finde, ist, dass ihr Dorf der Überlieferung nach der Geburtsort aller finno-ugrischen Völker sein sein soll. Dieser Gedanke kommt aus der nationalromantischen Zeit, daher bin ich mir nicht sicher, ob das wahr ist, aber uns wurde gesagt, dass das Mari-Land die Wiege unserer Kultur war – bevor die Ungarn, die Esten und die Finnen ihre eigenen Gemeinschaften gründeten. Heute ist Finnland ein Teil von Europa, wo wir die vielen unterschiedlichen Sprachen und kleineren Gruppen wie das Finnische, oder das Norwegische, oder die baltischen Sprachen respektieren. Diese kleineren Gruppen können in Europa überleben. Aber wenn man in Russland lebt, gibt es viel Druck und Diskriminierung dieser kleinen Kulturen und Sprachgruppen.
Ich wollte also auf irgendeine Weise feststellen, was passiert wäre, wenn wir unter dem russischen Einfluss geblieben wären. Es ist eine Art Gedankenexperiment. Ich wollte Europa und Finnland auf der einen Seite und diese kleinen Orte mitten in Russland miteinander vergleichen.
Mir kam es beim Lesen außerdem so vor, als ob es um einen Konflikt zwischen den Generationen geht, da die ältere Generation an ihrer Religion und den Traditionen festhält, während die jüngere Generation sich wegen ihrer Mari-Identität schämt und sie in der Öffentlichkeit verheimlicht.
Ja, dieser Konflikt hat mich sehr beeindruckt, als ich nach Mari-Land reiste. Die jungen Leute schämen sich, sie wollen Russen sein oder lieber Englisch sprechen. Wenn man in einer Stadt die U-Bahn nimmt, hört man nie die Mari-Sprache, weil sie als Sprache der „Dummen Leute“ betrachtet wird und niemand sie in der Öffentlichkeit spricht. Sogar gebildete Menschen, die ich in Estland und Finnland kennenlernte, und die ursprünglich aus Mari-Land stammen, sagten mir, sie wollten mit ihren eigenen Kindern nicht Mari sprechen weil sie Angst hätten, dass diese dann gehänselt würden.
Du dagegen verwendest in deinem Roman bewusst Elemente aus der Mari-Sprache und dem Russischen. Was war die Idee hinter diesem Mix aus Sprachen und Dialekten?
Mein Interesse galt schon immer den Sprachen und ich kombiniere sie auch gern. Sprachen sind außerdem Ausdruck der Identität. Wenn ich Figuren Wörter aus anderen Sprachen benutzen lasse, will ich beschreiben, wie sie sprechen, aber auch wer sie sind, wenn sie die russische oder die Mari-Sprache verwenden. In meinem Roman spricht die alte Frau Elna die junge Verna mit einem russischen Namen an, bis sie beginnt, sie zu akzeptieren. Von diesem Moment an verwendet sie einen Mari-Namen für sie.
 Foto: Juliane Junghans
Foto: Juliane Junghans
Anhand der Sprache lassen sich also die Beziehungen der Charaktere untereinander ablesen. Verändert sich mit der jeweiligen Sprache auch gleich die gesamte Persönlichkeit?
Ja, die Persönlichkeit verändert sich enorm. Wir denken mehr oder weniger durch unsere Sprache. Daher kann man eine riesige Veränderung im Denken beobachten, wenn man eine andere Sprache verwendet. Im Finnischen haben wir beispielsweise so viele Formen, um Elemente wie Wasser oder Schnee zu beschreiben. Es gibt ein Wort, das einem sagt, ob man auf einem gefrorenen See laufen kann und ein anderes, das beschreibt, wie tief der Schnee ist. Aber wenn man Engländer trifft, die Lappland besuchen, zeigen sie auf den Schnee und sagen „Schnee“.
Die Mari-Sprache hat noch eine weitere Besonderheit, denn sie beinhaltet die gesamte Weltsicht der Mari. In ihrer Religion lebt alles und hat eine Seele. Das trifft auch auf andere alte finno-ugrische Sprachen zu, aber besonders die kleinen Sprachen sterben langsam aus, wodurch sich auch die Weltsicht dieser ethnischen Gruppen verändert.
Ein sehr starkes Bild in deinem Roman ist die Szene, in der Irga zur Strafe die Zunge abgeschnitten wird, da sie das Kind eines russischen Agitators erwartet. Auf diese Weise wird sie aus der Gesellschaft verstoßen. Handelt es sich hierbei um ein Sinnbild für den Verlust der Muttersprache?
Ja. Irga verliert ihre Zunge, aber zum Glück trifft sie Elna, die bereit ist, ihr wieder eine Stimme und ihre eigene Sprache zu geben. Dieser Akt begründet auch ihre Freundschaft und diese entwickelt sich später zu einer Art Schwesternschaft. So kommt Irga zu einer neuen Familie und beginnt endlich auch eine neue Sprache zu lernen. Ich wollte also auf eine sehr gewalttätige und auch körperliche Art zeigen, was mit einem geschieht, wenn man keine Sprache mehr hat, da man sich ohne Sprache nicht schützen kann. Eine Sprache zu sprechen, macht uns menschlich – ohne sie sind wir verloren und einsam.
In meiner Kindheit hörte ich die Geschichte einer Frau, die der einzige Mensch war, der noch ihre eigene Sprache sprach. Ich dachte ständig über sie nach: Wie einsam musst Du sein? Niemand, wirklich niemand versteht Dich!
War es auch ein solches Erlebnis, das dich damals dazu inspirierte, Wörter zu sammeln und mit dem Schreiben zu beginnen?
Als ich klein war, wohnten wir etwas außerhalb des Ortes, deshalb war ich manchmal etwas einsam. Aber ich hatte Fantasie. Ich spielte viel mit meinen Hunden im Wald und begann Steine zu sammeln. Gleichzeitig habe ich auch viel gelesen und so sammelte ich irgendwann nicht mehr Steine, sondern Worte. Ich war vermutlich etwas seltsam (lacht), aber ich mache es heute noch, weil ich gern mit Worten spiele. Ich vergesse oft, das zu sagen, aber es macht mir wirklich Spaß. Wahrscheinlich ist das meine Art, nicht zu erwachsen zu sein. So kann ich kleine Abenteuer und Geschichten erschaffen. Das verschafft mir große Befriedigung.
Das Interview führte Marie Krutmann
Das Buch 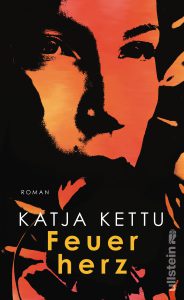
Lappland um 1930. Irga, die Tochter des Weißen Generals, flieht durch die eisige Winternacht auf Skiern bis nach Russland. Seit sie sich mit einem Kommunisten eingelassen hat, schwebt sie in Lebensgefahr. Sie ist schwanger und flüchtet zu ihrem Geliebten. Ihr Weg führt sie weit in den Nordosten, bis hin zu den schrecklichen Vorkuta-Gulags, zur Wolga und schließlich nach Kazan, zum Volk der Mari. Mit sich trägt sie ein Geheimnis, das ihr wichtiger ist als ihr eigenes Leben.
Russland, 2015. Die Finnin Verna sucht nach ihrem lange vermissten Vater, doch sie kommt zu spät: Er ist tot. Verna versucht herauszufinden, was ihm zugestoßen ist. In einem kleinen Mari-Dorf trifft sie eine alte Frau, die ihr hilft, aber gleichzeitig etwas vor ihr zu verbergen scheint. Zwei starke Frauen und ein Volk, das sich gegen alle Widerstände zu behaupten versucht.
Links
„Feuerherz“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage
Katja Kettu auf Twitter und bei Facebook

