Der New-York-Times-Bestseller „H wie Habicht” erscheint nun auch auf Deutsch. Die Übersetzerin des Buches, Ulrike Kretschmer, hat für uns über ihre Arbeit an Helen Macdonalds Text berichtet – von ihrer Faszination für das Thema Falknerei, über das Aneignen des Fachvokabulars bis hin zu eigenen praktischen Erfahrungen mit echten Greifvögeln und den Umgang mit den schwierigeren Themen des Buches.
von Ulrike Kretschmer
Die Gedanken und Gefühle, die ein fremder Mensch in seiner eigenen Sprache festgehalten hat, in eine andere Sprache zu übertragen, ist immer eine besondere Erfahrung. Je nach Tiefe des Textes taucht man dabei nicht nur in die Gehirnwindungen, sondern auch in das Herz des anderen ein.
Bei Helen Macdonalds H wie Habicht aber war es eine ganz besondere Erfahrung, denn Helens Sprache ist eine ganz eigene Sprache: klar, sachlich, nüchtern, präzise – ein Geschenk für jeden Übersetzer! –, manchmal geradezu lakonisch; und am anderen Ende der Skala lyrisch und poetisch, insbesondere in den Naturbeschreibungen. Und sowohl im Lakonischen als auch im Poetischen begibt sich der Übersetzer unweigerlich auf unsicheres Terrain. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mich an der einen oder anderen Stelle auf meine Intuition zu verlassen, mich fallen und von Helens Sprache tragen zu lassen. Und sie trug!
Trauer, Greifvögel und literarische Biografie
Einfach war das nicht immer. In einem Interview danach gefragt, worum es in ihrem Buch geht, antwortete Helen: um Trauer, Greifvögel und etwas literarische Biografie. Mit Letzterem meinte sie T.H. White, einen in England recht bekannten Schriftsteller, der vor allem mit seiner Version der Artussage, Der König auf Camelot, berühmt geworden ist. Sein Buch The Goshawk kennt kaum jemand; auch darin geht es um das Abrichten, das Abtragen, eines Habichts, das Helen neben ihre eigenen Erfahrungen mit Mabel stellt. War ich zunächst noch ungeduldig, mich mit White aufhalten zu müssen, wollte ich doch endlich den Habicht kennenlernen, war mir nach der Übersetzung vollkommen klar, was Helen jenseits der gemeinsamen Liebe zu Greifvögeln an dieser ungewöhnlichen Persönlichkeit so fesselte.
Ich glaube, es war vor allem die Einsamkeit, die Helen in ihrer Zeit der Trauer mit White verband. Der homosexuelle, zum Sadismus neigende Lehrer an einer Jungsschule im England der 1930er-Jahre, der all seine uneingestandenen Wünsche, Sehnsüchte und Begierden auf Landschaften und Tiere verlagerte – etwas Einsameres kann ich mir kaum vorstellen.

Habichtterzel Tarek mit Falkner Matthias Bartek und Übersetzerin Ulrike Kretschmer (Foto: © Tom Stechl, 2015)
Faszination Falknerei
Ich habe zugegebenermaßen noch nicht versucht, mit hinter dem Rücken verschränkten Armen – wie Schwingen – zu schlafen, doch bin ich schon lange von Greifvögeln fasziniert, ebenso wie von der Falknerei. Wann immer ich die Gelegenheit habe, besuche ich falknerische Vorführungen mit Greifvögeln, bei denen man auch als Laie den Tieren so nah sein kann, wie das sonst nicht möglich ist. Wobei ich es ebenso genieße, über abgelegene Felder, über Wiesen und an Waldrändern entlang zu streifen, über mir den Ruf eines Mäusebussards zu hören und seine eleganten Flugbahnen am Himmel zu beobachten.
Allerdings macht Faszination noch keinen Experten, und den brauchte ich, nicht nur für das falknerische Grundwissen überhaupt, sondern speziell auch für das Fachvokabular. Langfessel, Kurzfessel, Lockschnur, Geschüh, Bells – all das übt auf mich den gleichen unwiderstehlichen Zauber aus, von dem Helen in ihrem Buch schreibt. Eine wunderschöne, melodische, rätselhafte Geheimsprache, wie Zitronensafttinte nur für Eingeweihte lesbar.
Wenn ich eines an der Uni gelernt habe, dann das: mich möglichst zweckdienlich in die unterschiedlichsten Sachgebiete einzuarbeiten. (Nicht böse sein, Uni, das hat mir in meinem Berufsleben tatsächlich schon oft weitergeholfen!) Dankenswerterweise ist mir dabei die Hybris erspart geblieben zu glauben, ich würde wirklich etwas von den jeweiligen Sachgebieten verstehen, und so scheue ich mich auch nie, den Rat von Experten zu suchen.
Diesen Experten fand ich zum Glück in Matthias Bartek, der als Tierpfleger im Münchner Tierpark Hellabrunn arbeitet und mit Leib und Seele Falkner ist. Er hat selbst schon einen Habicht abgetragen und sich in Helens Buch mehr als einmal wiedererkannt. Im Tierpark hatte ich Gelegenheit, mir die Vögel aus nächster Nähe anzusehen. Einen Habicht hat Hellabrunn zwar nicht, dafür aber zwei wunderschöne Sakerfalken und einen Harris Hawk; beide Arten werden auch für die Beizjagd verwendet. Ich erfuhr, wie eine Beizjagd überhaupt abläuft, was eine „freie Folge” und die „Anwartefalknerei” ist, und ließ mir vom unermüdlichen Matthias alle erdenklichen Einzelheiten der Greifvogelanatomie und -physiognomie sowie der Falknerausrüstung und des Beizvogelgeschirrs erklären. Für seine Geduld und fachmännische Korrektur möchte ich ihm an dieser Stelle noch einmal besonders herzlich danken. Bei diesem ersten Eintauchen in die Kunst der Falknerei ist mir allerdings auch bewusst geworden, wie viel mehr es dort noch zu entdecken gibt, und so hat mich die Beschäftigung mit der Theorie mit dem Hunger nach praktischen Erfahrungen zurückgelassen.
Mit den Augen des Habichts
Das Thema Falknerei rannte bei mir also gewissermaßen offene Türen ein. Weitaus schwieriger für mich war die Auseinandersetzung mit dem Thema Trauer, die – wie Helen selbst schreibt – beinahe jeder auf die eine oder andere Weise schon einmal erlebt hat und die dennoch unteilbar ist. Aber mitteilbar, das ist sie, wie Helen ebenfalls beweist. An diesen Stellen im Buch habe wiederum ich mich mehr als einmal wiedererkannt. „Eine Reise in die Unterwelt und zurück, mit einem Habicht als spirituellem Führer” – auch so wurde Helens Buch schon beschrieben, und dem kann ich mich als Übersetzerin durchaus anschließen. „Ich denke, das eigentliche Thema ist, wie man das Leben meistern kann”, so Helen, trotz der Tatsache des Todes.
Die Übersetzung von H wie Habicht war aber auch deshalb eine ganz besondere Erfahrung für mich, weil das Buch in mir etwas verändert hat. Helen sagte, sie habe die Landschaft, in der sie Mabel flog, mit ihren Augen sehen gelernt. Auch ich habe Dinge anders sehen gelernt; vielleicht nicht unbedingt mit den Augen eines Greifvogels, aber sicherlich ein wenig mit Helens Augen. Zu diesen Dingen gehören zum einen Helens Überlegungen zu unserem Verhältnis zu „wilden” Tieren – warum sind so viele Menschen so fasziniert von Greifvögeln? Weil wir sie nie domestiziert haben? Weil sie ein Stück Wildnis sind, an dem wir teilhaben können? Weil sie als Symbol für das Unzähmbare in uns selbst stehen? Zum anderen gehören zu diesen Dingen Helens Gedanken zu eben jener Wildnis, zur Ursprünglichkeit der Natur und zur Landschaft, die uns umgibt.
Die Landschaft, in der ich zur Zeit der Übersetzung viel spazieren ging – die keineswegs spektakulären Hügel im französischen Lothringen, die besagten Felder, Wiesen und Wälder, die mir trotz ihrer „Normalität” ungeheuer ans Herz gewachsen sind –, ähnelte plötzlich dem englischen Cambridgeshire und vermittelte auch mir das tröstliche Gefühl, dass die Wildnis nicht immer etwas von Menschen Unberührtes und damit letztlich etwas Unzerstörbares ist.
Postskriptum
Der Hunger nach praktischen Erfahrungen … Ebenfalls Matthias habe ich es zu verdanken, dass ich eine dieser praktischen Erfahrungen recht bald nach Abschluss der Arbeit am Buch machen durfte. Wir fuhren nach Heufeld in der Nähe von Rosenheim zu Tom Stechl, einem mit Matthias befreundeten Falkner und Fotograf – und zu Tarek, dem fünfjährigen Habichtterzel im Alterskleid, mit dem Tom regelmäßig auf die Krähenbeize geht. Ich zog zum ersten Mal in meinem Leben einen Falknerhandschuh an, bekam die Finger in die richtige Position gebogen und dann den Habicht auf die Faust. Da stand er nun, dieser wunderschöne Vogel, mit den zitronengelben Zehen, der schwarz-weiß quergebänderten Brust und den hellorangefarbenen Augen – völlig ruhig und unglaublich eindrucksvoll. So etwa muss sich Helen mit ihrem ersten Turmfalken gefühlt haben. Wirklich beschreiben, was mir dabei durch Kopf und Herz ging, kann ich nicht. Das wird genügen müssen: Respekt vor diesem fremdartigen Lebewesen; Neugier, wie ein solches Lebewesen uns Menschen wohl wahrnimmt; Freude, dass es so etwas Schönes auf der Welt gibt; Dankbarkeit, dass wir von Zeit zu Zeit an dieser Schönheit teilhaben dürfen; das Gefühl der Verantwortung, diese Schönheit zu erhalten. Nicht nur eine praktische, eine bewegende, berührende Erfahrung, der, wenn ich Glück habe, ähnliche Erfahrungen folgen werden.
→ mehr über „H wie Habicht”
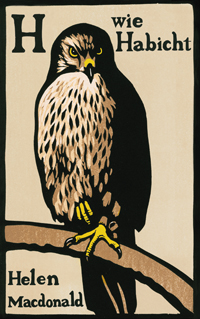 Schon als Kind beschloss Helen Macdonald, Falknerin zu werden. Sie eignete sich das komplizierte Fachvokabular an, mit dem sich die Falkner wie in einer Geheimsprache untereinander verständigen, und las die Klassiker der Falknereiliteratur. Ihr Vater unterstützte sie in dieser ungewöhnlichen
Schon als Kind beschloss Helen Macdonald, Falknerin zu werden. Sie eignete sich das komplizierte Fachvokabular an, mit dem sich die Falkner wie in einer Geheimsprache untereinander verständigen, und las die Klassiker der Falknereiliteratur. Ihr Vater unterstützte sie in dieser ungewöhnlichen
Leidenschaft, er lehrte sie Geduld und Selbstvertrauen und blieb eine wichtige Bezugsperson in ihrem Leben. Als ihr Vater stirbt, setzt sich ein Gedanke in Helens Kopf fest: Sie muss ihren eigenen Habicht abrichten. Sie ersteht einen der beeindruckenden Vögel, ein Habichtweibchen, das sie auf den Namen Mabel tauft, und begibt sich auf die abenteuerliche Reise, das wildeste aller wilden Tiere zu zähmen.
Weblinks
„H wie Habicht” auf dein Seiten der Ullstein Buchverlage
Helen Macdonald auf Twitter

