„Es ist kompliziert“ sagt Ullstein-Autor Idan Ben-Barak, der uns hier erklärt, wie das menschliche Immunsystem funktioniert. Wie muss ein System aussehen, dass den Menschen vor Gefahren von Außen schützt? Die Tour durch unser Immunsystem schildert Ben Barak aus der Sicht eines Bazillus, der in den Körper eindringen will. Nicht nur kompliziert, sondern auch witzig.
von Idan Ben-Barak

Am Anfang schien alles ganz einfach zu sein. In der Antike kamen die Krankheiten von den Göttern, manchmal auch von Gott oder – wenn man zu der rationalen, nüchternen, modernen, klinisch orientierten, evidenzbasierten Sorte Mensch und/oder Gesellschaft gehörte – von einer Ungleichverteilung der vier Säfte des Körpers.[1] Die Vier-Säfte-Lehre ergab Sinn. Sie war praktisch und praktikabel. Sie ließ sich zur Behandlung anwenden. Und sie war in jeder Hinsicht falsch.
Wie Ihnen sicher aufgefallen sein dürfte, wurden in der Zwischenzeit einige Fortschritte gemacht. Über deren Entwicklung werden Sie an späterer Stelle mehr erfahren, aber für den Augenblick reicht es festzuhalten, dass die Menschheit mittlerweile wenigstens über ein gewisses Verständnis von den Mechanismen und Ursachen der Krankheiten verfügt – und wie sich herausgestellt hat, ist die Sache keineswegs ganz einfach. Wenn ein Wissenschaftler von anno dazumal ein modernes medizinisches Lehrbuch in die Finger bekommen hätte, wäre er aller Wahrscheinlichkeit nach völlig fassungslos darüber gewesen, wie lächerlich und erstaunlich kompliziert Gesundheit und Krankheit heute aufgefasst werden. An die Stelle von Dämonen, göttlichem Willen oder einem Überschuss an Gallenflüssigkeit ist die wunderbare Welt der Bakterien und Viren, der Toxine und freien Radikale, der Leukozyten, Antigene und Antikörper, der Zytokine und Chemokine, der MHC-Moleküle und V(D)J-Rekombination und hypervariablen Antigen-Bindung und regulatorischen T-Zellen und und und getreten. Wessen Kopf würde das alles nicht zum Qualmen bringen?
Erschwerend kommt hinzu, dass Krankheiten genetisch bedingt oder ansteckend oder auch das Ergebnis körpereigener Funktionen sein können, die auf die eine oder andere Weise beschädigt sind. Die meisten Krankheiten gehen auf eine Kombination der oben genannten Faktoren zurück. Beispielsweise kann man sich nicht bei anderen Menschen mit Krebs anstecken – mit Ausnahme der Arten, bei denen das eben doch geht. Oder: Durch den Stich der Malariamücke infiziert man sich – es sei denn, man ist dank einer bestimmten Abweichung in der eigenen DNA auf natürliche Weise dagegen immun. Und so weiter. Je mehr wir herausfinden, desto weniger klar definiert scheint die ganze Sache zu sein.
Und warum, würde sich unser hypothetischer Gelehrter der Antike bei der Lektüre der Erläuterungen in einem modernen Lehrbuch fragen, sollte die Natur auf derart merkwürdige Weise funktionieren, dass es eine menschliche Krankheit gibt, die von einem unsichtbaren Organismus verursacht wird, der auf seinem Weg von einem Mensch zum anderen einen weiteren Organismus – in einigen Fällen sogar zwei weitere Organismen – durchquert? Welchen Sinn hat das alles?
„Nichts in der Biologie ergibt Sinn, außer im Lichte der Evolution“, schrieb Theodosius Dobzhansky in einem berühmten Essay. Charles Darwin[2] hat uns die Grundlage für die einzige befriedigende Antwort geliefert, die wir für die überwältigende Komplexität der natürlichen Welt haben. Immunologen haben die Darwinsche Sichtweise also auf ihr Gebiet übertragen, um zu verstehen, warum das Immunsystem so aussieht und arbeitet, wie es das tut.
Lassen Sie uns hier einen Augenblick innehalten.
 In der Zwischenzeit habe ich nämlich ein Problem. Es handelt sich um ein Problem, das ich mit jedem Autor teile, der unmissverständlich begreiflich machen möchte, dass etwas kompliziert ist. Einfach zu sagen, „es ist kompliziert“, vermittelt nicht nur nichts von der Faszination, sondern klingt auch irgendwie wohlfeil. Andererseits ist dieses Buch dazu gedacht, von Ihnen gelesen werden – dem wissbegierigen Laien oder Schüler. Es ist kein Lehrbuch. Während also die erschöpfend detaillierte Ausbreitung aller Komplikationen den Zweck durchaus erfüllen würde, hätte der Leser darunter zu leiden, und die Leser akzeptieren eine solche Haltung nicht mehr. Ich könnte unsanft wieder auf dem Bücherregal landen, wo es bekanntermaßen ganz schön eng zugeht.
In der Zwischenzeit habe ich nämlich ein Problem. Es handelt sich um ein Problem, das ich mit jedem Autor teile, der unmissverständlich begreiflich machen möchte, dass etwas kompliziert ist. Einfach zu sagen, „es ist kompliziert“, vermittelt nicht nur nichts von der Faszination, sondern klingt auch irgendwie wohlfeil. Andererseits ist dieses Buch dazu gedacht, von Ihnen gelesen werden – dem wissbegierigen Laien oder Schüler. Es ist kein Lehrbuch. Während also die erschöpfend detaillierte Ausbreitung aller Komplikationen den Zweck durchaus erfüllen würde, hätte der Leser darunter zu leiden, und die Leser akzeptieren eine solche Haltung nicht mehr. Ich könnte unsanft wieder auf dem Bücherregal landen, wo es bekanntermaßen ganz schön eng zugeht.
Wie aber soll ich dann zum Ausdruck bringen, wie kompliziert das Immunsystem ist?
Versuchen wir es einfach mal andersherum. Statt Ihnen zu sagen, wie kompliziert das Immunsystem ist, sage ich Ihnen, wie kompliziert es sein muss, um uns am Leben zu halten, und gebe Ihnen das Heft in die Hand. Greifen Sie zu Bleistift und Notizblock und machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie ein System gestalten würden, damit es den Körper vor Schaden schützt.
Nun, was Sie bei der Ausarbeitung Ihres Entwurfs vor allem berücksichtigen müssen, ist Folgendes: Das Immunsystem eines Organismus schützt ihn vor allem, das in ihm oder von ihm leben möchte. Ein wilder Stier, der Ihnen hinterherjagt, ist demnach eine Angelegenheit für Ihre physiologische Kampf-oder-Flucht-Reaktion, aber kein Fall für das Immunsystem.[3] Von einem Krokodil gefressen zu werden, fällt ebenfalls nicht unter die Zuständigkeit des Immunsystems, weil das Krokodil außen beginnt und sich seinen Weg nach innen bahnt. Gäbe es eine Art sehr kleines Krokodil, das in Ihren Körper eindringen, sich in die Blutlaufbahn oder in eines Ihrer inneren Organe schleusen will, um sich dort niederzulassen, sich vollzustopfen und Nachwuchs zu zeugen – das wiederum würde vom Immunsystem auf jeden Fall einer näheren Betrachtung unterzogen werden, und das parasitäre Mikrodil käme auf die lange und mannigfaltige Liste an Arten, mit denen das Immunsystem fertigwerden muss.
Das Immunsystem ist im Großen und Ganzen auch nicht für den Schutz vor chemischen Giftstoffen verantwortlich (es ist dabei behilflich, aber die Leber, die nicht als Teil des Immunsystems gilt, übernimmt diese Aufgabe größtenteils). Sie müssen sich also lediglich Gedanken über biologische Agenzien wie Bakterien, Parasiten und Viren – sowie ihre vielfältigen Absonderungen – machen.
Wie Sie wissen, tummeln sich auf jedem noch so kleinen Abschnitt unserer Umgebung Milliarden von Mikroorganismen, die ständig auf der Suche nach einem Einfallstor sind. Auch das müssen sie also berücksichtigen. Aber diese Infektionserreger sind längst nicht alles: Beispielsweise suchen und zerstören Immunreaktionen körpereigene Zellen, die einen Schaden haben. Und Sie können auch nicht alles, was von außen hineinkommt, ablehnen – die Nahrung, die wir zu uns nehmen, wird von unserem Körper bereitwillig aufgenommen, wie auch der Sauerstoff, den wir atmen. Jeder einzelne von uns war ganz zu Anfang ein gern gesehener Gast im Schoß seiner Mutter, so dass Sie also von Zeit zu Zeit auch für einen anderen Menschen planen müssen, der im Inneren des Körpers heranwächst, ohne dass das Immunsystem durchdreht und ihn als den Fremdkörper angreift, der er im Grunde ist. Darüber hinaus beherbergen wir unentwegt bereitwillig Trillionen von Bakterien, von denen die meisten in unseren Eingeweiden und auf unserer Haut leben. Das Immunsystem, das Sie entwerfen, muss also stets in der Lage sein, zwischen Freund und Feind und Foetus zu unterscheiden.
Es muss aber auch zwischen Feind und Feind unterscheiden können. Die Wesen, die es abwehren muss, sind übergreifend als Pathogene bekannt (eine Kombination zweier griechischer Wörter, die so viel wie „Krankheitserreger“ heißt), aber sie können voneinander so verschieden sein, wie sie es von uns sind. Bakterien sind mikroskopisch kleine, eigenständige, einzellige Organismen. Protozoen sind ebenfalls eigenständig und einzellig, aber tatsächlich sind sie sehr viel enger mit uns verwandt, was die Aufgabe, zwischen unseren und ihren Zellen zu unterscheiden (und eine Möglichkeit zu finden, sie zu töten, ohne den Körper allzu sehr zu schädigen) ziemlich schwierig macht. Viren sind andererseits überhaupt keine Zellen; sie sind im Wesentlichen nur clevere Stückchen genetischen Materials in einer Proteinhülle, und um zu brüten, müssen sie in eine Wirtszelle eindringen, sie von innen übernehmen und dazu zwingen, ihre angestammte Rolle aufzugeben und sich in eine Virenproduktionsfabrik zu verwandeln. Es existieren auch mehrzellige Parasiten wie Darmwürmer und auch noch Pilzinfektionen, und zu allem Überfluss gibt es da die bereits erwähnten entarteten Zellen des menschlichen Körpers, die alle Hemmungen abgelegt und beschlossen haben, sich wild zu vermehren – und wenn sie damit Erfolg haben, erzeugen sie Tumore.
Das Immunsystem kann auf sie alle nicht in derselben Weise reagieren, weil es sich um sehr unterschiedliche Wesen handelt, die an verschiedenen Orten auftauchen und auf verschiedene Weise angegangen werden müssen. Bakterien, die im Blut, der Lunge oder sonstwo umherschwirren, müssen anders als Viren behandelt werden, die eine Wirtszelle infizieren, oder als Würmer in unserem Darm usw. Das Immunsystem steht vor der Herausforderung, für jede Art von Bedrohung eine maßgeschneiderte Antwort parat zu haben (eine Herausforderung, die es mit Medizinern teilt, die sich genau diesem Problem stellen müssen, wenn sie nach Behandlungen, Impfungen oder Heilmitteln für all diese Krankheiten suchen).
Demnach muss ein Immunsystem eine Vielfalt schädlicher Lebewesen erkennen und auf jedes einzelne auf ganz eigene Weise reagieren.[4] Oh, und wissen Sie, was wirklich hilfreich wäre? Wenn es sich an die Erreger, denen es bereits begegnet ist, erinnern und diese Information irgendwie auf Datei abspeichern könnte, damit es beim nächsten Mal, wenn sie sich blicken lassen, kurzen Prozess mit ihnen machen kann. Und es muss auf neue Eindringlinge vorbereitet sein, denen es noch nie zuvor begegnet ist, denn so spielt das Leben nun einmal. Und es muss auf ganz und gar neue Eindringlinge vorbereitet sein, denen in der gesamten Geschichte der Menschheit noch niemand jemals zuvor begegnet ist, denn die Erreger entwickeln sich im Laufe der Zeit fort. Und es muss haushalten können, damit der Körper seinen Betrieb aufrechterhalten kann. Und es muss ziemlich anspruchslos sein, damit der Körper weiter normal funktionieren kann. Und bei alledem muss es jedes Mal sehr schnell sein, weil sonst der Körper überrannt wird, da sich die Erreger mit geradezu teuflischer Geschwindigkeit vermehren.
All das, da werden Sie mir hoffentlich zustimmen, während Sie Ihren flüchtigen Entwurf für ein Immunsystem zu Papier bringen und ein ungefähres Budget einschließlich Personalbedarf für das Projekt aufstellen, ist ein ungeheuer anspruchsvoller Auftrag. Tatsächlich ist das Immunsystem, das wir haben, nicht perfekt. Manchmal versagt es, und wir werden krank, bis es uns dann wieder besser geht. Manchmal ist die Herausforderung zu groß, und es geht uns anschließend nicht wieder besser. Oft genug schlägt das Immunsystem selbst fehl oder überreagiert, dann leiden wir unter sogenannten Autoimmunerkrankungen. Nichtsdestoweniger bewältigen die meisten Menschen die meiste Zeit eine sehr große Anzahl von Immunherausforderungen – was meiner Ansicht nach bemerkenswert ist. Ist Ihr Immunsystem nicht reizend? Warum geben Sie ihm nicht einfach einen anerkennenden Klaps auf den Thymus?
Trügerische Elemente
 Wahrscheinlich weil Sie nicht wissen, wo sich der Thymus befindet oder was genau er tut, nicht wahr? Kein Grund für ein schlechtes Gewissen. Das Immunsystem ist eine einmalig diffuse Angelegenheit, mit Organen und Funktionen, die sich in merkwürdigen Regionen des Körpers verstecken.[5] Kein Wunder, dass wir so lange gebraucht haben, um zu merken, dass wir überhaupt eins haben.
Wahrscheinlich weil Sie nicht wissen, wo sich der Thymus befindet oder was genau er tut, nicht wahr? Kein Grund für ein schlechtes Gewissen. Das Immunsystem ist eine einmalig diffuse Angelegenheit, mit Organen und Funktionen, die sich in merkwürdigen Regionen des Körpers verstecken.[5] Kein Wunder, dass wir so lange gebraucht haben, um zu merken, dass wir überhaupt eins haben.
Betrachten Sie es mal so: Wenn ein Herz nicht mehr richtig funktioniert, bietet die Medizin Ersatz in Form von Schrittmachern und Herztransplantationen. Wenn Ihre Lunge kollabiert, können Sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Dialysegeräte können die Arbeit Ihrer Nieren übernehmen. Künstliche Gliedmaßen ersetzen Arme und Beine. Hörgeräte können helfen, wenn Ihr Gehör es nicht mehr ausreichend tut. Für die Augen gibt es Brillen und korrigierende Eingriffe. Wir können Lebern transplantieren (auch wenn wir noch nicht wirklich über so etwas wie einen künstlichen Ersatz für dieses bemerkenswerte Organ verfügen). Und obwohl das Gehirn und das Nervensystem derzeit bei weitem noch nicht austauschbar sind, kann ein Chirurg zum Skalpell greifen und selbst in diesen Regionen manch Gutes bewirken.
Es gibt aber keine mechanische Möglichkeit, ein nicht funktionierendes Immunsystem zu reparieren oder auszutauschen. Wir können Medikamente und zusätzliche Mittel und Impfstoffe verabreichen, aber all diese Eingriffe müssen vom Immunsystem selbst verarbeitet werden. Wir können keinen Teil des Immunsystems (mit der bemerkenswerten Ausnahme von Knochenmarktransplantationen, die in sehr speziellen Fällen zum Einsatz kommen) ersetzen oder verpflanzen. Das Einzige, was Ärzte für einen Patienten tun können, ohne auf die Hilfe von dessen Immunsystem angewiesen zu sein, ist ihr gesamtes Umfeld zu sterilisieren.
Das Immunsystem setzt sich aus zahlreichen Arten von Molekülen, Zellen, Geweben und Organen zusammen, die auf ganz verschiedene Orte im Körper verteilt sind und auf komplexe Weise untereinander und mit anderen Systemen des Körpers in Beziehung stehen. Seine Vollstrecker kreisen ständig auf der Suche nach Anzeichen für Ärger durch den ganzen Körper.[6] Ich möchte keine detaillierte Liste all seiner Elemente aufstellen, aber es wäre sicher aufschlussreich, die ganze Maschinerie mal in Aktion zu sehen. Vielleicht wäre es außerdem interessant, das Ganze mal von der anderen Seite zu erleben.
Aus der Sicht des Bazillus
Vielleicht ist es ganz witzig, uns zum Start unserer Tour durch das Immunsystem auszumalen, wie sich die Sache aus der Sicht eines eindringenden Krankheitserregers darstellt. Ein bisschen werde ich dabei selbstverständlich auf die Spaßbremse treten müssen, denn selbst wenn wir in der Lage wären, uns vorzustellen, wie Krankheitserreger ihre Umwelt wahrnehmen (was wir nicht können, da nichts in unserem täglichen Leben uns darauf vorbereitet, wie Darmparasiten zu denken), sieht sich ein Mikroorganismus, der in den Körper eintritt, einem überwältigenden Arsenal scheinbar nichts miteinander zu tun habender Bedrohungen ausgesetzt, die allesamt auf seine Zerstörung abzielen. Unterwegs werde ich also wiederholt Halt machen und erklären, womit wir es zu tun haben. Auch die verschiedenen Reaktionen auf die verschiedenen Arten von Krankheitserregern werde ich erklären.
Mögen die Spiele also beginnen.
Zu Anfang wollen wir uns einem Bakterium anschließen, das gerade mit einem potenziellen menschlichen Wirt in Kontakt kommt. Die meisten Bakterien begegnen uns Menschen mit größter Gleichgültigkeit; sie stören uns nicht und lassen sich von uns nicht stören. Allerdings hat eine kleine Minderheit von Bakterienarten sich darauf spezialisiert, es sich in menschlichen Geweben gemütlich zu machen, und für ihre Lebensweise stellen sie sich sogar den Herausforderungen dieser Hetzjagd.[7] Denjenigen, die es schaffen, seine Verteidigung zu überwinden, verspricht ein menschlicher Körper eine äußerst fette Beute – einen geradezu unerschöpflichen Vorrat an Nahrung, Geborgenheit, Stabilität und sonst noch allem, was ein Bakterium sich nur wünschen kann.
Bakterien können von überall her eindringen, aber der wahrscheinlichste erste Kontaktpunkt ist die Haut – aus rein technischer Sicht ein Teil des Immunsystems –, da sie eine solide, mehrschichtige und in der Regel sehr effektive physische Barriere darstellt. Viele Arten von Bakterien machen dort Halt und geben entweder auf und sterben oder schaffen es, sich auf der Haut anzusiedeln und von den Fetten, die wir aussondern, und allen sonstigen Nährstoffen, die sie finden können, zu leben. Manchmal verursachen sie Hautausschläge und -infektionen, aber im Normalfall wimmelt es auf der Haut nur so von Bakterien, die ihr nicht im Geringsten schaden. Problematisch beginnt es zu werden, wenn die Haut verletzt ist – Wunden, kleinere Einschnitte, Abschürfungen, Insektenstiche und Verbrennungen bieten Infektionserregern ein Einfallstor in den Körper.
Eine weitere sehr beliebte Methode hineinzugelangen ist über den Mund. Einige Eindringlinge schlagen sich bis zur Lunge und anderen Teilen des Atemtrakts durch, während andere ihr Glück bei der blühenden Gemeinschaft von Bakterien des Darms versuchen (diese sind als körpereigene Mikroflora bzw. symbiotische Bakterien bekannt). Wieder andere versuchen, an irgendeinener Stelle der Epithelzellen der Schleimhaut, die unseren Verdauungstrakt auskleiden, einzudringen.
Einige Bakterien versuchen es vom anderen Ende her und suchen einen Weg über den Urogenitaltrakt, eine ziemlich riskante Route, die aber den Vorteil mit sich bringt, eine direkte Verbindung zwischen zwei menschlichen Körpern bereitzustellen. Für einige Krankheitserreger (darunter der berühmt-berüchtigte HIV-Virus) ist das wichtig, da sie, kaum sind sie der frischen Luft ausgesetzt, sterben. Sie müssen demnach darauf warten, dass ihr Wirt das zwischenkörperliche Andockmanöver beginnt, das wir „Sex“ nennen, um zu einem neuen Wirt zu gelangen.
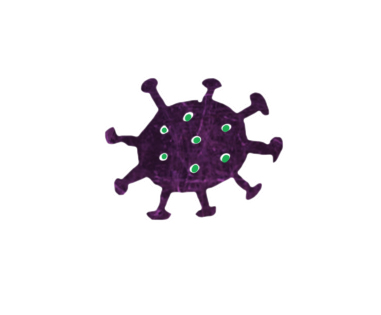 Das Leben der Keime ist eine rauhe Angelegenheit, ihre Überlebenschancen sind miserabel. Nur ein paar wenige Auserwählte schaffen es bis ans Ziel. Die überwältigende Mehrheit stirbt bei diesem Vorhaben: weil sie überhaupt nicht mit einem menschlichen Wirt in Kontakt kommen und auf dem Boden, an der Wand, im Meer oder einem Taschentuch landen; weil sie ungünstigen Temperaturen in der äußeren Umgebung ausgesetzt werden oder schädlichen Substanzen auf der Haut oder Säuren und Verdauungsenzymen in Magen und Darm; weil sie durch das Tun anderer Arten von Bakterien sterben, die keinerlei Rücksicht auf das Wohlergehen der Neuankömmlinge nehmen, sich mit ihnen um Nahrung streiten und sie manchmal ganz gezielt angreifen. Symbiotische Darmbakterien verpfeifen die Krankheitserreger sogar beim Körper, indem sie chemische Signale an die Zellen in der (menschlichen) Darmschleimhaut senden, die sie dazu anhalten, sich zu verstärken und ein Durchdringen schwieriger zu machen.
Das Leben der Keime ist eine rauhe Angelegenheit, ihre Überlebenschancen sind miserabel. Nur ein paar wenige Auserwählte schaffen es bis ans Ziel. Die überwältigende Mehrheit stirbt bei diesem Vorhaben: weil sie überhaupt nicht mit einem menschlichen Wirt in Kontakt kommen und auf dem Boden, an der Wand, im Meer oder einem Taschentuch landen; weil sie ungünstigen Temperaturen in der äußeren Umgebung ausgesetzt werden oder schädlichen Substanzen auf der Haut oder Säuren und Verdauungsenzymen in Magen und Darm; weil sie durch das Tun anderer Arten von Bakterien sterben, die keinerlei Rücksicht auf das Wohlergehen der Neuankömmlinge nehmen, sich mit ihnen um Nahrung streiten und sie manchmal ganz gezielt angreifen. Symbiotische Darmbakterien verpfeifen die Krankheitserreger sogar beim Körper, indem sie chemische Signale an die Zellen in der (menschlichen) Darmschleimhaut senden, die sie dazu anhalten, sich zu verstärken und ein Durchdringen schwieriger zu machen.
Die Mikroben, die nicht sterben, werden unter Umständen von den Muskeln im Darm weggedrückt, von Urin (wenn sie auf diesem Weg hochzuklettern versuchen) oder Tränen (in den Augen) oder Speichel (im Mund) weggespült oder von Zilien (winzige haarähnliche Strukturen, die wie eine Eimerkette funktionieren, die Fremdkörper aus den Atemwegen und der Lunge befördert) aus dem Weg geräumt.
Der Erreger, der nach all dem noch putzmunter ist und sich anschickt, den menschlichen Körper zu erobern, könnte sich mit allem Recht der Welt und wie Henry V. aus Shakespeares gleichnamigen Stück mit den Worten „wir Wenigen, wir glücklichen Wenigen“ an seine übrig gebliebenen Kameraden wenden. Aber da Mikroben so etwas nicht tun, lässt er es einfach. Und doch fängt – wie im Falle der Armee Henrys V. – der Ärger für die Mikroben gerade erst an.
Nachdem es ihr gelungen ist, die physische Barriere aus Epithelzellen zu durchdringen, bekommt eine Mikrobe nun unmittelbar den Zorn der angeborenen Immunabwehr zu spüren, eine einfallsreiche Sperreinrichtung aus Zellen und Molekülen, die die Evolution in der liebevollen Absicht zusammengetragen hat, auf vielfältige Weise Verderben über die Eindringlinge zu bringen. Aus Sicht des Krankheitserregers bricht nun die Hölle los: Enzyme und kleine antimikrobielle Peptid-Moleküle versuchen, die äußeren Schichten des Bakteriums wegzuknabbern, eine Gruppe von Proteinen, besser bekannt als Komplementsystem, kommt an seiner Oberfläche zusammen, um ein klaffendes Loch in seine Membran zu reißen (dieses Loch ist dementsprechend unter dem Respekt einflößenden Namen Membranangriffskomplex bekannt). Wenn es dem Bakterium gelingt, all dem irgendwie zu entkommen, haften sich spezielle bakterienerkennende Proteine an seine Fersen und geben es zum Verzehr durch verschiedene Arten von bakterienverschlingenden Zellen – wir nennen sie Phagozyten – frei, die versuchen, es vollständig zu verschlingen und anschließend mithilfe ätzender Chemikalien zu verdauen.
Eine Makrophagen genannte Art von Phagozyten frisst die Bakterien nicht einfach nur, sondern setzt zusätzlich Signalmoleküle ab, die eine entzündliche Reaktion hervorrufen. Dies hat zur Folge, dass die Blutgefäße in der Nähe der Infektionsstelle durchlässiger und weitere Phagozyten zu der Stelle herbeigeordert werden. Für das Bakterium bedeutet das, dass sich da plötzlich noch mehr fieses Zeug tummelt, das es töten will. Es kriechen nun buchstäblich Zellen aus den Wänden (den nun erweiterten Blutgefäßen) und stellen ihm nach.
Viren und assistierter Selbstmord
Wenn es sich beim Krankheitserreger statt um ein Bakterium um einen Virus handelt, wird er sein Bestes tun, eine Wirtszelle zu infizieren und dem Immunsystem aus dem Weg zu gehen. Dieses wiederum könnte das Virusmaterial identifizieren und ein Alarmsignal auslösen. Daraufhin werden antivirale Elemente freigesetzt; nicht infizierte Zellen werden darauf hingewiesen, ihre Verteidigung gegen das Eindringen von Viren hochzufahren, und die Zellen, die bereits infiziert worden sind, werden dazu angehalten, Selbstmord zu begehen – ein natürlicher Prozess, der als programmierter Zelltod oder Apoptose bekannt ist.
Der Körper funktioniert nach dem Ehrenprinzip: von jeder Zelle wird erwartet, dass sie anzeigt, wenn sie infiziert oder anderweitig irreparabel beschädigt worden ist. Sogenannte MHC-Klasse-I-Moleküle, die sich an der Oberfläche der meisten Zelltypen im Körper befinden, binden Peptide – kleine Proteinstückchen – und präsentieren sie der äußeren Umgebung in einer für die Immunzellen verständlichen Weise. Wenn also eine Zelle in Ihrem Körper mit einem Virus infiziert wurde, sendet sie schnell eine Nachricht an das Immunsystem, die in etwa so viel besagt wie „Hilfe! Hilfe! Ich bin infiziert! Befiehl mir, mich jetzt zu töten!“ – und das Immunsystem kommt dieser Aufforderung gerne nach.
 Es hat ein großes Interesse daran, dass sich infizierte Zellen auf diese geordnete Weise selbst zerstören, da ein gewaltsamer, explosiver Tod die Viruspartikel eher freisetzen als auslöschen würde – und das ist nicht gewollt. Es kann vorkommen, dass dieses System durch Krankheitserreger unterminiert wird, die in die Zelle eindringen und sie daran hindern, die Quarantäneflagge[8] zu hissen: Das Ergebnis ist eine problematische infektiöse Erkrankung.[9] Um noch besser sicherzustellen, dass kompromittierte, virusproduzierende Zellen nicht doch am Leben bleiben, spüren darauf spezialisierte natürliche Killerzellen (NK) notleidende Zellen des Körpers auf und zerstören sie.
Es hat ein großes Interesse daran, dass sich infizierte Zellen auf diese geordnete Weise selbst zerstören, da ein gewaltsamer, explosiver Tod die Viruspartikel eher freisetzen als auslöschen würde – und das ist nicht gewollt. Es kann vorkommen, dass dieses System durch Krankheitserreger unterminiert wird, die in die Zelle eindringen und sie daran hindern, die Quarantäneflagge[8] zu hissen: Das Ergebnis ist eine problematische infektiöse Erkrankung.[9] Um noch besser sicherzustellen, dass kompromittierte, virusproduzierende Zellen nicht doch am Leben bleiben, spüren darauf spezialisierte natürliche Killerzellen (NK) notleidende Zellen des Körpers auf und zerstören sie.
Infiltrationstaktiken für Fortgeschrittene
Gibt man dem Ganzen ein paar Stunden Zeit, kann man sich ziemlich sicher sein, dass es einem normalen, gesunden Immunsystem, das es mit einer zumutbaren Infektion zu tun bekommen hat, gelungen ist, die Situation unter Kontrolle zu bringen.[10] Wie ich bereits erwähnt habe, kommt die große Mehrheit der Mikroben, die in einen Körper eindringen, eher zufällig dorthin, und ein wichtiger Teil der Aufgabe des Immunsystems besteht darin, diese unfreiwilligen Touristen schnell loszuwerden, bevor sie damit anfangen, sich zu vermehren und Ärger zu machen.
Allerdings gibt es auch weit weniger harmlose Eindringlinge. Den menschlichen Körper zu infiltrieren ist das täglich Brot dieser Pathogene, und sie sind mit dem richtigen Werkzeug und den richtigen Fähigkeiten für den Job ausgestattet. Ein Beispiel: Mycobacterium tuberculosis-Bakterien werden von den Makrophagen, die in der Lunge angesiedelt sind, aufgefressen, aber sie tricksen die Makrophagen aus, indem das Bakterium, wenn es verschluckt wird, den Makrophagen so manipuliert, dass er daran gehindert wird, es in sein Lysosom zu verfrachten. M. tuberculosis will das Lysosom auf keinen Fall betreten, weil „Lysosom“ im Grunde nichts anderes als ein harmlos klingender Name für etwas ist, das ein Bakterium wohl eher „die schwebende Säurekammer des Explosionstodes“ nennen würde. In dieser inneren Kammer verdaut der Makrophage seine Beute; es handelt sich gewissermaßen um seinen Magen.
Statt mit dem tödlichen Lysosom zu verschmelzen, bleibt das Bakterium in einem separaten Bereich innerhalb des Makrophagen und ernährt und vervielfacht sich in seinem Inneren, wodurch es den Jäger zum Gejagten macht. Wenn die Bakterien sich so stark vermehrt haben, dass die Kapazitäten einer bestimmten Zelle erschöpft sind, bringen sie sie zum Platzen und ziehen weiter. Für den Körper ist es sehr schwer, sie davon abzuhalten, weshalb Tuberkulose auch so eine tückische Krankheit ist.
Andere Krankheitserreger greifen auf ähnlich ausgefuchste Techniken zurück. Tatsächlich gibt es zu fast jeder Maßnahme, die das Immunsystem ergreift, um den Körper zu schützen, irgendwelche Krankheitserreger, die einen Weg gefunden haben, sich davor (oder, wie im Fall von Tuberkulose, in seinem Inneren) in Sicherheit zu bringen, es zu umgehen, aufzuhalten, es für ihre eigenen schändlichen Zwecke zu nutzen oder zu zerstören. So gut wie jedes Kommunikationssignal des Immunsystems kann abgefangen, blockiert oder auf andere Weise verfälscht werden: Es gibt eine Art von Streptokokken-Bakterien, die zelluläre Proteine aus der Umgebung sammelt und damit ihre wahre Bakterien-Identität verschleiern kann; Malaria-Parasiten verstecken sich innerhalb der roten Blutkörperchen; HIV-Viren nehmen das Immunsystem selbst ins Visier, greifen T-Zellen an und sorgen für Chaos in der Immunantwort.[11] Chlamydia trachomatis dringt in eine Zelle ein und hindert sie anschließend daran, zu signalisieren, dass sie infiziert wurde. Neisseria gonorrhoeae sondert ein Protein-Molekül ab, das die zelluläre Immunsuppression fördert – indem es ein fälschlicherweise beruhigendes Signal aussendet, das das Immunsystem davon abhält, in Aktion zu treten.
Jeder fiese Erreger hat seine eigene hinterhältige Taktik, um das Immunsystem zu unterwandern – sonst wäre es schließlich kein fieser Erreger. Es wäre ein leicht zu kontrollierender Schwächlingserreger, der vom Immunsystem ohne jeden oder mit wenig Aufwand unschädlich gemacht werden könnte, und wir würden von Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria, AIDS, Chlamydien oder Gonorrhoe überhaupt nichts wissen.
Die Sache mit der Spreu und dem Weizen
Als ich an der Uni studierte, nahm ich an einem Kurs namens „Durchbrüche in der Mikrobiologie“ teil. Wir waren etwa ein Dutzend Studenten, und jeder von uns bekam nach dem Zufallsprinzip einen anderen bedeutenden Aufsatz zur  Mikrobiologie zugewiesen, über den wir einen kurzen Vortrag halten mussten. Fast alle Aufsätze waren Jahrzehnte alt, was für mich damals hieß, dass sie nicht besonders interessant waren[12], und so freute ich mich, als ich sah, dass der Aufsatz, den ich zugeteilt bekommen hatte, erst ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Er war praktisch druckfrisch! Und veröffentlicht in der angesehenen Zeitschrift Nature. Das Thema waren Toll-ähnliche Rezeptoren (TLR). Dabei handelt es sich um Moleküle, die auf den Zellen des Immunsystems zu finden sind. Der Aufsatz legte dar, dass eine Art von TLR, TLR2 genannt, dafür verantwortlich ist, eine Art von Molekül zu identifizieren, das fast alle Bakterien auf ihrer Oberfläche haben, nicht-bakterielle Zellen aber nie. Es ist als bakterielles Lipopolysaccharid (LPS) bekannt. Wenn also TLR2 die Anwesenheit von LPS spürt, kann man sich sicher sein, dass Bakterien im Anmarsch sind und eine Immunantwort notwendig ist.
Mikrobiologie zugewiesen, über den wir einen kurzen Vortrag halten mussten. Fast alle Aufsätze waren Jahrzehnte alt, was für mich damals hieß, dass sie nicht besonders interessant waren[12], und so freute ich mich, als ich sah, dass der Aufsatz, den ich zugeteilt bekommen hatte, erst ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Er war praktisch druckfrisch! Und veröffentlicht in der angesehenen Zeitschrift Nature. Das Thema waren Toll-ähnliche Rezeptoren (TLR). Dabei handelt es sich um Moleküle, die auf den Zellen des Immunsystems zu finden sind. Der Aufsatz legte dar, dass eine Art von TLR, TLR2 genannt, dafür verantwortlich ist, eine Art von Molekül zu identifizieren, das fast alle Bakterien auf ihrer Oberfläche haben, nicht-bakterielle Zellen aber nie. Es ist als bakterielles Lipopolysaccharid (LPS) bekannt. Wenn also TLR2 die Anwesenheit von LPS spürt, kann man sich sicher sein, dass Bakterien im Anmarsch sind und eine Immunantwort notwendig ist.
So weit, so gut. Ich las die Abhandlung, fasste die Ergebnisse zusammen und machte mich auf die Suche nach ein paar neueren Arbeiten zu diesem Thema, um, wie es sich für einen guten, kleinen Studenten gehört, mein Referat mit etwas Hintergrund und Kontext anzureichern. Aber die Sache gestaltete sich schwierig: Irgendetwas an der Sache war faul, und ich konnte nicht genau sagen, was. In den Aufsätzen, die ich las, schienen seltsame Dinge zu stehen, die so gar nicht in meinen Vortrag passen wollten. Mehrere frustrierende Wochen später entdeckte ich die Ursache für meine Verwirrung: Die anderen Aufsätze kamen mir komisch vor, weil sie dem mir zugewiesenen Nature-Aufsatz geradewegs widersprachen. TLR2 erkennt LPS überhaupt nicht; das war ein Fehler. In Wahrheit ist es ein anderer Toll-ähnlicher Rezeptor, TLR4, der das LPS erkennt. Ich weiß, dass das, einfach so von mir dahingesagt, nicht nach besonders viel klingt, aber dieser kleine Fakt war im Jahr 2011 den Nobelpreis für Medizin wert.
Die Nature-Versuchsleiter waren nicht sorgsam genug gewesen. Die LPS-Lösung, die sie verwendeten, war nicht gut genug gereinigt und mit einer kleinen Menge anderer Bakterienelemente kontaminiert, und genau diese Verunreinigungen waren es, die die TLR2-Reaktion hervorriefen. Unser Dozent, der gerissene alte Teufel, hatte uns absichtlich einen fehlerhaften Aufsatz ausgeteilt, um die Fehlbarkeit wissenschaftlicher Untersuchungen anschaulich zu machen (ich habe nie den Mut aufgebracht, ihm zu sagen, wie genial ich das damals fand).
Bei dem Aufsatz handelte es sich nicht um irgendeine reißerische Studie, die auf kreative Weise aufbereitet im Wissenschaftsteil einer Lokalzeitung stand. Das war ernste und ernstzunehmende Forschung, die in Nature veröffentlicht worden war – und sie war falsch. Ich brauchte eine Weile, um über den Schrecken des „Was wäre gewesen, wenn“ hinwegzukommen: Was, wenn ich nicht kapiert hätte, was da los war? Ich hätte das Referat gehalten, als ob das Papier richtig gewesen wäre, einen Narren aus mir gemacht und eine krachende Niederlage erlebt. Forschung – auch Forschung, die in renommierten Zeitschriften veröffentlicht wird – kann eine Fehlerquelle sein. Das ist etwas, das jeder Wissenschaftler irgendwann auf die eine oder andere Weise lernt, und das hier war eine gute Art, es zu lernen: besser in einem Hörsaal als in der realen Forschungswelt.
Abgesehen davon, dass es die wertvollste Lektion über Wissenschaft darstellt, die ich mir vorstellen kann, ist diese kleine Geschichte sowohl eine Einführung in die Toll-ähnlichen-Rezeptoren als auch so etwas wie eine Metapher für die Rolle dieser Rezeptoren und anderen wie ihnen: Das angeborene Immunsystem muss ständig wachsam sein, um beurteilen zu können, wenn etwas nicht in Ordnung ist, die Spreu vom Weizen zu trennen und die Informationen weiterzugeben. Wenn nicht, können wir uns auf ganz schön was gefasst machen.
[1] Schwarzgalle, Gelbgalle, Blut und Weißschleim.
[2] Und nicht zu vergessen Alfred Russel Wallace, der Darwins Platz hätte einnehmen können, wäre dieser in der Rolle des Darwin nicht besser gewesen als er.
[3] Es sei denn, der Bulle kriegt sie. Dann wiederum hat das Immunsystem eine Vielzahl interessanter Herausforderungen zu bestehen.
[4] Wenn wir etwas als Pathogen bezeichnen, was so viel heißt wie, dass es uns krank macht, dann geben wir ihm einen Namen, der sich nicht darauf bezieht, was es ist, sondern was es mit uns macht. Das ist kein gutes Prinzip, um Organismen zu klassifizieren. Wesen, die radikal verschieden sind, können nahezu identische Krankheiten auslösen, und umgekehrt kann eine Mikrobe völlig harmlos sein, während ihr nächster Angehöriger für reichlich Kummer sorgt. Unser Immunsystem, der alte Pragmatiker, sucht ständig nach Wegen, die fiesen von den ungefärlichen zu unterscheiden.
[5] Ich erinnere mich noch gut an den Schock, den es mir versetzte, als ich das erste Mal erfuhr, dass ein beträchtlicher Teil der Immunvorgänge (wie beispielsweise die Produktion der roten Blutkörperchen) von allen nur erdenklichen Orten ausgerechnet im Knochenmark angesiedelt ist. „Wirklich?“, fühlte ich mich versucht zu fragen. „Man hat es in die Knochen gesteckt?“. Was, um es mal wenig vornehm auszudrücken, soll der Sch… ? Aber das größte Problem, das ich mit der Evolutionstheorie habe, ist, dass man niemanden hat, den man für solche Sachen verantwortlich machen kann.
[6] Über Infektion und Immunität wird gerne unter Verwendung militärischer Ausdrücke geschrieben – der Körper ist ein Schlachtfeld, auf dem die marodierenden Bakterienbataillone die ritterlichen Immunzellen, die ihrerseits die Festung verteidigen, zum Kampf fordern etc. Es handelt sich gewissermaßen um eine natürliche Analogie und oft sogar um eine nützliche, aber sie gerät eben auch schnell an ihre Grenzen. Ich werde also versuchen, solche Bezugnahmen mit Vorsicht zu gebrauchen. Überhaupt weist das, was wir heute über Immunprozesse wissen, wenn wir schon bei der Kriegsrhetorik bleiben wollen, darauf hin, dass wir es eher mit der Sorte Konflikt zu tun haben, bei der es vor allem auf Geheimdienstarbeit, Spionageabwehr, die Manipulation von Kommunikationskanälen, einen schonenden Umgang mit der Zivilbevölkerung, Täuschungsmanöver, Tarnung, Fallen, Logistik usw. ankommt, als um die traditionelle, männliche, brutale Vorstellung von Kriegerhorden, die auf einem Schlachtfeld die Schwerter kreuzen. Wir könnten sogar so weit gehen zu sagen, dass die moderne Art der Kriegsführung erst langsam an unser uraltes Immunsystem heranreicht.
[7] Es versteht sich geradezu von selbst, dass Bakterien, wie auch alle anderen Parasiten, über die ich hier sprechen werde, keinen Verstand haben. Mikroben sind keine Menschen. Sie sind weder „gut“ noch „böse“. Sie haben keinen „Willen“ und können auch nicht „lernen“ oder „planen“. Diese Ausdrücke beziehen sich auf Menschen oder mindestens auf Tiere mit einem echten Gehirn. Eine Mikrobe verfügt nicht über Urteilskraft, ein Gespür für Gut und Böse oder die Fähigkeit zu denken. Sie existiert einfach und agiert oder reagiert auf bestimmte Weise auf ihre Umgebung. In jüngerer Zeit war wiederholt zu hören, dass es gewisse Mikrobengruppen gibt, deren Fähigkeiten sich in gewisser Weise als „kognitiv“ bezeichnen lassen, aber das ist eine andere Geschichte, und sie soll ein anderes Mal erzählt werden.
[8] Schiffe, an deren Bord eine Epidemie ausgebrochen ist, müssen mit einer Flagge das Signal „Quarantäne; bitte Abstand halten“ geben. Das Gelbfieber hat seinen Namen allem Anschein nach vom „Yellow Jack“, einer gelben Quarantäneflagge.
[9] Wenn es von einer menschlichen Zelle unterminiert wird, deren Selbstkontrollsysteme verrücktspielen, kann es sich um den Beginn eines Tumors handeln.
[10] In einer Situation, in der ein Körper ungewöhnlich anfällig für eine Infektion ist – beispielsweise im Falle ausgedehnter Verbrennungen, bei denen Teile des Körpers nicht mehr von der Haut geschützt werden – kann das kompromittierte Immunsystem manchmal unter der schieren Last an infektiösen Mikroben zusammenbrechen, selbst wenn diese Mikroben per se gar nicht besonders gefährlich sind.
[11] Sie sind ein bisschen wie Einbrecher, die sich darauf spezialisiert haben, Polizeistationen auszurauben.
[12] Häufig sehen Wissenschaftler heutzutage Forschung, die älter als fünf Jahre ist, als praktisch obsolet an. Bei der Geschwindigkeit, mit der die moderne Wissenschaft voranschreitet, ist alles, was man tun kann, mit der zunehmenden Informationsmenge Schritt zu halten. Wie viele andere Studenten, übernahm auch ich diese Haltung unhinterfragt. Heute bin ich etwas weniger einfältig.
Das Buch
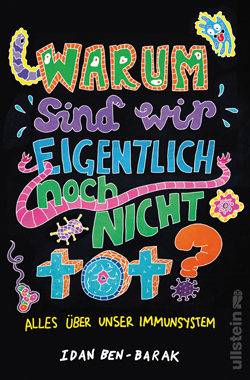 Krebs, Tuberkulose und ganz normale Grippe-Erreger lauern an jeder Ecke. Da liegt die Frage nahe: Warum sind wir eigentlich noch nicht tot? Wie schaffen wir es, in einer feindlichen, von Viren und Bakterien nur so wimmelnden Umgebung ein doch meist recht langes Leben zu führen? Weil es uns gelingt, jeden Tag Millionen von Krankheitserregern auszuschalten, in Schach zu halten oder sogar langfristig als dienstbare Geister in unseren Stoffwechsel zu integrieren. In diesem sehr unterhaltsamen und fachkundigen Buch erzählt Idan Ben-Barak, wie unser Immunsystem funktioniert, woran es manchmal scheitert, wie wir ihm helfen können und wo die Zukunft der Immunforschung liegt.
Krebs, Tuberkulose und ganz normale Grippe-Erreger lauern an jeder Ecke. Da liegt die Frage nahe: Warum sind wir eigentlich noch nicht tot? Wie schaffen wir es, in einer feindlichen, von Viren und Bakterien nur so wimmelnden Umgebung ein doch meist recht langes Leben zu führen? Weil es uns gelingt, jeden Tag Millionen von Krankheitserregern auszuschalten, in Schach zu halten oder sogar langfristig als dienstbare Geister in unseren Stoffwechsel zu integrieren. In diesem sehr unterhaltsamen und fachkundigen Buch erzählt Idan Ben-Barak, wie unser Immunsystem funktioniert, woran es manchmal scheitert, wie wir ihm helfen können und wo die Zukunft der Immunforschung liegt.
Links
Warum sind wir eigentlich noch nicht tot? auf den Seiten der Ullstein Buchverlage
Idan Ben-Barak bei Twitter

