„Wir sterben nur einmal – wir können das nicht trainieren.“, stellt Professor Bruno Müller-Oerlinghausen mit Blick auf den Tod fest. Bei uns im Essay beschreibt der Experte für körpertherapeutische Methoden die Wirkung und Bedeutung von Berührung während des Sterbeprozesses. „Jeder stirbt seinen Tod.“ Wie wir aber denen, die gehen, auf ihrem Weg eine Stütze sein können und welche Rolle das Körpergedächtnis spielt, wenn der Hör-, Seh- oder Geruchssinn schwinden, erfahren Sie hier.

„Sterben ist kein Kinderspiel.“
– Karl Eugen, 1712-1793, Herzog von Württemberg, auf dem Totenbett
„Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen.“, singen die Barmherzigen Brüder in Schillers „Wilhelm Tell“, angesichts des in seinem Blut liegenden bösen Gessler.
Vorbereitung auf den Tod ist nicht nur Papierarbeit, Ausfüllen von Formularen, letztwillige Verfügungen, Verabredungen mit einem Bestatter oder die Überlegung, was ich auf meinen Organspendeausweis schreiben soll. Es ist auch die Vorbereitung auf das Sterben mir nahestehender Menschen und mein eigenes Sterben – soweit das überhaupt möglich ist. Vielleicht werden wir dazu angeregt durch Nachdenken darüber, warum der eine Mensch leicht stirbt, quasi schwerelos wird, während der andere schwer stirbt und den „Todeskampf“ bestehen muss. Solche Unterschiede werden nicht einfach hinweg gespült durch die Hoffnung auf umfassende palliativmedizinische Betreuung. Ich meine, wir sollten auch nachdenken über die Bedeutung von Liebe und Berührung für den „Sterbeprozess“.
Was wissen wir denn über Sehnsucht nach zärtlicher Berührung bei Schwerkranken, Sterbenden?
Vor einigen Jahren kam eine junge Psychologin und Tantrikerin zu mir, sie kannte meine Studien und Schriften zur heilsamen Wirkung von Berührung, doch unser neues Buch war noch nicht erschienen. Sie wollte Forschungsmöglichkeiten zu den Wirkmechanismen von Tantra diskutieren. Eine ihrer überraschenden Ideen und Fragen war, ob ich mir vorstellen könne, die Wirkung und Akzeptanz von Tantra bei Sterbenden zu erproben. Ein zunächst absurd erscheinender Gedanke. Aber die Frage blieb in mir haften: was wissen wir denn über Sehnsucht nach zärtlicher Berührung bei Schwerkranken, Sterbenden?
„Ich würde heute ungern sterben.“, sagte der schon ältere Martin Walser in einem Interview.
Wer von uns könnte heute schon loslassen? Im Mittelalter gab es die Ars moriendi – quasi eine Anleitung zum guten Sterben. Das war wichtig in einer Zeit der „schwarzen Blattern“, dem immer präsenten Tod und der Angst vor dem Höllenfeuer, das den Menschen erwartete, der kein gottgefälliges Leben geführt hatte.
Aber auch heute haben wir doch fast alle Angst vor dem Tod und wissen in dieser Wissenswelt nicht, wie es sein wird. Wie wäre es denn, wenn Gevatter Tod jetzt hereinträte, – nein, nicht der mit den Knochen und der Sense, sondern ein freundlich blickender, junger, weiß gekleideter Mann. Vielleicht nähme er einen von uns, den ältesten oder den jüngsten, den, der gar nicht wusste, wie nah am Tod er schon ist, ganz sanft an der Hand, so wie in Schubert’s Lied „Der Tod und das Mädchen“, und führte uns ganz leicht hinaus. Und dann würden wir zu den Wissenden gehören.
Wir sterben eben nur einmal – wir können das nicht trainieren. Jeder stirbt seinen Tod. Und wir können ja auch die schon von uns Gegangenen nicht befragen, sollten es auch nicht tun: dass das schlecht ausgehen kann, hat der König Saul erfahren, wie er die Wahrsagerin Endor holen lässt. Mein Großvater mütterlicherseits, ein vitaler Rheingauer und engagierter National-Liberaler, den religiösen Gebräuchen nicht unbedingt nahestehend, soll auf dem Totenbett gesagt haben: „Nun werden wir ja sehen.“ Der Tod gehört im Sinne von Hartmut Rosa zum „Unverfügbaren“ – es sei denn wir suizidieren uns oder die „Medizin“ definiert unser Lebensende.
Wir werden vielleicht im vorgerückten Alter zu Hause oder im Hospiz „friedlich entschlafen“, können aber auch plötzlich und unerwartet vom Herzschlag getroffen werden, manche wünschen sich das. Viele von uns kennen Menschen, die gegen einen bösartigen Krebs kämpfen. Sie haben Zeit, sich Gedanken über ihren Tod zu machen und es mag sein, dass wir in dieser Zeit die besten Gespräche miteinander haben dürfen. Man umarmt sich, verabschiedet sich anders als sonst, der Händedruck ist fester und länger – es könnte jedes Mal das letzte Mal gewesen sein. Auch der US-Amerikaner, der letztes Jahr auf dem elektrischen Stuhl sterben musste, hatte 6 Jahre Zeit gehabt, sich auf seinen Tod vorzubereiten.
Den Tod mit dem Leben versöhnen.
Wir können heutzutage auch auf der Intensivstation sterben, angeschlossen an viele Apparate, die nach unserem „irreversiblem Hirnfunktionsausfall“ vielleicht noch lange Zeit weiterlaufen werden, falls wir einer Organentnahme zugestimmt haben, und unseren Körper nicht zur Ruhe kommen lassen. Der polnische Partisan oder der Jude, der als Geisel mit vielen anderen zusammen von der SS per Genickschuss erledigt wurde, hatte keine Zeit zur Vorbereitung. Der Soldat im Gefecht lebt mit dem täglichen Risiko, tot vom Schlachtfeld getragen zu werden – zum Schluss nur noch zerstörter Körper, zerfetztes Fleisch – so wie es Otto Dix geradezu zwanghaft immer wieder malen musste.
Die Menschen, die am 11. September aus dem brennenden Wolkenkratzer sprangen, wussten für wenige Sekunden, dass dies das Ende ihres Lebens sein würde. Vielleicht hatten sie die Erfahrung wie ich sie selbst erlebt habe, als ich vor Jahrzehnten in Nepal an einem Berg plötzlich mehrere Meter senkrecht abstürzte, dann auf einem kleinen Felsvorsprung doch zum Stehen kam und mein ganzes Leben in Sekundenschnelle wie ein Film rückwärts in meinem Gehirn abrollte.
Ars moriendi – das mag schwer umzusetzen sein in unseren Zeiten, aber, wie es mein Kollege Ridder in seinem schönen Buch über eine neue „Sterbekultur“ sagt: wir könnten doch versuchen, das Leben und den Tod miteinander zu versöhnen – was schlussendlich wohl nie ganz gelingt, aber doch ein lohnendes Ziel wäre.
Der Mensch ist ein Wesen des Bezugs. Er ist in der Sprache Helmut Plessners exzentrisch. Unsere Bezüge zu anderen Menschen sind vielfältig – sie sind nicht immer gut. Auf die guten bauen wir vielleicht im Sterben. Aber sie können auch ungut sein, Versäumnisse, kleinere oder größere beinhalten. Die Versäumnisse, die Lieblosigkeiten, die nicht geschafften Vergebungen kommen nach oben, wenn die Seele sich lösen will, sie sind u.U. Grund eines schweren Sterbens im Todeskampf. Ein erfahrener Bestatter hat mir das bestätigt. Der Alb, der im Märchen dem Sterbenden schwer auf der Brust sitzt, verkörpert genau das. In buchstäblich letzter Minute rufen wir dann als Sterbende nach den Menschen, mit denen wir uns noch versöhnen möchten, ja müssen. „Wohl versehen mit den Hlg. Sterbesakramenten“ lesen wir noch manchmal in Todesanzeigen – die Sterbesakramente sind ja eines der sieben Sakramente, die es nach katholischer Lehre gibt, das heißt auch, dass uns Segen zugesprochen wurde, die Kraft, dass wir diese letzte Prüfung bestehen werden.
Ein wichtiger Teil des Umgangs mit dem nahenden Tod ist also die Verabschiedung – und dabei kann jeder dem Anderen noch einmal Danke für ein hoffentlich gutes Leben sagen. Den Tod mit dem Leben versöhnen.
Berührung ist die Ur-Kommunikation, von der Wiege bis zur Bahre.
Im Bewusstsein des nahenden Todes hört für den Schwerkranken oder Sterbenden das Multitasking auf. Er ist nicht mehr auf Aktionsmodus geschaltet. Er kann vielleicht nicht mehr hören oder reden, oder vielmehr er will es nicht mehr. Konzentration auf das, was mit Gewissheit geschehen wird, ist jetzt notwendig. Meine Mutter sagte am Beginn der Nacht, in der sie starb – ohne dass dies jemand von uns bereits erwartet hatte, – auf die Frage, wie es ihr gehe, nur: Es ist ein bisschen anstrengend.
Wir können unseren Hör- oder Seh- oder Geruchssinn abstellen, der Tastsinn aber bleibt erhalten bis zum letzten Atemzug. Wenn wir selber und der Sterbende nicht mehr reden können oder wollen, so können wir ihm doch unsere Hand auf die seine legen, ihn unserer Anteilnahme an seinem letzten Weg, den er nun gehen muss und vielleicht auch will, versichern. Und wir können der Großmutter vielleicht ihren Rosenkranz oder ein Lazaruskreuzchen in die Hand geben.
Berührung ist die Ur-Kommunikation, von der Wiege bis zur Bahre, und gerade deshalb spielt sie eine so wichtige Rolle in Situationen, in denen vieles oder fast alles, was uns sonst so wichtig war, in den Hintergrund tritt. Jede Berührung enthält eine Botschaft, die vom Kontext abhängig ist und von den in unserem Körpergedächtnis gespeicherten Berührungen unseres ganzen Lebens und ihren jeweiligen Bedeutungen. Wenn wir einem Kranken oder Sterbenden ganz leicht und zart über die Stirn oder die Wange streichen oder über den Handrücken, dann können dadurch gute Erinnerungen ausgelöst werden. Vielleicht nimmt er sie mit dahin, wo er nun gehen wird. Die Pflege in Hospizen oder in der Palliativmedizin weiß das längst. Eine beglückende Erfahrung kann es sein, wenn wir einem verwirrten alten Patienten mit chronischen Schmerzen eine kleine Rückenmassage zukommen lassen und er vielleicht sagt: das hat meine Mama oft mit mir gemacht.
„Wie ich berühre, so werde ich berührt.“
So ist also die Berührung, die ja immer ein reziproker, doppelt gerichteter Prozess ist („wie ich berühre, so werde ich berührt“, heißt es in unserem Buch) nicht nur in unserem täglichen Leben stets gegenwärtig, sondern kann auch das Medium sein, um Trost, Heilung, Segnung zu vermitteln.
Den Leichnam umarmen wir nicht. Das reziproke Element ist erloschen. Die Hand des oder der gerade Verstorbenen erkaltet erschreckend schnell. Zu der ganz speziellen Atmosphäre, die uns umgibt, wenn wir bei dem Toten sitzen, die Kerzen brennen, das Fenster geöffnet ist, gehört dieses Erlebnis, dass aus dem lebendigen Leib jetzt der anatomisch zergliederbare Körper wird, der uns dennoch in einer geheimnisvollen Weise „unverfügbar“ erscheinen kann.
Den Toten aufzubahren, z.B. in der Friedhofkapelle, sodass die Menschen von ihm Abschied nehmen können, ist für mich etwas ganz Wichtiges, und unbedingt sollten wir gerade die Kinder dorthin führen, sie vielleicht noch einmal die kalte Hand oder Stirn berühren lassen, ihnen etwas von der Würde des Todes mitgeben, damit nicht ihre geliebte Oma plötzlich einfach verschwunden ist oder nur als ein unbegreifliches Häuflein Asche in einer mehrminder geschmackvollen Urne anlässlich der Trauerfeier erscheint.
Das Buch
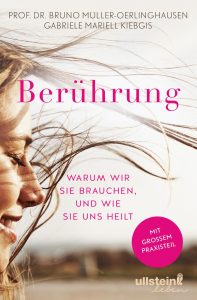 Berührung gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Ein Mangel daran kann nachweislich krank machen. Umgekehrt können Berührungen sowohl bei körperlichen als auch psychischen Erkrankungen therapeutisch eingesetzt werden. Die Haut ist das Organ, an dem unser Selbstbewusstsein, unsere Identität hängt und das über eine eigene Intelligenz verfügt. Wie kommunizieren Haut und Gehirn? Wie entsteht das Wohlgefühl einer sanften Berührung? In der Beantwortung dieser Fragen zeigt sich, wie sehr Berührungen Teil unseres biologischen Urprogramms sind. Sie sind unverzichtbar für den Erhalt unserer Gesundheit und mobilisieren als Lebenselexier unsere Selbstheilungskräfte.Ein informatives Sachbuch, das mit zahlreichen anschaulichen Fallbeispielen, praktischen Übungen und wissenswerten Tipps überzeugt.
Berührung gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Ein Mangel daran kann nachweislich krank machen. Umgekehrt können Berührungen sowohl bei körperlichen als auch psychischen Erkrankungen therapeutisch eingesetzt werden. Die Haut ist das Organ, an dem unser Selbstbewusstsein, unsere Identität hängt und das über eine eigene Intelligenz verfügt. Wie kommunizieren Haut und Gehirn? Wie entsteht das Wohlgefühl einer sanften Berührung? In der Beantwortung dieser Fragen zeigt sich, wie sehr Berührungen Teil unseres biologischen Urprogramms sind. Sie sind unverzichtbar für den Erhalt unserer Gesundheit und mobilisieren als Lebenselexier unsere Selbstheilungskräfte.Ein informatives Sachbuch, das mit zahlreichen anschaulichen Fallbeispielen, praktischen Übungen und wissenswerten Tipps überzeugt.
„Berührung“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

