Am 10. Mai 1940 wurde Winston Churchill zum Premier- und Kriegsminister von Großbritannien ernannt. Seine Entscheidung zum Kampf gegen Nazi-Deutschland veränderte das Antlitz Großbritanniens und Europas, und prägte, wie Churchill in die Geschichte einging. Wie es dazu kam? Das sei nie zufriedenstellend erzählt worden, meint Anthony McCarten. In „Die dunkelste Stunde“ unternimmt er daher den Versuch, eine gewagtere und gleichzeitig menschlichere Version der Geschichte zu erzählen.

AUSSCHNITT DES BUCHCOVERS: „Die dunkelste Stunde“ von Anthony MCCarten.
Meine eigenen Nachforschungen, die ich in Vorbereitung des Films „Die dunkelste Stunde“ und meines Buches anstellte, haben mich überzeugt, dass Winston Churchill im Mai 1940 ernsthaft die Möglichkeit eines Friedens mit Hitler erwog, so abstoßend diese Vorstellung heute auch erscheinen mag. Ich bin mir darüber im Klaren, dass dies eine unpopuläre Sicht der Dinge ist, zudem eine, die mich in Widerspruch zu fast allen Historikern, Schriftstellern und Wissenschaftlern bringt, die mit diesem Abschnitt der Geschichte weit besser vertraut sind, als ich es für mich beanspruchen kann. Ich möchte jedoch die Fakten des Falles darlegen, wie ich sie sehe, und dabei auf die vorherrschende Gegenmeinung all jener eingehen, die behaupten, Churchill habe niemals daran gedacht, den Weg von Friedensverhandlungen zu beschreiten.
Zunächst zu dieser allgemein anerkannten Behauptung. Im Grunde bedeutet sie, dass Churchill nicht meinte, was er sagte, als er nachweislich äußerte, er wäre für ein Friedensangebot »dankbar«, oder sich bereit erklärte, ein solches »in Betracht zu ziehen«. Er wollte lediglich Zeit gewinnen, spielte ein raffiniertes Spiel, meinte das Ganze nicht ernst, schwankte und wankte niemals. Wenn es seinen Kollegen im Kriegskabinett erschien, als meinte er es ernst, so die weit verbreitete Meinung, dann nur, weil er Halifax damit geschickt überlistete und ihn in einem entscheidenden Augenblick im Spiel behielt, als Halifax’ Rücktritt möglicherweise die Regierung gestürzt hätte. Dies war außerdem ein Schachzug, den er überzeugend spielen musste, um so listige und gerissene Männer wie Halifax und Chamberlain zu überzeugen. Diese Lesart hat jedoch mehrere Schwachstellen. Erstens gibt es außer einigen akademischen Mutmaßungen keinerlei Beweise dafür. Wie Christopher Hitchens feststellte, kann etwas, das ohne Beweis behauptet wird, auch ohne Beweis abgestritten werden.
Winston Churchill gab nie preis, dass alles nur ein großes Täuschungsmanöver gewesen sei. Er tat es weder damals noch nach dem Krieg, als ausreichend Zeit dafür gewesen wäre und er in Sachen Reputation dadurch noch hätte gewinnen können. Die Vorstellung, dass Winston Churchill etwas derart Fundamentales wie das gekonnte Ausmanövrieren seines Rivalen Halifax bescheiden vor der Geschichte verborgen haben soll, strapaziert unser Verständnis seiner Persönlichkeit, welche aller Definition nach stark narzisstische Züge trug. Die Enthüllung einer solchen Geschichte hätte sein mythisches Image nicht beschädigt, sondern es vielmehr verstärkt. Und wer an seinem Bestreben zweifelt, sein eigenes Vermächtnis zu kuratieren, der erinnere sich an folgenden Ausspruch: »Sämtliche Parteien werden es viel besser finden, die Vergangenheit der Geschichte zu überlassen, insbesondere, da ich beabsichtige, diese Geschichte zu schreiben.«
Das zweite Argument gegen eine Verheimlichungstheorie ist, dass sie übersieht, unter welch enormem persönlichem, politischem und militärischem Druck Churchill in dieser schweren Krise stand: Eine unmittelbar bevorstehende Invasion wurde für möglich gehalten (manche Militärberater glaubten, es sei eine Sache von Tagen), das britische Volk war ungeschützt, die Armee in Frankreich zahlenmäßig unterlegen (zehn zu eins, wenn die Truppen in Dünkirchen vollständig gerettet werden konnten, und hundert zu eins, wenn nicht), und der Zusammenbruch Europas war unter den deutschen Angriffen katastrophal schnell vonstattengegangen; zudem schienen die von Halifax vorgebrachten und von Chamberlain und anderen unterstützten Argumente rational, moralisch und vernünftig.
Dazu kam Halifax’ Rücktrittsdrohung, die dazu geführt haben muss, dass Churchill seine eigene Position noch einmal überdachte. Ein Mann wie Halifax hätte niemals gedroht, eine neue Regierung zu Fall zu bringen, wenn er nicht absolut sicher gewesen wäre, dass er recht hatte und Churchill sich irrte. Die Überzeugungen eines solchen Mannes tat man nicht leichtfertig ab. Welcher vernünftige Mensch, der unter solchem Druck steht und einen derart geringen Entscheidungsspielraum hat, würde nicht ernsthaft erwägen, Friedensgespräche der fast sicheren Vernichtung vorzuziehen? Es kommt mir so vor, als gingen alle Gegner der »Schwanken«- oder »Wanken-Theorie«, wenn wir sie einmal so nennen wollen, von einem völlig entrückten Churchill aus, einem Mann, der schreckliche Realität ignoriert und seine eigenen tragischen Fehleinschätzungen in Gallipoli oder, nur wenige Wochen zuvor, in Norwegen bereits vergessen hat. Die schmerzhafte Lektion, die Winston Churchill durch Gallipoli über sich selbst lernte, ließ ihn jedoch nie wieder los (wenngleich er versuchte, über sie hinwegzugehen, indem er sagte, er empfinde keinerlei Schuld, und später, dass er die Tapferkeit der dort gefallenen Männer bewundere). Die Geschichte hat jedoch viele Autoren.
Der Film zum Buch „Die dunkelste Stunde“ im Kino:
Eines Nachmittags im August 1915, als er gerade ein Landschaftsbild malte und sehr entspannt war, sagte Churchill zu dem Dichter und Diplomaten Wilfrid Scawen Blunt: »An diesen Händen klebt mehr Blut als Farbe.« Es war der flüchtige Ausdruck einer zerbrechlichen Psyche und ein noch seltener Einblick in seine vernarbte Menschlichkeit. Die unvermeidliche Folge von Schuld sind Selbstzweifel, und Ende Mai 1940 war Churchill gewiss von Selbstzweifeln geplagt. Wenn man sich in der Vergangenheit so sehr geirrt hat, kann man unter ähnlichen Umständen nicht noch einmal selbstsicher sein.
Der Historiker David Cannadine sagte über Churchills Charakter, er sei »gleichzeitig einfach, leidenschaftlich, unschuldig und der Täuschung und Intrige unfähig«. Wenn das der Fall war, warum sollte man ihm dann diese lang andauernde Täuschung und Intrige unterstellen, wenn es weder davor noch danach keinerlei Beleg für seine Unehrlichkeit und Intriganz gibt?
Der übliche Impuls scheint hier zu sein, dem großen Mann seine menschlich normalen Selbstzweifel zu verweigern. Es ist jedoch keine Sünde, sich mit Zweifeln zu quälen. Ich würde vielmehr behaupten, dass die Fähigkeit zum Zweifel und, im nächsten Schritt, zur Synthese gegensätzlicher Vorstellungen und einer daraus folgenden ausgewogenen Entscheidung die eigentliche Definition eines wahren Führers und wahrer Führerschaft ist. Anstatt verkürzte Stereotype zu bedienen, plädiert mein Buch daher für eine größere und komplexere Darstellung der Person Churchills. Gehen wir also einmal davon aus, dass Winston Churchill tatsächlich meinte, was er sagte, als es um diese kritischen Fragen ging, und er sehr wohl wusste, dass jedes Wort protokolliert wurde, ohne Ironie und für die Nachwelt.
Die Protokolle jener Kriegskabinett-Sitzungen Ende Mai lassen für mich keinen Zweifel: Als eine Zeitlang zu befürchten stand, dass Großbritannien 90 Prozent seiner Soldaten verlieren würde, gewann Churchill nach und nach die Überzeugung, dass es sinnvoll sei, Friedensgespräche mit Nazi-Deutschland ernsthaft in Erwägung zu ziehen, solange die britische Unabhängigkeit gesichert bliebe – so unangenehm diese Aussicht auch erschien. Er wusste, dass Hitlers Forderungen schrecklich wären: die Unterwerfung von Zentraleuropa und Frankreich unter dauerhafte Nazi-Herrschaft; hinzu käme die Rückgabe bestimmter Kolonien, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg verloren hatte. Es war ein monströses Preisschild, aber ein ausgehandelter Friede erschien immer deutlicher als Option, die einer Nazi-Invasion und einer möglichen Besatzung vorzuziehen wäre, bei welcher über dem Buckingham Palace und Westminster die Hakenkreuz-Flagge wehte. Studiert man die Worte genauer, die Churchill während dieser Mai-Debatten gebrauchte, ergibt sich ein lebhaftes Bild davon, wie seine bisherige Haltung eines Kampfes um jeden Preis stetig bröckelt und er sich für den Gedanken an Friedensgespräche erwärmt. Man erinnere sich, dass er damals nachweislich wiederholt sagte, er wolle ein Friedensabkommen »in Betracht ziehen«, er werde gerne eines »diskutieren« und wäre »dankbar«, aus der gegenwärtig misslichen Lage durch Gespräche herauszukommen, sofern essentielle Bedingungen erfüllt würden, selbst auf »Kosten einiger [britischer] Gebiete [Malta und einiger afrikanischer Kolonien]«, und (wie er dem Kriegskabinett mitteilte) auch dann, wenn dies bedeute, Hitler »die Vorherrschaft in Mitteleuropa« zuzuerkennen.
Tatsächlich (wie er vor dem Verteidigungsausschuss sagte) riet er Frankreich, einen möglicherweise angebotenen Friedensvertrag zu »akzeptieren«, sofern das Land nicht als Stützpunkt für einen Angriff auf Großbritannien genutzt würde. Chamberlain, in seiner Sprache sicherlich farbenfroher und realistischer als die staubtrockenen Aufzeichnungen des Kabinettssekretärs, notierte in sein Tagebuch, Churchill sei bereit, ein Abkommen »beim Schopfe zu packen«, solange gewisse Bedingungen erfüllt wären. Um dies zu beweisen, gestattete er die Anberaumung eines geheimen Treffens zwischen Halifax und Botschafter Bastianini am 25. Mai in London, vorausgesetzt, dass nichts davon an die Öffentlichkeit gelangte – ein Treffen, bei dem explizit die Frage eines Friedensabkommens mit Hitler besprochen wurde. Mussolini sollte bei den Verhandlungen als Vermittler Nach diesem Treffen erteilte Churchill Halifax die formale Erlaubnis, ein Memorandum an den italienischen Botschafter aufzusetzen, um die Konditionen eines Friedensvertrages weiter zu diskutieren, dessen Partner sowohl Großbritannien als auch Frankreich sein könnten.
Für jemanden, der Friedensgespräche angeblich nie ernsthaft in Betracht zog, sind das beträchtliche Zugeständnisse. Ich behaupte, dass am 27. Mai die grundlegende Uneinigkeit nicht mehr in der Frage bestand, ob es ein Friedensabkommen geben sollte, sondern wann. Churchills Überzeugung war, dass seine Regierung die besten Konditionen aushandeln könnte, wenn zunächst eine Nazi-Invasion Großbritanniens erfolgreich abgewehrt worden wäre. Halifax und Chamberlain fanden, dass es keinen besseren Augenblick als die Gegenwart gab, solange Großbritannien noch über eine Armee verfügte. Ein paar quälende und unsichere Stunden lang hing das Schicksal der Welt vom Ausgang dieses Disputs ab.
Alle großen Führer brauchen Glück – und zwar das Glück, dass die Zeiten genau ihre Fähigkeiten erfordern. Frieden war nicht Winston Churchills Sache. Er hatte eine Begabung für Krisen und ihre Benennung, für Tapferkeit und ihre Beschwörung, oft für Risiken und ihre Unterschätzung. Wo vernünftigere Männer zu Recht die Folgen ihrer Entscheidungen fürchteten, hielt er sich nicht damit auf, über mögliche negative Konsequenzen nachzudenken (dies hielt er sein Leben lang so), und tolerierte dies auch bei anderen nicht.
Wagemut ist etwas, das viele große Führer auszeichnet, doch kann er ebenso leicht zu Schimpf und Schande führen. Letztendlich kommt es darauf an, ob der jeweilige Führer recht behält. Nach vielem Hin und Her, nach Zögern und Zaudern, schlaflosen Nächten, geistiger Unordnung, nachdem er erst das eine, dann das andere gesagt hatte, den Frontenwechsel überstrapaziert hatte, in sich gegangen war, nach aufmerksamem Zuhören, Abwägen, Überdenken, Sinnieren und depressiver Sprachlosigkeit gelang es Churchill Ende Mai schließlich, Worte an die Nation zu richten, die in den Feuern tiefen Zweifels gehärtet waren, und damit auf der richtigen Seite der Geschichte zu landen. Er schaffte es.
Die Ereignisse des Mai 1940 brachten einen außergewöhnlichen Mann hervor. In jenen ersten zerbrechlichen Wochen als Premierminister – als er wie wenige neue Führer auf die Probe gestellt wurde – entdeckte er in sich selbst eigentlich erst die Führungsqualitäten, auf die er für den Rest des Krieges zurückgreifen konnte und die ihm einen Platz unter den wahrhaft Großen dieser Welt sicherten. In jenem Mai wurde Winston Churchill zu Winston Churchill.
Bei diesem Text handelt es sich um den Epilog des Buches „Die dunkelste Stunde“.
Das Buch
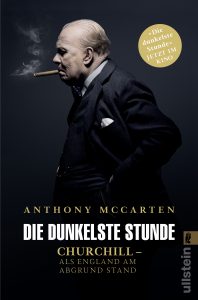 Mai 1940: Die Nazis erobern Westeuropa. In einer der dunkelsten Stunden der Weltgeschichte steht der frisch gewählte britische Premierminister Winston Churchill persönlich und politisch vor der Herausforderung seines Lebens. Soll er sich Hitler-Deutschland um eines Friedens willen annähern oder entschlossen in den Krieg ziehen? Innerhalb kurzer Zeit muss er sich entscheiden und das britische Volk auf seine Seite bringen. Anthony McCarten, Romancier und Autor der Bestseller Superhero und Licht, entwirft ein spannendes Historiendrama und zeigt, wie Winston Churchill zur Ikone eines ganzen Jahrhunderts werden konnte.
Mai 1940: Die Nazis erobern Westeuropa. In einer der dunkelsten Stunden der Weltgeschichte steht der frisch gewählte britische Premierminister Winston Churchill persönlich und politisch vor der Herausforderung seines Lebens. Soll er sich Hitler-Deutschland um eines Friedens willen annähern oder entschlossen in den Krieg ziehen? Innerhalb kurzer Zeit muss er sich entscheiden und das britische Volk auf seine Seite bringen. Anthony McCarten, Romancier und Autor der Bestseller Superhero und Licht, entwirft ein spannendes Historiendrama und zeigt, wie Winston Churchill zur Ikone eines ganzen Jahrhunderts werden konnte.
„Die dunkelste Stunde“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage.

