Hätte sie sich nach ihrem Vater gerichtet, wäre Donia Bijan Ärztin geworden. Stattdessen drückte die Mutter ihr ein One-Way-Ticket nach Paris in die Hand, wo sie sich zur Köchin ausbilden ließ. Die Küche war und ist bis heute Bijans Rückzugsort, genau wie die Literatur. In ihrem Essay erzählt die gebürtige Iranerin von der Herausforderung, ihr eigenes Restaurant in den USA zu eröffnen und von der noch größeren Herausforderung, die darauf folgte: einem Leben als Autorin.

(c) Mitchell Johnson
Man braucht ein großes Herz, um Köchin zu sein, aber ein offenes Herz, um Schriftstellerin zu sein.
Zu behaupten, ich hätte schon als kleines Mädchen davon geträumt, Köchin oder Schriftstellerin zu werden, hieße, die schlichte Tatsache zu verklären, dass ich ein schüchternes Kind auf der Suche nach einem Versteck war, in dem ich unbemerkt bleiben könnte. Schon früh lernte ich, mich in der Küche nützlich zu machen, und am glücklichsten war ich immer dann, wenn mir sinnvolle Aufgaben übertragen wurden. Wenn ich nach draußen musste, trug ich ein Buch bei mir und hielt es mir direkt vor die Nase.
An der Uni in Berkeley studierte ich französische Literatur, während ich mich eigentlich auf das Medizinstudium vorbereiten sollte. Ich hätte meinen Vater glücklich gemacht, wäre ich bei der Medizin geblieben, doch ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dass ich eine bessere Köchin als Ärztin abgeben würde. Nach meinem Abschluss drückte mir meine Mutter ein One-Way-Ticket nach Paris in die Hand, wo ich die Kochschule besuchte. Ihr Motto war: „Wenn Du das wirklich tun willst, lerne von den Besten.“ Sie war die klügste Person, die ich jemals gekannt habe.
Die Küche blieb mein Zufluchtsort. Ich sammelte Erfahrungen in den feuchten Kellern nobler Adressen, im Dickensianischen Untergrund von Fünf-Sterne-Hotels, stets in Gesellschaft blasser, hagerer, ängstlicher Jungs. Ich hielt meine Messer scharf, meinen Kopf gesenkt und meine Augen und Ohren offen. Nach langen Arbeitstagen als zuverlässige Köchin zog ich mich mit einem Buch zurück, um mich von den Verbrennungen, den Gliederschmerzen und den Tiraden des Kochs zu erholen. Wenn es mir gelang, wach zu bleiben, machte ich mir Notizen zu den Gesprächen, Rezepten, Küchenleitern, Kellnern und Gästen.
Nachdem ich mir meine Sporen verdient hatte, eröffnete ich ein eigenes Restaurant – etwas, das ein schüchterner Mensch niemals tun sollte, aber ich liebe es einfach mehr als alles andere, Menschen zu bewirten. Köchin zu sein und ein Restaurant zu führen, lässt sich mit der Arbeit in der Notaufnahme eines Krankenhauses vergleichen – man hangelt sich von Notfall zu Notfall. Wenn alles gut läuft, ist die Belohnung immens, aber die Anspannung bricht dir früher oder später das Genick. Irgendwie habe ich in diesen hektischen Tagen des Lebens oder Sterbens geheiratet und ein Baby bekommen. All diese Liebe mit ihrer wunderbaren, lodernden Kraft überwältigte mich. Ich blieb in der Küche, bis ich nicht mehr konnte. Es war Zeit, den Laden dichtzumachen.
Ich wandte mich dem Schreiben zu, aber diese neue Herausforderung ließ den Restaurantwahnsinn wie Normalität erscheinen. Man braucht ein großes Herz, um Köchin zu sein, aber ein offenes Herz, um Schriftstellerin zu sein. Ich musste lernen, aus dem Versteck zu kriechen, mich mit jedem Wort nackt und schutzlos auszuliefern – alles andere wäre eine Lüge gewesen. Ich nahm mir die Worte von Stephen King zu Herzen: „Wenn du dir vornimmst, so wahrheitsgemäß wie möglich zu schreiben, sind deine Tage als Mitglied der feinen Gesellschaft gezählt.“ Ich fand, dass in der nackten Wahrheit eine große Wärme liegt. Meine Memoiren („Maman’s Homesick Pie“), die in Wahrheit ein Liebesbrief an meine Mutter sind, wurden 2011 veröffentlicht. Beim Schreiben von „The Last Days of Café Leila“ („Als die Tage nach Zimt schmeckten“) habe ich jeden Morgen diese Zeile von Robert Frost aufgesagt: „Keine Tränen beim Autor, keine Tränen beim Leser.“
Als der Entwurf zu meinem Roman den Weg vom Gedanken in meinem Kopf zu den Worten auf dem Papier zurückgelegt hatte, drückte ich die Figuren bereits fest an meine Brust und hielt sie samt all ihrer Probleme fest umklammert. Sie gehörten mir, dachte ich, aber in Wahrheit gehörte ich ihnen. Ganz und gar ihnen. Wenn ich ihnen nicht genug Zeit widmete, um die Dinge auszuarbeiten, wenn es auch nur einen falschen Ton in einem Dialog gab, wenn ich ein Detail beschönigte oder ihren Schrecken oder ihre Vitalität falsch wiedergab, knirschten sie mit den Zähnen und rollten mit den Augen, wie die wilden Kerle aus Maurice Sendaks „Wo die wilden Kerle wohnen“. Die einzige Möglichkeit, wie ich ihnen Tag für Tag begegnen konnte, war, mich jedem einzelnen mit Liebe und Disziplin zu nähern, um sie wissen zu lassen, dass niemand seinen Platz verlässt, bis wir es genau getroffen haben.
Als der Entwurf zu meinem Roman den Weg vom Gedanken in meinem Kopf zu den Worten auf dem Papier zurückgelegt hatte, drückte ich die Figuren bereits fest an meine Brust und hielt sie samt all ihrer Probleme fest umklammert. Sie gehörten mir, dachte ich, aber in Wahrheit gehörte ich ihnen. Ganz und gar ihnen.
An manchen Tagen stauten sich die Worte wie hinter einem Damm, und eine der Figuren trat dann hervor, um mir zu helfen, Stein um Stein aus der Mauer zu brechen. An anderen Tagen strömten die Worte in alle Richtungen auseinander, und es war ein Kampf, sie wieder einzufangen. Der Weg war nie geradlinig – wie es eine Heimkehr nie ist –, sondern beschwerlich und wahrhaftig.
Für mich gibt es kein Zurück in den Iran, aber meine Figuren haben sich Wort für Wort dorthin vorgekämpft, um herauszufinden, was es heißt, zu Hause zu sein, um den Fragen der Identität und Zugehörigkeit nachzuspüren. Ich lernte, dass das Schreiben eines Romans ein Pakt zwischen Autor und Leser ist, nicht anders als das unausgesprochene Versprechen zwischen Arzt und Patient oder Koch und Speise. Zuhören ist wichtig, und technisches Können ist wahrscheinlich auch nötig. Aber nicht weniger zentral ist das Bekenntnis zum Detail, der Wunsch, sich vorzustellen, was andere fühlen oder denken. Andernfalls wird der Leser nicht bewegt, der Patient nicht geheilt, und alle gehen hungrig zu Bett.
Das Buch
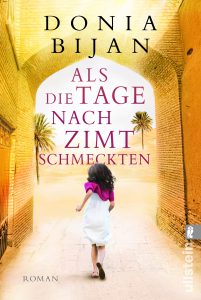 Teheran im Frühling: Jeden Tag wartet der alte Zod im Glyzinienhof vor dem Café Leila auf den Postboten. Bringt er einen Brief von seiner geliebten Tochter Noor? Endlich hat sie geschrieben. Nach 30 Jahren wird sie aus den USA in ihre verlorene Heimat zurückkehren. In die Stadt der Widersprüche, in der Schönheit und Gewalt nebeneinander existieren. In das Café Leila, in dem Noors Mutter früher alles zauberte, was die persische Küche an himmlischen Köstlichkeiten hergab. Zu ihrer Familie, die trotz aller Wärme und Liebe zerrissen wurde. Eine berührende Geschichte über eine persische Familie, die endlich wieder zusammenfindet.
Teheran im Frühling: Jeden Tag wartet der alte Zod im Glyzinienhof vor dem Café Leila auf den Postboten. Bringt er einen Brief von seiner geliebten Tochter Noor? Endlich hat sie geschrieben. Nach 30 Jahren wird sie aus den USA in ihre verlorene Heimat zurückkehren. In die Stadt der Widersprüche, in der Schönheit und Gewalt nebeneinander existieren. In das Café Leila, in dem Noors Mutter früher alles zauberte, was die persische Küche an himmlischen Köstlichkeiten hergab. Zu ihrer Familie, die trotz aller Wärme und Liebe zerrissen wurde. Eine berührende Geschichte über eine persische Familie, die endlich wieder zusammenfindet.
„Als die Tage nach Zimt schmeckten“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage
Hier geht es zu Teil 1 und Teil 3 der Essay-Kolumne von Donia Bijan.

