Im dritten Teil ihrer Essay-Kolumne berichtet Donia Bijan vom Besuch in ihrer Heimat, dem Iran, nach über 30 Jahren im amerikanischen Exil. Als sie ihren Onkel nach so langer Zeit wiedersieht, kommen Erinnerungen an ihre Kindheit in ihr hoch und sie erkennt ihren verstorbenen Vater in diesem fremd-bekannten Mann wieder.

(C) MITCHELL JOHNSON
Mein Onkel Darius ist vor ein paar Tagen gestorben. Er hatte einen Schlaganfall und brach in seinem Haus zusammen, allein. Er war in Teheran zurückgeblieben, während meine Tante nach Kanada gegangen war, um ihre Kinder und Enkelkinder zu besuchen. In besseren Zeiten hätten sie wahrscheinlich alle unter demselben Dach oder wenigstens in derselben Stadt gelebt, aber wir, ihre Kinder, ihre Nichten und Neffen, sind wie Samen im Ausland ausgestreut worden, um uns vor der Tyrannei zu retten.
Wie sehr ich seine Nase berühren, die Worte, die aus seinem Mund purzelten, in ein Einmachglas einschließen wollte, um es später wie eine Muschel an mein Ohr zu halten, wenn ich meinen Vater vermisste.
Das letzte Mal sah ich meinen Onkel bei einem kurzen Besuch im Iran nach 32 Jahren im Exil. Ich kehrte vaterlos, mutterlos, im mittleren Alter, als Fremde zurück. Aber er schloss mich in seine Arme wie die fünfzehnjährige Nichte, die er 1978 zuletzt gesehen hatte. Was mich bis ins Mark erschütterte, war seine Stimme. Er war der kleine Bruder meines Vaters, ihre Stimmen ähnelten einander sehr. Als er meinen Namen – meinen Kosenamen „Dony Joon“ – aussprach, brach es mir das Herz. Er wirkte kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Er besaß die Hakennase meines Vaters, und ich konnte meine Augen nicht von ihr lassen. Mein Vater war 1997 gestorben, aber seine Züge lebten in diesem Mann, den ich so sehr mochte, der neben mir saß und Tee trank, wobei seine Nase der Tasse den Weg zu seinen Lippen versperrte, auf mysteriöse Weise fort. Er sprach mit der gleichen Betonung auf bestimmte Vokale, im liebenswürdigen Akzent des Nordiran – ganz wie mein Vater, wenn er mir Ratschläge erteilte. Als seine Frau ihn unterbrach, zog er eine Miene, die besagte: „Lass mich ausreden!“ „Ja, lass ihn“, dachte ich. Wie sehr ich seine Nase berühren, die Worte, die aus seinem Mund purzelten, in ein Einmachglas einschließen wollte, um es später wie eine Muschel an mein Ohr zu halten, wenn ich meinen Vater vermisste.
Ich kehrte nach Kalifornien zurück, aber ich konnte diese intensive Begegnung nicht abschütteln, dieses Gefühl, etwas so wertzuschätzen. „Dony Joon“, hallte es in meinen Ohren nach. Welch ein Trost, zu wissen, dass ein Stück meines Vaters, seine Stimme, noch in meinem Onkel lebte.
Als sie aufwuchsen, blieben diese beiden Brüder in der Nähe, heirateten und füllten ihre Häuser mit Kindern und leerten sie dann, als einer gezwungen war, mit seiner Familie auszuwandern, und einer beschloss, zu bleiben und dafür seine Kinder ins Ausland zu schicken. Einer ist auf einem Friedhof in Kalifornien begraben, und einer wurde heute in Teheran begraben. Die Welt ist aus den Fugen geraten, Leben sind zerstört, Familien zerrissen worden, Väter sterben allein, Söhne und Töchter sind haltlos. Wir versuchen, unsere Eltern stolz zu machen, wir geben uns Mühe, manchmal gelingt es uns, wir passen uns an, wir ziehen Kinder groß, die ihre Großeltern vielleicht nie kennenlernen, und nur selten bemuttern wir unsere Mütter oder pflegen sie, wenn sie krank werden. An einem Aprilnachmittag nimmt die schreckliche Nachricht ihren Weg über die Telefone und erreicht mich beim Leichtathletikwettkampf meines Kindes. Auf einen Schlag schwingt das Pendel zurück zur Straße, in der ich aufgewachsen bin. Ich weiß genau, wo er zusammengebrochen ist. Ich weiß, wie das Telefon in dem Haus klingelt. Ich kenne den Klang dieses unbeantworteten Summtons. Ich weiß all das in 7.000 Meilen Entfernung.
Welch ein Trost, zu wissen, dass ein Stück meines Vaters, seine Stimme, noch in meinem Onkel lebte.
Meine Tante nahm den ersten Flug nach Hause. Nach Hause, welches Zuhause? Ohne Ehemann, ohne Kinder und Enkelkinder ist es ein Witwennest, in das die Hinterbliebene auf der Suche nach ihrem Partner zurückkehrt – sein Mantel noch am Haken bei der Tür, seine Uhr auf der Kommode, eine morgendliche Teetasse im Spülbecken. Sie wird den Kessel aufsetzen. Sie wird am Küchentisch Platz nehmen und ihren Tee trinken, bitter und süß, und sie wird die Zeit absitzen, bis ihre Kinder sie eines Tages in den Westen rufen. Und dann wird es keine Spuren des Lebens mehr in diesem Haus geben, keine Bilder, keine Bettwäsche, keine Teetassen, keine Stimmen unserer Väter. Sie wird nie wiederkommen.
So viele von uns werden den Vatertag ohne ihre Väter begehen. Nicht alle von ihnen sind von dieser Welt verschwunden. Noch nicht. Einige sind nicht in der Lage, eine Grenze zu überschreiten, um ihre Familien zu erreichen, andere liegen im Heim, wieder andere haben sich entfremdet. Was haben wir gegenüber unseren Vätern schließlich für Pflichten? Uns rechtzeitig von ihnen zu verabschieden? Sonntagnachmittags anzurufen? Sich an den Geburtstag zu erinnern oder daran, dass sie keine Krawatten mehr tragen, seit ihre Hände zu zittrig geworden sind, um sich einen Knoten zu binden? In ihre Fußstapfen zu treten? Geduld mit unseren Kindern zu haben, wenn sie lernen, ihre Schnürsenkel zu binden oder Auto zu fahren? Oder ist es einfach, auf diese uns innewohnende Stimme zu hören? Die Stimme der Vorsicht, die Stimme der Weisheit und der Liebe, die uns versichert, dass wir geschätzt werden, manchmal vielleicht auf unvollkommene Weise, aber eben doch geschätzt.
Das Buch
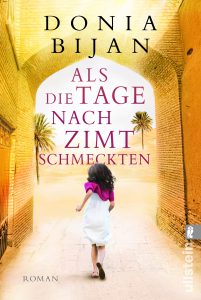 Teheran im Frühling: Jeden Tag wartet der alte Zod im Glyzinienhof vor dem Café Leila auf den Postboten. Bringt er einen Brief von seiner geliebten Tochter Noor? Endlich hat sie geschrieben. Nach 30 Jahren wird sie aus den USA in ihre verlorene Heimat zurückkehren. In die Stadt der Widersprüche, in der Schönheit und Gewalt nebeneinander existieren. In das Café Leila, in dem Noors Mutter früher alles zauberte, was die persische Küche an himmlischen Köstlichkeiten hergab. Zu ihrer Familie, die trotz aller Wärme und Liebe zerrissen wurde. Eine berührende Geschichte über eine persische Familie, die endlich wieder zusammenfindet.
Teheran im Frühling: Jeden Tag wartet der alte Zod im Glyzinienhof vor dem Café Leila auf den Postboten. Bringt er einen Brief von seiner geliebten Tochter Noor? Endlich hat sie geschrieben. Nach 30 Jahren wird sie aus den USA in ihre verlorene Heimat zurückkehren. In die Stadt der Widersprüche, in der Schönheit und Gewalt nebeneinander existieren. In das Café Leila, in dem Noors Mutter früher alles zauberte, was die persische Küche an himmlischen Köstlichkeiten hergab. Zu ihrer Familie, die trotz aller Wärme und Liebe zerrissen wurde. Eine berührende Geschichte über eine persische Familie, die endlich wieder zusammenfindet.
„Als die Tage nach Zimt schmeckten“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage
Hier geht es zu Teil 1 und Teil 2 der Essay-Kolumne von Donia Bijan.

