Viele LeserInnen greifen zum historischen Roman, um sich in frühere Epochen einzufühlen. Christian Pantle zeigt, dass geschichtliche Ereignisse sich genauso gut wie eine moderne Reportage beschreiben lassen, inklusive O-Töne der damals Beteiligten. Ein Plädoyer dafür, den Verstorbenen eine Stimme zu geben – und die Vergangenheit näher heranzuholen, ohne ins Fiktive abzugleiten.

Szene aus der Schlacht bei Nördlingen 1634. Gemälde von Mikel Olazabal, 2012.
Wenn Leser sich in frühere Epochen hineinfühlen möchten, greifen sie oft zu historischen Romanen – viel öfter als zu Sachbüchern. Weshalb beschäftigen sich die meisten lieber mit Erfundenem als mit Realem? Ein entscheidender Punkt ist, dass ein guter Roman die vergangene Welt anschaulich schildert und uns teilhaben lässt an den (fiktiven) Gedanken und Gefühlen der Protagonisten. Sachbücher dagegen sind nicht so nah an den Ereignissen und Personen dran, erzählen aus größerer innerer und äußerer Distanz. Sie gelten daher – oft nicht zu Unrecht – als eher trockene Kost. Dabei lassen sich viele geschichtliche Ereignisse auf ähnliche Weise erzählen wie eine aktuelle Reportage. Die Protagonisten kommen dabei selbst zu Wort und teilen dem Leser ihre Gedanken und Gefühle direkt mit.
Für mein aktuelles Buch „Der Dreißigjährige Krieg. Als Deutschland in Flammen stand“ führte ich dazu gleichsam Interviews mit den Toten – indem ich deren Tagebücher und persönliche Aufzeichnungen ausgewertet habe. Im Fall der Plünderung des Klosters Andechs durch schwedische Soldaten im Mai und Juni 1632 liest sich das Ergebnis beispielsweise so:
Nach Abzug der Schweden kehrten Maurus Friesenegger und die anderen Klosterbewohner – gut 30 Mönche plus Novizen und Bedienstete – nach Andechs zurück. Mehr als drei Wochen waren seit ihrer Flucht vergangen, und die Heimkehrer sahen ein Kaleidoskop des Vandalismus. „Das Gotteshaus war voll Gestank und Pferdemist, auf den Altären Überbleibsel von Futter, die Opferstöcke alle zerbrochen, und die Grabstätte des Stifters geöffnet. Jedoch waren die Altäre und deren Bildnisse alle unverletzt, ausgenommen das Bildnis des heiligen Rasso, das verstümmelt und mit Kot befleckt außerhalb des Gotteshauses gefunden wurde“, berichtet unser Mönch. „Übrigens war im ganzen Kloster eine abscheuliche Verwüstung. Keine ganze Tür, kein Schloss, kein Kasten, kein Schrank, kein Fenster, das nicht zerbrochen war.“

Maurus Friesenegger (1590-1655). Porträt von 1650.
Das Zitat stammt aus den Aufzeichnungen des Mönchs Maurus Friesenegger, der zusammen mit dem Söldner Peter Hagendorf Hauptprotagonist meines Buchs ist. Beide führten über mehr als 20 Kriegsjahre hinweg Tagebuch. Und sie waren nicht die einzigen Autoren aus dem einfachen Volk: Bauern, Handwerker, Soldaten und Gottesleute haben uns aus dem Dreißigjährigen Krieg persönliche Aufzeichnungen in einer nie dagewesenen Fülle hinterlassen. Im Gegensatz zu den meisten früheren Kriegen kennen wir damit nicht nur die Berichte und die Sichtweise von oben – von Feldherren, Gebildeten, Adeligen –, sondern erhalten erstmals auch einen umfangreichen Blick auf die Ereignisse von unten, von den Tätern vor Ort ebenso wie von den wahren Leidtragenden.
Aus den Tagebuchaufzeichnungen habe ich Auszüge entnommen und so in meinen Buchtext integriert, wie ich es mit Gesprächsaufzeichnungen von lebenden Interviewpartnern tun würde. Und wie ich bei einem aktuellen Artikel die Richtigkeit der zitierten Statements möglichst mittels anderer Quelle überprüfe, kontrollierte ich auch die Aussagen der Tagebuchautoren. Streiften tatsächlich schwedische Truppen zur beschriebenen Zeit in der Region um Andechs herum? Das ist klar zu bejahen: Die nahe Stadt München ergab sich im Juni 1632 dem Schwedenkönig Gustav II. Adolf. Ob dessen Soldaten das Kloster Andechs tatsächlich so verwüsteten, ist hingegen nicht anderweitig überprüfbar. Hier lasse ich Frieseneggers Aussage unkommentiert stehen. Ich persönlich halte sie für glaubwürdig, überlasse es aber dem Leser, sich seine eigene Meinung zu bilden.
Die damalige Ausdrucks- und Schreibweise habe ich dabei nicht eins zu eins übernommen, sondern behutsam in das jetzige Deutsch übersetzt. Denn die Texte aus jener Zeit überzieht inzwischen eine Patina, wie es treffend Reinhard Kaiser formulierte, der 2009 die hoch gelobte Übersetzung des „Simplicissimus Deutsch“ aus dem 17. Jahrhundert herausbrachte. Viele damals gebräuchliche Wörter und Redewendungen sind in Vergessenheit geraten oder haben sich so gewandelt, dass sie unverständlich oder missverständlich sind. Oder sie vermitteln dem modernen Leser, der kein historischer Fachmann ist, einen falschen Eindruck.

Das Kloster Andechs
Wenn etwa ein Flugblatt nach Wallensteins Tod „die schröckliche Mordthat“ beklagt, dürften viele heutige Leser unwillkürlich schmunzeln. Denn jetzt gebrauchen wir das Wort „schröcklich“ nur noch scherzhaft. Und wir verzeihen keine Rechtschreibfehler: Wer diese begeht, wird oftmals belächelt (obwohl man um Legasthenie weiß). Daher reagieren wir auf alte Texte, in denen ein Wort mal so und mal anders geschrieben ist, unwillkürlich ein wenig herablassend. Dabei hat man damals einfach keinen Fetisch um die Rechtschreibung betrieben – ob nun „gantz Herzlich“ oder „ganz hertzlich“ dastand, war den damaligen Autoren und Lesern wohl recht egal. Nicht auf den einzelnen Buchstaben kam es an, sondern auf den Inhalt.
Was trifft daher den ursprünglichen Sinn besser? „Die schröckliche Mordthat“ oder „der schreckliche Mord“? Ich denke, dass eine Überführung ins jetziges Deutsch den Inhalt der Botschaft klarer zutage treten lässt. Sie entfernt gleichsam die Patina, die den Text überdeckt.
Allerdings geht durch jedes Übersetzen auch ein Stück der ursprünglichen Bedeutung verloren. Daher gibt es nie eine perfekte Lösung, nur ein stetes Abwägen zwischen Beibehalten und Modernisieren, immer wieder mit Inkonsequenzen. So habe ich den damals neutralen Begriff „Weib“, der inzwischen eine Bedeutungsverschlechterung erfahren hat, in die heute neutrale „Frau“ überführt. Aber den Begriff „Untertan“ belassen, obwohl auch der inzwischen einen viel negativeren Beiklang besitzt – spätestens seit Heinrich Manns gleichnamigem Roman. Damals war der Untertan so gebräuchlich und neutral wie jetzt sein modernes Pendant in der Arbeitswelt, der Mitarbeiter. Doch „Mitarbeiter“ trifft den eigentlichen Sinn ebenso wenig wie „Regierter“ oder „Untergebener“. Daher galt hier wie bei anderen Zweifelsfällen: Der Untertan bleibt der Untertan.
Überlange Erklärungen, komplizierte Schachtelsätze und redundante Formulierungen habe ich gekürzt, indem ich die benötigten Sätze oder Satzteile mit Hilfe von Einfügungen wie „…, berichtet der Mönch, …“ aneinandergereiht habe. Wichtig dabei war mir: Die Passagen innerhalb von Anführungszeichen sind ungekürzt aus den Aufzeichnungen der Zeitzeugen übernommen. Der Leser erhält hier also keine modernen Nacherzählungen, sondern tatsächliche Zitate, echte Aussagen der damaligen Täter und Opfer. Nichts schlägt das Original.
Das Buch
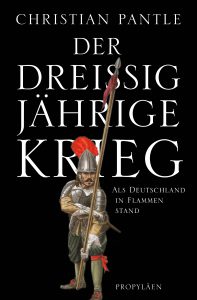 Wie erlebten die Menschen vor 400 Jahren Tod, Vertreibung und Barbarei? Christian Pantle eröffnet uns Einblicke in eine der schrecklichsten und folgenreichsten Tragödien der Menschheit. Wir folgen dem Söldner Peter Hagendorf, der tausende von Kilometern quer durch Deutschland und Mitteleuropa marschiert, und fühlen mit dem Mönch Maurus Friesenegger, der in seinen Aufzeichnungen anschaulich das Leid der Zivilbevölkerung schildert. So entsteht ein lebendiges, vielschichtiges Panorama, das vor allem zeigt: Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt setzen selbst in den dunkelsten Zeiten eindrucksvolle Zeichen der Menschlichkeit.
Wie erlebten die Menschen vor 400 Jahren Tod, Vertreibung und Barbarei? Christian Pantle eröffnet uns Einblicke in eine der schrecklichsten und folgenreichsten Tragödien der Menschheit. Wir folgen dem Söldner Peter Hagendorf, der tausende von Kilometern quer durch Deutschland und Mitteleuropa marschiert, und fühlen mit dem Mönch Maurus Friesenegger, der in seinen Aufzeichnungen anschaulich das Leid der Zivilbevölkerung schildert. So entsteht ein lebendiges, vielschichtiges Panorama, das vor allem zeigt: Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt setzen selbst in den dunkelsten Zeiten eindrucksvolle Zeichen der Menschlichkeit.
„Der Dreißigjährige Krieg“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage


[…] Er lässt dadurch die Menschen zu Wort kommen, die vor 400 Jahren gelebt haben. Im Verlagsblog Resonanzboden beschreibt er eindrucksvoll seine […]