Deutschland gilt momentan als einer der zuverlässigsten Partner des Vereinigten Königreichs. Nun droht der Brexit wirtschaftliche wie kulturelle Bindungen zu beeinflussen. Jan Rüger nimmt Großbritanniens Austritt aus der EU zum Anlass, die deutsch-britischen Beziehungen im Kontext ihrer Geschichte zu beleuchten und geht dabei zurück ins 19. und 20. Jahrhundert.

Jetzt, da Großbritannien sich aufmacht, die Europäische Union zu verlassen, kommt den deutsch-britischen Beziehungen eine Schlüsselrolle zu. Kein anderes Land dürfte für den Ausgang der Verhandlungen wichtiger sein als Deutschland, einer der zuverlässigsten Partner des Vereinigten Königreichs in den vergangenen Jahren. Wie haben wir uns dieses Verhältnis also vorzustellen, das das moderne Europa geprägt hat? Für den Versuch, eine Antwort darauf zu finden, ist es sinnvoll, das 19. und 20. Jahrhundert im Zusammenhang zu betrachten. Wir haben uns an ein Narrativ gewöhnt, das die Phase vor dem Ersten Weltkrieg als bloße Folie nutzt, auf deren Grundlage die Geschichte eines wachsenden Antagonismus erzählt wird, eine dramatische Verschiebung von Freundschaft hin zu Feindschaft. Allerdings waren Großbritannien und Deutschland im Viktorianischen Zeitalter weder in umfassender Weise alliiert, noch miteinander in Konflikt: Aus politischer Sicht waren sie weder Freunde noch Feinde.
Zu Bismarcks und Salisburys Zeiten handelte es sich um eine Partnerschaft, die sowohl Abhängigkeit als auch Distanz ausdrückte: Abhängigkeit, weil London und Berlin grundlegende Interessen teilten und erfolgreich zusammenarbeiteten; Distanz, weil sie nicht in der Lage waren, ein formelles Abkommen abzuschließen, das die deutsch-britischen Beziehungen im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf eine langfristigere Grundlage gestellt hätte. Was in den Jahrzehnten vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs geschah, war keine unausweichliche Verschiebung hin zu einer Feindschaft, sondern eine Intensivierung sowohl der Kooperation als auch des Konflikts. Während sich im öffentlichen Diskurs das Bild zweier Staaten verfestigte, die einander – durch die Nordsee getrennt – verfeindet gegenüberstehen, hatten Großbritannien und Deutschland ein bis dato noch nie da gewesenes Ausmaß gegenseitiger Abhängigkeit erreicht. Der Wohlstand beider Nationen war aneinander gebunden: Durch den Handel mit dem jeweils anderen und die Zusammenarbeit auf den internationalen Märkten florierten sowohl das edwardianische Großbritannien wie auch das wilhelminische Deutschland. Ein dichtes Netz gegenseitiger Verbindungen knüpfte beide nicht nur ökonomisch, sondern auch durch unzählige kulturelle und wissenschaftliche Aktivitäten aneinander, die das Ingenieurwesen, Bildung, Forschung, Verlagswesen, Architektur, Musik und Literatur umfassten. Zwar führten das Flottenwettrüsten und eine Reihe diplomatischer Fehlschläge im Jahrzehnt vor 1914 zu einer neuen Sprache der Feindschaft, aber das änderte nichts an der grundlegenden gegenseitigen Abhängigkeit beider Nationen. Im Gegenteil: Auf der Höhe des politischen Konflikts waren sie enger denn je miteinander verbunden.
Anhaltspunkte für unser Verständnis der jüngsten Veränderung in den deutsch-britischen Beziehungen finden wir eher in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als in der traumatischen Phase der beiden Weltkriege. Beide Staaten charakterisiert auch heute wieder ein hohes Maß gegenseitiger Abhängigkeit. Wirtschaftlich und kulturell sind das Vereinigte Königreich und Deutschland enger miteinander verbunden als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der jüngeren Geschichte. Vor allem – und das ist der Hauptunterschied zum 19. Jahrhundert – gilt das auch in geopolitischer Hinsicht: Beide Staaten sind enge Partner in einer von den USA dominierten globalen Allianz. Die Europäische Union hat diese politische Partnerschaft auf ein weites Spektrum an Strukturen übertragen, die die Verflechtung der britischen und deutschen Gesellschaft erleichtert haben. All das hat die Koexistenz und Interdependenz so selbstverständlich werden lassen, dass es jüngeren Generationen schwerfällt, sich bewusst zu machen, wie sehr die deutsch-britische Vergangenheit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Konflikt und Gewalt geprägt war.
Es bleibt abzuwarten, ob der britische Austritt aus der Europäischen Union die Bande, die das Vereinigte Königreich und Deutschland miteinander verbinden, lösen wird. Entscheidend wird am Ende sein, inwieweit die britische Regierung sich dazu gezwungen sieht, jene Freizügigkeit einzuschränken, von der sowohl ihre eigenen als auch die anderen EU-Bürger in den vergangenen Jahrzehnten so stark profitiert haben. Nichts hat die deutsch-britischen Beziehungen im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte so durchgehend beeinflusst wie die Tatsache, dass sich Menschen unentwegt zwischen den deutsch- und englischsprachigen Teilen Europas hin- und her bewegt haben. Wenn es etwas gibt, das sich aus der Entwicklung der deutsch-britischen Beziehungen in den letzten zweihundert Jahren lernen lässt, dann Folgendes: Genau wie Deutschland nicht in der Lage ist, das zunehmend unberechenbarere Europa zu kontrollieren, wird Großbritannien nicht in der Lage sein, ihm zu entfliehen.
Das Buch
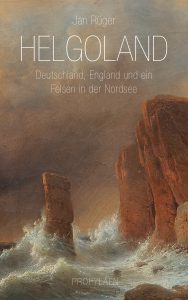 Die großen Umbrüche einer Epoche, ihre bestimmenden Ideen, Revolutionen und Kämpfe zeigen sich nicht nur in den Schaltzentralen der Macht – manchmal zeichnen sich die großen Linien der Geschichte gerade im Kleinen besonders deutlich ab. In der Geschichte der Nordseeinsel Helgoland verdichtet sich die Vergangenheit Europas wie an kaum einem anderen Ort. Helgoland lag stets zwischen den Welten: zwischen England und Deutschland, zwei Ländern im Taumel des Nationalismus, im Kampf um die europäische Vorherrschaft und zugleich im fruchtbaren geistigen Austausch. Als englischer Widerstandsposten gegen Napoleon, als Sehnsuchtsort deutscher Schriftsteller und Künstler, als kaiserliche Seefestung oder als Hitlers Wacht in der Nordsee: Immer war Helgoland nicht nur Schauplatz konkreter Geschichte, sondern auch Projektionsfläche für die Weltanschauungen der Zeit. Mal galt die Insel als Rückzugsort der freien Denker, mal als Verkörperung des Militarismus.
Die großen Umbrüche einer Epoche, ihre bestimmenden Ideen, Revolutionen und Kämpfe zeigen sich nicht nur in den Schaltzentralen der Macht – manchmal zeichnen sich die großen Linien der Geschichte gerade im Kleinen besonders deutlich ab. In der Geschichte der Nordseeinsel Helgoland verdichtet sich die Vergangenheit Europas wie an kaum einem anderen Ort. Helgoland lag stets zwischen den Welten: zwischen England und Deutschland, zwei Ländern im Taumel des Nationalismus, im Kampf um die europäische Vorherrschaft und zugleich im fruchtbaren geistigen Austausch. Als englischer Widerstandsposten gegen Napoleon, als Sehnsuchtsort deutscher Schriftsteller und Künstler, als kaiserliche Seefestung oder als Hitlers Wacht in der Nordsee: Immer war Helgoland nicht nur Schauplatz konkreter Geschichte, sondern auch Projektionsfläche für die Weltanschauungen der Zeit. Mal galt die Insel als Rückzugsort der freien Denker, mal als Verkörperung des Militarismus.
Die trotzig-pragmatischen Inselbewohner verfolgten stets Ihre eigenen Interessen, wurden aber schließlich doch zum Spielball im Wettbewerb der Großmächte.
„Helgoland“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

