Vor vierzig Jahren fand der RAF-Terror im Deutschen Herbst seinen Höhepunkt. Katrin Burseg nahm die Ereignisse als Ausgangspunkt für einen Roman. Hier macht sie sich Gedanken über die bedrückende Aktualität einer Tragödie, die ihren Ursprung in der studentischen Protestbewegung und im Namen der Menschlichkeit hatte.

Foto: RAF-Bombenanschlag in Ramstein am 3. August 1981.
Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof, Christian Klar und andere – Namen, die Geschichte schrieben, eines der dunkleren Kapitel in der jüngeren deutschen Geschichte.
Die Fakten sind bekannt: Vor vierzig Jahren erlebte der Terror der Roten Armee Fraktion im Deutschen Herbst seinen Höhepunkt. Die Erstürmung der entführten Lufthansa-Maschine Landshut in der Nacht zum 18. Oktober 1977 setzte eine Spirale der Gewalt fort, an deren Ende die Ermordung des verschleppten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer und die Todesnacht von Stammheim standen.
Doch wie Schreiben von jener rohen Gewalt und der Herausforderung für die Demokratie? Den Ausnahmezustand jener Tage und Wochen erlebte ich als knapp sechsjähriges Kind wohl nicht bewusst, dennoch erinnere ich mich noch gut an die Fahndungsplakate in Schwarzweiß, die damals in Bank- und Postfilialen oder Telefonzellen hingen. Darauf die ausdruckslosen Gesichter der Protagonisten der ersten und zweiten RAF-Generation. Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof, Christian Klar und andere – Namen, die Geschichte schrieben, eines der dunkleren Kapitel in der jüngeren deutschen Geschichte.
Auch bin ich mir sicher, das Bild des entführten Hanns Martin Schleyer zum ersten Mal im Oktober 1977 in einer Tagesschau-Sendung gesehen zu haben, während ich geborgen auf dem Schoß meines Vaters saß. Die Jahre vergehen und weitere Bilder kommen hinzu, gesprengte und verkohlte Limousinen, Tote, von weißen Leichentüchern bedeckt. Karl Heinz Beckurts, Gerold von Braunmühl, Alfred Herrhausen und Detlev Karsten Rohweddder sowie viele weniger prominente fallen den Gewalttätern zum Opfer. Drei Terroristen-Generationen bomben und morden im Namen einer nur schwer verständlichen Utopie. Vierunddreißig Menschen müssen sterben, viele andere werden zum Teil schwer verletzt. Eine Katastrophe, die ihren Ausgang in der studentischen Protestbewegung und im Namen der Menschlichkeit nahm.
„Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte“, erklärte die Rote Armee Fraktion bei ihrer Auflösung im April 1998. Doch die Auseinandersetzung mit den Gewaltverbrechen ist noch nicht zu Ende. Da ist die Stimme der Gewalt, die nachhallt, und da ist das fortdauernde Schweigen, in das sich all jene hüllen, die noch da sind. Die im Gefängnis sitzen oder im Untergrund leben und wissen, was geschehen ist. Bis heute sind einige Morde und Verbrechen nicht aufgeklärt, weigern sich die Täter, eine individuelle Verantwortung zu übernehmen.
Da ist die Stimme der Gewalt, die nachhallt, und da ist das fortdauernde Schweigen, in das sich all jene hüllen, die noch da sind.
Wie schwer wiegt die Last des Schweigens? Und wie verändert sich der Blick auf die Ereignisse von damals im Lauf der Geschichte? Diese Fragen beschäftigen mich in meinem Roman „In einem anderen Licht“. Dorothea Sartorius, reiche Witwe und Stifterin eines Preises für Zivilcourage, wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. War sie in ihrer Jugend Mitglied einer linksextremen Gruppierung und hat sie den Tod dreier Menschen zu verantworten? Mehr als vierzig Jahre hat Sartorius geschwiegen, doch nun ist sie bereit zu sprechen. „Fragen Sie!“, fordert sie die Journalistin Miriam Raven auf. Doch je mehr Miriam über Dorotheas Leben erfährt, desto stärker reift in ihr die Erkenntnis heran, dass man eine Geschichte nicht nur von ihrem katastrophalen Ende her betrachten kann. Miriam muss sich fragen, was schwerer wiegt – Dorotheas Vergangenheit im Umfeld der RAF oder ihre Wandlung zur vielbeachteten Stifterin und Wohltäterin.
Kein zeithistorischer Roman also, sondern ein zweiter Blick auf die Ereignisse, eingewoben in eine Geschichte von Liebe und Trauer, Anfang, Ende und Neubeginn. Ganz bewusst habe ich für meinen Roman nach einem Ort und Zeitpunkt gesucht, die das Geschilderte möglich erscheinen lassen, ohne dass sie sich konkret in die Landkarte des RAF-Terrors einfügen. Und ganz bewusst habe ich mein Schreiben dem Gedanken untergeordnet, dass die Wahrheit bisweilen nur eine Sache der Vorstellungskraft ist. Kein Richtig oder Falsch also, sondern vielmehr die Auseinandersetzung damit, was Wahrheit im Leben, in der Erinnerung und auch in der Fiktion bedeutet. Und wie sich Erkenntnis vermittelt.
Wie aktuell das Thema nach wie vor ist, zeigt die Gegenwart mit dem Terror unserer Tage. Die Radikalisierung junger Menschen ist bedrückende Realität. Und wie vor vierzig Jahren so bestimmt auch heute der öffentliche Diskurs über die Gewalt alle anderen politischen und sozialen Motive und Themen. Die Debatte über den islamistischen Terrorismus und die Reaktionen darauf überdeckt jedes Nachdenken über die kritischen Fragen, die diesem Terror vielleicht vorausgehen. Dennoch: In diesen Tagen gedenke auch ich der Opfer des RAF-Terrors. Terror ist in einem Rechtsstaat keine Lösung für Probleme. Er ist durch nichts zu rechtfertigen.
Der Deutsche Herbst
5. September 1977
In Köln wird Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer verschleppt. Sein Fahrer und drei Polizeibeamte sterben im Kugelhagel. Die Entführer fordern die Freilassung von elf gefangenen RAF-Mitgliedern.
13. Oktober 1977
Die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt ist nicht zu einem Gefangenenaustausch bereit. Mit der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut versuchen die mit der RAF verbündeten Terroristen der palästinensischen Volksfront PFLP den Druck auf die deutsche Regierung zu erhöhen.
18. Oktober 1977
Nach einer Odyssee des entführten Flugzeugs durch die arabische Welt und der Ermordung des Flugkapitäns Jürgen Schumann landen die Entführer auf dem Flughafen der somalischen Hauptstadt Mogadischu. In der Nacht zum 18. Oktober wird das Flugzeug gegen 0.30 Uhr durch die Antiterroreinheit GSG 9 gestürmt. Um 0.38 Uhr vermeldet der Deutschlandfunk, dass „alle Geiseln befreit sind“. Kurz danach begehen die in Stuttgart-Stammheim inhaftierten RAF-Terroristen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan Carl Raspe Selbstmord. Irmgard Möller überlebt schwerverletzt.
19. Oktober 1977
Als Reaktion auf die Befreiung der Lufthansa-Maschine wird Hanns Martin Schleyer von seinen Entführern erschossen. Seine Leiche wird im Kofferraum eines Wagens im französischen Mühlhausen gefunden. Bis heute ist der Name des Mörders nicht bekannt.
Das Buch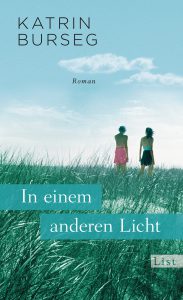
Miriam erhält seltsame Briefe. Die Absenderin beschuldigt ausgerechnet Dorothea Sartorius, die Stifterin eines Preises für Zivilcourage, sie vor vielen Jahren verraten zu haben. Miriam ignoriert die Briefe, schließlich ist sie dabei, die Preisverleihung vorzubereiten. Doch die Anschuldigungen lassen ihr keine Ruhe. In einem Kloster an der Schlei erfährt sie Dorotheas Geheimnis. In der Nähe von Schleswig war während der Olympischen Spiele 1972 ein Anschlag geplant.
„In einem anderen Licht“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage

