Am Mittwoch startet die Frankfurter Buchmesse 2018 – nach Aussage der Veranstalterinnen und Veranstalter ein „Ort politischer Auseinandersetzung und Meinungsfreiheit“. Wer sich ans Vorjahr erinnert, weiß, dass dies auch auf rechte bis rechtsextreme Verlage zutrifft. Nikola Roßbach erklärt in ihrem Buch „Achtung, Zensur!“ ob und wann eine Institution sich gegen die Zulassung bestimmter Inhalte und Parteien aussprechen kann und weshalb es 2017 zum Messe-Skandal kam.

Frankfurter Buchmesse I (c) flickr I ActuaLitté I CC BY-SA 2.0
Gesellschaftliche Debatten über Sagbarkeitsgrenzen und Zensur haben in der letzten Zeit durch verschiedene Ereignisse Zündstoff erhalten. Zu diesen Ereignissen gehörte auch die Frankfurter Buchmesse 2017. Schon lange versteht sich die Frankfurter Buchmesse selbst als politisches Event, nicht nur als Handelsumschlagplatz für Bücher und andere Medien. In einer Pressemitteilung vom 10. Oktober ist die Rede von einem »Ort politischer Auseinandersetzung und Meinungsfreiheit«. Die Buchmesse sei »mehr denn je ein Forum, auf dem das Weltgeschehen reflektiert wird und Autoren und politische Aktivisten eine Bühne für ihr Anliegen finden«. Tatsächlich erwies sich gerade die Frankfurter Buchmesse 2017 als Bühne für politische Aktivisten – und zwar in einem Sinne, der in dem zitierten Statement sicherlich nicht gemeint war. Einen Tag vor der Eröffnung gab sich Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, in seinem Plädoyer für demokratischen Diskurs kampflustig: »Wir liberal-demokratisch gesinnten Büchermenschen müssen in Zeiten, in denen giftige Narrative Hochkonjunktur haben und die Verbreitung von Angst und Hass wieder gesellschaftsfähig wird, mit attraktiveren Gegenentwürfen antworten […]. Die Frankfurter Buchmesse bringt Menschen zusammen, die eine Vielzahl von unterschiedlichen Meinungen vertreten. Sie ist deshalb bestens dazu geeignet, leidenschaftliche Diskussionen und Auseinandersetzungen zu beherbergen.«
Das Argument pro rechte Verlagspräsenz auf der Buchmesse war die Meinungsfreiheit, und das wurde immer wieder bekräftigt.
Leidenschaftlich ging es tatsächlich zu. Lesungen mussten wegen Pfeif- und Brüllkonzerten abgebrochen werden, es kam zu Handgemengen und Handgreiflichkeiten. Was war der Grund für die Eskalationen in den Messehallen? Der Stein des Anstoßes: 2017 präsentierten sich zum ersten Mal auch einige rechte bis rechtsextreme Verlage mit Ständen und Autorenlesungen in Frankfurt. Linke Proteste führten zu Tumulten, die Messe hatte am letzten Tag ihren handfesten Skandal. Nach dem roch es aber bereits lange vorher. Denn schon vor der Veranstaltung hatte die Zulassung von neurechten Verlagen für öffentliche Empörung in Medien und sozialen Netzwerken gesorgt. Eine Empörung, die im Nachhinein noch einmal bekräftigt wurde: Wie konntet ihr bloß den neuen Rechten eine solche Bühne bieten? Wieso habt ihr sie überhaupt eingeladen?
Die Buchmesse verwahrte sich zu Recht dagegen, diese Verlage eingeladen zu haben. Sie verwies, ebenso wie etliche Journalisten, darauf, dass Verlage keine Einladung zur Messe erhielten, sondern sich selbst anmelden müssten. Man hätte eben höchstens diese Anmeldungen nicht akzeptieren können. Hat man aber. Der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Alexander Skipis, der im Online-Newsletter des Börsenvereins die Haltung der Veranstalter verteidigte, erklärte die umstrittene Entscheidung so: »Auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren sich in diesem Jahr auch einige rechte bis rechtsextreme Verlage. Im Sinne der Meinungsfreiheit, die für uns nicht relativierbar ist, lassen wir diese Auftritte zu.«
Das Unternehmen Frankfurter Buchmesse hat sich Werte wie Toleranz, Offenheit, Vielfalt und Solidarität auf die Fahne geschrieben und lehnt Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ausdrücklich ab.
Das Argument pro rechte Verlagspräsenz auf der Buchmesse war also die Meinungsfreiheit, und das wurde immer wieder bekräftigt: »Der Börsenverein tritt aktiv für die Meinungsfreiheit ein. Das bedeutet, dass wir Verlage oder einzelne Titel, die nicht gegen geltendes Recht verstoßen, nicht von der Frankfurter Buchmesse ausschließen. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir das Gedankengut, das solche Verlage verbreiten, gutheißen.« Auch Messedirektor Boos verkündete, eine Buchmesse könne Aussteller nicht aus politischen Gründen ausschließen, und ihm schlossen sich viele abwägende Stimmen aus Medien und Öffentlichkeit an: Die Buchmesse habe keine Wahl gehabt.
Wenn man Verlage ausschlösse, die nicht strafrechtlich auffällig geworden seien, schrieb die taz, sei das tatsächlich Zensur, und auch die Süddeutsche Zeitung riet denjenigen, die die Zulassung rechter Aussteller zur Messe kritisierten, zu einem »Blick ins Grundgesetz«: »Man kann einen Stand nur verbieten, wenn er sich strafrechtlich schuldig macht.«
Das trifft allerdings nicht zu. Das Meinungsfreiheitsargument gilt hier höchstens in einer schwachen Lesart, nicht in einer starken. Denn die Frankfurter Buchmesse GmbH ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, Tochtergesellschaft des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Sie ist keine staatliche Institution, und Ausschlusspraktiken wie die zur Debatte stehende stellen daher zumindest keine Zensur im verfassungsrechtlichen Sinne dar. Das Unternehmen Frankfurter Buchmesse hat sich Werte wie Toleranz, Offenheit, Vielfalt und Solidarität auf die Fahne geschrieben und lehnt Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ausdrücklich ab. Aus diesen Gründen hätte es sich legitimerweise gegen die Zulassung von rechten Verlagen zu ihrer Veranstaltung entscheiden dürfen.
So einfach ist die Buchmesse also nicht aus der Nummer raus: Sie musste neurechte Aussteller nicht zulassen. Sie wollte. Und dies aus guten Gründen. Sie wollte einen offenen Diskurs, sich »aktiv mit der Präsenz dieser Verlage auseinandersetzen«, und dabei für die eigenen Werte eintreten, wie Skipis erklärte. Mit Rechten reden gewissermaßen, nicht nur ein auf der Buchmesse diskutierter Titel, sondern in gewissem Sinne auch ihr Programm im Herbst 2017. Ein Programm, das gründlich schiefging. Es redeten die Fäuste und die Trillerpfeifen. Sicher stand außer der proklamierten Diskursbereitschaft der Messeveranstalter noch ein anderes, ebenso nachvollziehbares Motiv hinter der Entscheidung, nämlich die Kontraproduktivität eines Ausschlusses der Rechten. Das Journal Frankfurt brachte es in einem Kommentar auf den Punkt: »Ein Ausschluss rechtskonservativer, nationalistischer oder rechtsextremer Verlage wäre ohnehin Wasser auf die Mühlen der öffentlich geschickt agierenden rechten Verlage gewesen, Stichwort: Selbstviktimisierung.« Es wäre ein großer, von rechter Seite ausgeschlachteter Zensurskandal geworden, wenn die weltgrößte Fachmesse für Publishing bestimmte Verlage ohne strafrechtliche Gründe von der Ausstellung ausgeschlossen hätte. Apropos von rechter Seite ausgeschlachteter Zensurskandal: Zu dem kam es sowieso.
Die verfeindeten Lager gerieten aneinander, hinzu kamen Beschädigungen rechter Verlagsstände von links und körperliche Gewalt gegen einen linken Verleger von rechts. War das etwa die ›aktive Auseinandersetzung‹, die die Buchmesse beabsichtigt hatte und die der Börsenverein mit seinem ausdrücklichen Hinweis auf die neurechten Verlage mit genauen Standortangaben und Lesungsterminen angeregt hatte? Sicher nicht. Die Situation auf der Frankfurter Buchmesse 2017 ist aus dem Ruder gelaufen – und im Nachhinein versuchten alle Beteiligten möglichst schnell, die Deutungshoheit über die Ereignisse zu bekommen. Von rechts wurden die verhinderten Lesungen reflexartig als ›Zensur‹ beklagt, ›freie Rede‹ sei unmöglich gemacht worden, auf der Buchmesse habe Meinungs- und Gesinnungsdiktatur stattgefunden – Stichwort: Selbstviktimisierung …
So einfach ist die Buchmesse nicht aus der Nummer raus: Sie musste neurechte Aussteller nicht zulassen. Sie wollte.
Nur wenige Tage nach Ende der Buchmesse erschien in den Medien ein Appell mit dem wahrhaft vollmundigen Titel »Charta 2017«. Initiatorin war eine pegidanahe Dresdener Buchhändlerin. Die immer gleiche Gesinnungsdiktatur-Leier, die in dieser sogenannten Charta gespielt wird, sei hier nicht erneut wiederholt. Bemerkenswert erscheint mir vielmehr die erste Leserreaktion, die sich unter dem offenen Brief der Dresdnerin auf SZ- online findet. Ich bin mir nicht sicher, ob eine wirkliche Person dahintersteht oder vielleicht ein social bot – so maßgeschneidert, so modellhaft angepasst an die neurechte Ideologie erscheint dieser Kommentar: »Respekt. Es gibt noch Persönlichkeiten, welche sich dem immer mehr ausufernden Gesinnungsterror der selbsternannten Eliten entgegenstellen. Es bleibt dennoch die Angst, dass nach Political Correctness der Bücherscheiterhaufen kommt. Und mehr.« Wenn hinter diesen Worten eine reale Person steht, dann hat die rechtspopulistische Propaganda bei ihr jedenfalls auf ganzer Linie gewirkt. Gefühle von Unsicherheit, Angst und Abgehängtsein werden mit Verfolgungswahn und Abgrenzung kompensiert. Eine Gemengelage, die folgerichtig in Zensurpolemik mündet.
Und wie reagierte man von links auf den Buchmessen-Eklat? Man tadelte vor allem die schlechten Strategien der linken Akteurinnen und Akteure im Umgang mit den Rechten bzw. mit der in Frankfurt versammelten »Crème de la Crème des neudeutschen Opferkultes«, wie die Süddeutsche Zeitung treffend schrieb. Man hätte sich nicht provozieren lassen sollen. Lieber, so ließen sich die optimistischen Aufklärer hören, hätte man die Rechten im Diskurs entlarven sollen. Mit Rechten reden … da war es wieder.
Das Buch
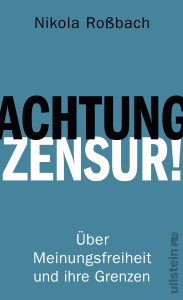 Die klassische Zensur, wie sie der Staat in Diktaturen und Autokratien auch heute noch durchsetzt, ist im modernen Rechtsstaat überwunden. Dennoch ist in Deutschland eine hochemotionale Debatte um die Meinungsfreiheit entbrannt. Die Literaturwissenschaftlerin Nikola Roßbach analysiert die kontroverse Diskussion um das Sagbare und legt ihre unterschwelligen Mechanismen offen. Sie fordert eine Zensurdebatte, die über Polemiken und effektheischende Extrempositionen hinausgeht. Der offene demokratische Diskurs ist hierzulande nicht mehr vom Staat bedroht. Die Gefahr kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Wer sind die neuen Feinde der Meinungsvielfalt? Und was müssen wir ihnen entgegenhalten?
Die klassische Zensur, wie sie der Staat in Diktaturen und Autokratien auch heute noch durchsetzt, ist im modernen Rechtsstaat überwunden. Dennoch ist in Deutschland eine hochemotionale Debatte um die Meinungsfreiheit entbrannt. Die Literaturwissenschaftlerin Nikola Roßbach analysiert die kontroverse Diskussion um das Sagbare und legt ihre unterschwelligen Mechanismen offen. Sie fordert eine Zensurdebatte, die über Polemiken und effektheischende Extrempositionen hinausgeht. Der offene demokratische Diskurs ist hierzulande nicht mehr vom Staat bedroht. Die Gefahr kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Wer sind die neuen Feinde der Meinungsvielfalt? Und was müssen wir ihnen entgegenhalten?
„Achtung, Zensur!“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage.

