Wie verändert sich der Blick auf die eigene Familie, wenn man über sie schreibt? Tom Saller spricht im Interview über die Recherche zu seinem Bauhaus-Roman „Wenn Martha tanzt“, zu dem ihn die Geschichte seiner Großmutter Martha inspirierte.

Ursprünglich sind Sie Psychotherapeut von Beruf. Wie sind Sie dazu gekommen, einen Roman zu schreiben?
Als Psychotherapeut habe ich viel mit Sprache zu tun. Über die Jahre habe ich mir angewöhnt, sehr stark auf meine Worte zu achten und bei meinen Patienten u.a. ein sogenanntes Reframing anzuwenden. Bei meinem Therapieansatz gibt es zum Beispiel kein gut oder schlecht, es gibt nur gut und weniger gut – das ist ganz wichtig für die Menschen, um ein besseres Selbstbild zu entwickeln.
Dabei geht es aber vor allem um gesprochene Worte. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Als Teenager habe ich regelmäßig Gedichte und Songtexte geschrieben. Durch mein Medizinstudium ist das Schreiben jedoch erst einmal in Vergessenheit geraten. Erst nach der Geburt meiner Söhne habe ich wieder begonnen, eigene Texte zu schreiben. Da ist auf der Gefühlsebene etwas in mir passiert, das ich unbedingt in Worte fassen wollte. Erst habe ich nur kurze Vignetten geschrieben, dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das Spiel mit Worten macht. Es gibt ein Zitat von James N. Frey, das in etwa so lautet: „Schreibe den Roman, den du am liebsten selber lesen willst.“ Das habe ich getan; es war eine Art Superheldenthriller. Dieser erste Roman wurde zwar nicht verlegt, stellte jedoch einen wichtigen Türöffner dar. Das war vor ungefähr fünf Jahren, und seither habe ich nicht mehr aufgehört zu schreiben.
In Ihrem Roman geht es um einen jungen Mann, der die Aufzeichnungen seiner Urgroßmutter Martha findet und daraufhin beginnt, ihre Geschichte auf seine Weise aufzuschreiben. In Ihren Anmerkungen erwähnen sie, dass die Geschichte Ihrer Großmutter als Inspiration für den Roman diente.
Meine Großmutter hieß Martha und ist, genau wie die Martha in meinem Roman, in Pommern geboren und ging auf ein Musikinternat. Ansonsten war sie aber eine sehr einfache Frau, die ihr ganzes Leben nicht vom Bauhaus oder von einem der Künstler dort gehört hat. Sie war auch keine Tänzerin, geschweige denn jemals in Amerika.
Für jeden von uns ist die eigene Großmutter eine ältere Frau, da man sie so kennengelernt hat. Wie verändert sich der Blick auf die eigene Familie, wenn man sich in Lebensphasen vertieft, in denen die eigenen Vorfahren im selben Alter sind wie man selbst?
In vorliegendem Fall hat es eine Art Generationenumkehr gegeben, da ich, der „Alte“, über Martha, „die Junge“, geschrieben habe. Dadurch ist sie mir unendlich nahegekommen und sehr modern und gegenwärtig geworden. Ich habe sie gewissermaßen „abgestaubt“, ihre Falten wegretuschiert und zum Vorschein gekommen ist eine junge lebenslustige Frau, die ich sehr gerne „in echt“ kennengelernt, mit der ich ebenso gerne gemeinsam studiert hätte und mit der ich ganz bestimmt um die Häuser gezogen wäre. Und gewissermaßen habe ich mir diesen Wunsch ja erfüllt. Ein Roman ist da zuweilen wie die gute Fee, der man das Begehrte in Auftrag gibt!
Der Erzähler in Ihrem Roman hat anfangs Zweifel, ob es rechtmäßig ist, wenn er sich die Leerstellen in der Geschichte Marthas selbst „erdenkt“. Hatten Sie ähnliche Zweifel beim Schreiben?
Anfangs hatte ich überhaupt keine Zweifel, da war ich voller ungehemmtem Enthusiasmus. Dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen, die im Roman stark fiktionalisiert vorkommen. Auf einmal habe ich mich gefragt, was mein Vater wohl zu der Passage sagt, in denen der Romanvater den jungen Erzähler allein nach Amerika reisen lässt, weil er selbst mit verborgenen Ängsten zu kämpfen hat. Oder meine Mutter, die ich im Roman zur Lehrerin mache. Denkt sie nun, dass das mein Wunschbild von ihr ist? Und dann war da noch der Rest meiner Verwandtschaft, der meinen Roman plötzlich sehr ernstnahm und mich fragte, was ich da eigentlich über die „echte“ Martha schreibe.
Während ich schreibe, zeige ich niemandem etwas. Ich frage auch niemanden um Rat, deshalb konnte ich die Reaktionen nicht einschätzen. Nach einer meiner letzten Lesungen kam meine Familie jedoch auf mich zu, um mir zu sagen, dass es ihnen gefällt, wie ich Marthas Leben weitererzähle.
Sie fragen niemanden um Rat? Wie sieht das in Hinblick auf die vielen historischen Fakten in Ihrem Roman aus? Haben Sie sich diesbezüglich während des Schreibens rückversichert?
Ich hätte natürlich zu Recherchezwecken vorher in Weimar anrufen und mich über die historischen Hintergründe zum Bauhaus informieren können. Ich arbeite jedoch lieber suggestiv aus einer Idee heraus und schotte mich daher lieber ganz ab.
Sie waren nie in Weimar?
Doch, aber erst sehr spät, als der Roman so gut wie fertig war. Da bin ich sämtliche Schauplätze abgelaufen. Zuvor habe ich die für mich maßgeblichen historischen Fakten im Internet recherchiert, oder habe – ganz „old school“ – in Büchern nachgeschaut.
Wie sind Sie bei Ihren Figuren vorgegangen? Einige von ihnen (Walter Gropius, Johannes Itten, Gertrud Grunow) beruhen auf realen historischen Personen. Wie haben Sie sich in diese Menschen eingefühlt? War hier ihr Beruf als Psychotherapeut hilfreich?
Ja, das war sicherlich hilfreich und unvermeidlich. Meinen Therapeutenblick kann ich gar nicht abstellen. Vielleicht bilde ich es mir ein, aber oft meine ich zu spüren, wie jemand tickt. Beruflich sehe ich mich in der Lage, nach wenigen Minuten festzustellen, ob jemand narzisstische oder depressive Züge hat. Über die historischen Persönlichkeiten, die in meinem Roman vorkommen, habe ich viel gelesen. Da können ein oder zwei Schlüsselworte oder Schlüsselsätze reichen, um sich ein – subjektives – Bild zu machen.
Bei Walter Gropius war es allerdings sehr schwierig, überhaupt etwas herauszufinden, da habe ich wirklich gestaunt. Die einzige umfassende Biographie, auf die ich gestoßen bin, war vergriffen, und erst jetzt, zum Bauhausjubiläum, sind ein oder zwei Biographien von ihm veröffentlicht worden, die ich im Nachhinein gerne schon damals gelesen hätte. Andererseits konnte ich ihn auf diese Weise genau so beschreiben, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
Martha wird im Roman zur Muse einiger berühmter Künstler wie Klee und Kandinsky. Was unterscheidet sie von anderen Frauen zu jener Zeit? Welche Wirkung hat sie auf andere?
Ich habe Martha so angelegt, dass sie tatsächlich eher „uncool“ ist und überhaupt nicht in das progressive Studentenleben am Bauhaus passt. Sie kommt vom Land, ist neugierig, fröhlich, geradlinig …
Und ein wenig naiv.
Absolut! Martha ist absolut kein Groupie – wenn sie einen Schlemmer oder Kandinsky klasse findet, dann nur, weil sie merkt, dass das ein toller Mensch ist. Auf der anderen Seite ist sie aber auch sehr stur und stark, sie lässt sich in nichts hereinreden. Sie hat eine Familie, die hinter ihr steht und eine besondere Begabung, die sie um jeden Preis weiterentwickeln möchte. Wie die Entwicklung des Romans zeigt, ist ihre weitere Lebensgeschichte dann ja auch die einer sehr starken Frau. Sie wird alleinerziehende Mutter, eröffnet eine Tanzschule, flieht aus Deutschland und beginnt ein neues Leben in den USA. Und sie wird über 100 Jahre alt – Martha ist zäh!
Sie ist eine ungewöhnliche Frau für diese Zeit und eine begnadete Ausdruckstänzerin, das imponiert den Menschen um sie herum. Als Vorbild für Martha diente mir Gret Palucca, die Kandinsky bei seinen „Tanzkurven“ Model stand.
Martha hat eine besondere Begabung. Sie kann Musik „sehen“. Haben Sie diese Begabung selbst schon einmal bei jemandem erlebt?
Nein, soweit ich weiß, gibt es eine solche Begabung nicht. Ich habe sie zumindest bislang bei niemandem erlebt.
Wie sind Sie dann auf diese Idee gekommen?
Ich wollte in erster Linie über Musik schreiben. Oder vielmehr: Ich wollte etwas Besonderes über Musik schreiben. Synästhesie, also die Kunst, Farben zu sehen, ist meiner Meinung nach, ein schon recht abgegriffenes Thema. Die Vorstellung, dass jemand durch die Musik beginnt, Formen zu sehen, fand ich sehr spannend.
Stand zu dem Zeitpunkt bereits fest, dass die Geschichte am Bauhaus spielen soll?
Das war eine Kausalkette. Nachdem ich mich dazu entschieden hatte, über Musik und Formen zu schreiben, fragte ich mich: wo schickst du eine junge Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts hin, die sich künstlerisch weiterentwickeln will? Da fällt einem im ersten Moment natürlich sofort Berlin ein, aber das wollte ich nicht, weil es so viele Autoren machen. Also habe ich Martha nach Weimar geschickt. Und dann ist bei der Recherche etwas Tolles passiert: Ich hatte mir überlegt, dass Martha ihr Formensehen durch den Tanz zum Ausdruck bringen könnte und stieß dabei auf die Person der Gertrud Grunow, die am Bauhaus genau diese Theorie ausgeführt und niedergeschrieben hat.
Das müssen Sie sich mal vorstellen! Da denkt man sich etwas so vermeintlich Unwahrscheinliches aus und stellt fest, dass jemand aus einem anderen Jahrhundert dieselbe Idee gehabt hat. Bei meiner Recherche lernte ich, dass Gertrud Grunow einen sehr guten Ruf gehabt hat. Die Leute sind teilweise ihretwegen ans Bauhaus gekommen, um von ihr zu lernen. Wenn man sie googelt, findet man jedoch so gut wie nichts. Deshalb freut es mich sehr, dass ich ihr mit meinem Roman ein kleines Denkmal setzen konnte. Ähnlich wie die Figur der Ella Held, fand ich auch Gertrud Grunow so spannend, dass ich einen ganzen Roman nur über sie hätte schreiben können.
Über Martha heißt es an einer Stelle im Roman: „Sie will so sein wie Ella und sich gleichzeitig von ihr unterscheiden.“ Wofür steht Ella, wofür Martha? Wie würden Sie die Beziehung der beiden beschreiben?
Die Beziehung zwischen Martha und ihrer sechzehn Jahre älteren Freundin Ella ist eine quid pro quo-Geschichte. Sie profitieren voneinander. Martha profitiert von Ellas Lebenserfahrung und ihrem Pragmatismus. Ella ist Avantgarde. Die echte Ella Held war eine der ersten Meisterfotografinnen überhaupt, das ist historisch belegt. Im Umkehrschluss profitiert Ella von Martha, diesem unverbrauchten Mädel vom Lande, von ihrer Lebensfreude und ihrer Direktheit. Die beiden ergänzen sich also sehr gut – für einen kurzen Moment sogar auf erotischer Ebene.
Was Ella betrifft, muss ich sagen, dass ich hier ein klein wenig ein schlechtes Gewissen habe. Ich bin davon überzeugt, die historische Ella ist eine tolle Frau gewesen, und ich habe ihr eine Nazi-Geschichte angehängt. Wenn mir da die Familie böse wäre, könnte ich das sogar gut nachvollziehen.
Warum haben Sie es dann gemacht?
Ich brauchte einen Kontra-Part zu Martha und wollte auf subtile Art und Weise den Nationalsozialismus in die Geschichte hereinbringen. Es hatte also rein strategische Gründe. Über Ella konnte ich gut die Figur des Adolf Bartels transportieren, mit dem sie eine Beziehung eingeht. So hat der Roman auch eine politische Ebene bekommen. Am Ende des Romans zeigt sich, dass die fiktive Ella mit den Nazis nach Argentinien ging. So brauchte ich hier keinen ganzen Geschichtsroman mehr zu schreiben. Diese wenigen Sätze reichen aus, so hoffe ich wenigstens, die Phantasie des Lesers zu beflügeln. Ansonsten habe ich in den Anmerkungen zum Roman sehr deutlich gemacht, dass jener Teil von Ellas Biographie reine Erfindung ist.
Vielen Dank für das Interview.
Das Interview führte Marie Krutmann
Das Buch
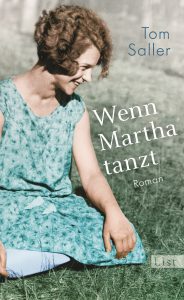 Ein junger Mann reist nach New York, um das Notizbuch seiner Urgroßmutter Martha bei Sotheby’s versteigern zu lassen. Es enthält bislang unbekannte Skizzen und Zeichnungen von Feininger, Klee, Kandinsky und anderen Bauhaus-Künstlern. Martha wird 1900 als Tochter des Kapellmeisters eines kleinen Dorfes in Pommern geboren. Von dort geht sie ans Bauhaus in Weimar – ein gewagter Schritt. Walter Gropius wird auf sie aufmerksam, Martha entdeckt das Tanzen für sich und erringt so die Bewunderung und den Respekt der Bauhaus-Mitglieder. Bis die Nazis die Kunstschule schließen und Martha in ihre Heimat zurückkehrt. In ihrem Arm ein Kind und im Gepäck ein Notizbuch von immensem Wert – für sie persönlich und für die Nachwelt. Doch am Ende des Zweiten Weltkriegs verliert sich auf der Flucht Marthas Spur.
Ein junger Mann reist nach New York, um das Notizbuch seiner Urgroßmutter Martha bei Sotheby’s versteigern zu lassen. Es enthält bislang unbekannte Skizzen und Zeichnungen von Feininger, Klee, Kandinsky und anderen Bauhaus-Künstlern. Martha wird 1900 als Tochter des Kapellmeisters eines kleinen Dorfes in Pommern geboren. Von dort geht sie ans Bauhaus in Weimar – ein gewagter Schritt. Walter Gropius wird auf sie aufmerksam, Martha entdeckt das Tanzen für sich und erringt so die Bewunderung und den Respekt der Bauhaus-Mitglieder. Bis die Nazis die Kunstschule schließen und Martha in ihre Heimat zurückkehrt. In ihrem Arm ein Kind und im Gepäck ein Notizbuch von immensem Wert – für sie persönlich und für die Nachwelt. Doch am Ende des Zweiten Weltkriegs verliert sich auf der Flucht Marthas Spur.
„Wenn Martha tanzt“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage.

