Große Sonnenbrille, Zigarette, lockere Pose, fester Blick. Die Netflix-Doku Die Mitte wird nicht halten hat es unlängst bewiesen: Joan Didion ist eine wahre Ikone, die mit ihrem Wesen und ihrem Werk als Vorbild zahlreicher SchriftstellerInnen dient. In ihren literarischen Reportagen und Essays untersucht sie den Wandel Amerikas und die Umbrüche ihrer Zeit. Gemeinsam mit ihrem Mann fuhr Didion in den 1970ern durch die Südstaaten der USA. An Orte, die für sie sowohl Vergangenes als auch Zukünftiges im Lande verkörpern. „Süden und Westen“ ist eine Sammlung ihrer Notizen auf dieser Reise, die – wie all ihre Erzählungen – noch heute von brennender Aktualität sind. Eine (Wieder-)Entdeckung lohnt sich.

Niemand schreibt wie Joan Didion.
John und ich lebten auf der Franklin Avenue in Los Angeles. Ich hatte dem Süden noch einmal einen Besuch abstatten wollen, also flogen wir 1970 für einige Monate hin. Wir hatten vor, mit New Orleans anzufangen, und danach hatten wir keinen Plan. Wir folgten dem, was der Tag mit sich brachte. In der Erinnerung scheint es mir, als wäre John gefahren. Ich war seit 1942/43 nicht mehr hier gewesen, als mein Vater in Durham in North Carolina stationiert gewesen war, aber es schien sich nicht sehr verändert zu haben. Damals hatte ich gedacht, es könnte ein Artikel daraus werden.
In New Orleans ist die Luft im Juni schwer von Sex und Tod, kein brutaler Tod, aber Tod durch Verfall, Überreife, Verrotten,Tod durch Ertrinken, Ersticken, Fieber unbekannter Herkunft. Das Dunkel dieses Ortes ist körperlich, dunkel wie das Negativ eines Fotos, dunkel wie eine Röntgenaufnahme: die Atmosphäre absorbiert ihr eigenes Licht, reflektiert das Licht nie, sondern saugt es auf, bis jeder beliebige Gegenstand mit morbidem Schimmer leuchtet. Oberirdische Grüfte beherrschen oft die Ausblicke. In der hypnotisierend flüssigen Atmosphäre verlangsamt sich jede Bewegung zu einer Choreographie, alle Menschen auf der Straße bewegen sich, als wären sie Teil eines gefährlichen Amalgams, und zwischen den Lebenden und den Toten scheint es nur einen technischen Unterschied zu geben.
Eines Nachmittags sah ich, wie eine Frau auf der St. Charles Avenue starb, wie sie nach vorn auf das Lenkrad ihres Autos fiel. »Tot«, verkündete eine alte Frau, die neben mir auf dem Gehweg stand, nur eine Armlänge entfernt von dort, wo das Auto gegen einen Baum gefahren war. Nachdem der Rettungsdienst gekommen war, folgte ich der alten Frau durch das wässrige Licht des Parkhauses vom Pontchartrain Hotel in ein Café. Der Tod hatte etwas Ernstes und zugleich Beiläufiges gehabt, wie in einer Stadt aus der Zeit vor Columbus, wo der Tod vorausgesetzt wurde und auf lange Sicht keine große Bedeutung hatte.
»Wer hat Schuld«, sagte die alte Frau zu der
Kellnerin des Cafés, die Stimme schleppend.
»Niemand ist schuld, Miss Clarice.«
»Sie können nichts dafür, nein.«
»Sie können überhaupt nichts dafür.«
Ich dachte, sie sprachen vom Tod, aber sie sprachen vom Wetter.
»Richard arbeitete in der Station, und er sagte mir, dass sie für das, was über das Radar hereinkommt, nichts können.«
Die Kellnerin machte eine Pause, wie um das Folgende zu betonen.
»Sie können dafür einfach nicht verantwortlich gemacht werden.«
»Können sie nicht«, sagte die alte Frau.
»Es kommt über das Radar herein.«
Die Worte hingen in der Luft. Ich schluckte ein Stück Eis hinunter.
»Und wir kriegen es«, sagte die alte Frau nach einer Weile.
Das war ein Fatalismus, der, wie ich feststellte, zu diesem bestimmten Sound des Lebens von New Orleans gehörte. Bananen verfaulten und beherbergten Vogelspinnen. Das Wetter kam über das Radar herein und war schlecht. Kinder bekamen Fieber und starben, häusliche Streits endeten in Messerstechereien, der Bau von Autobahnen führte zu Bestechung und gesprungenem Asphalt, durch den die Ranken wieder neu austrieben. Staatsaffären drehten sich um Eifersucht in sexuellen Belangen, in New Orleans wie in Port-au-Prince, und die Männer des Königs attackierten den König. Die Zeitlichkeit des Ortes hat etwas Opernhaftes, Kindhaftes, der Fatalismus ist der einer Kultur, die von der Wildnis bestimmt wird. »Wir wissen nur«, sagte die Mutter von Carl Austin Weiss auf dem Flur des Staatskapitols von Louisiana in Baton Rouge über den Sohn, der vor kurzem auf Huey Long geschossen und ihn getötet hatte, »dass er das Leben ernst nahm.«
Zufällig war es jemand aus Louisiana, der mir das Kochen beibrachte, so dass ich daran gewöhnt war, dass sich die Männer eifrig mit Rezepten und Essen beschäftigten. Wir lebten mehrere Jahre lang zusammen, und ich glaube, wir verstanden einander am besten, als ich versuchte, ihn mit einem Küchenmesser umzubringen. Ich erinnere mich daran, dass ich ganze Tage damit verbrachte, mit N. zu kochen, wahrscheinlich die angenehmsten Tage, die wir miteinander hatten. Er zeigte mir, wie man Hühnchen brät, eine Füllung aus braunem Reis für Geflügel zubereitet und Endivie, gemischt mit Knoblauch und Zitronensaft, hackt, und er brachte mir bei, alles mit Tabasco, Worcestershire-Soße und schwarzem Pfeffer abzuschmecken. Das erste Geschenk, das er mir je machte, war eine Knoblauchpresse und das zweite auch, weil ich die erste zerbrach. Eines Tages an der Ostküste waren wir stundenlang damit beschäftigt, Krabbencremésuppe zu machen, und stritten uns dann darüber, wie viel Salz nötig war, und weil er seit mehreren Stunden Sazerac-Cocktails trank, schüttete er Salz in die Suppe, um sein Argument zu bekräftigen. Es schmeckte wie gepökelt, aber wir taten, als wäre es in Ordnung. Das Huhn auf den Boden werfen oder die Artischocke. Krabbenbrühe kaufen. Endlos die Möglichkeiten eines Artischocken-Austern-Auflaufs diskutieren. Nachdem ich geheiratet hatte, rief er mich immer noch an, manchmal wegen Rezepten.
Ich nehme an, du denkst, das ist ein besseres Gerät als dieses Spaghettifresserteil. Ich nehme an, du denkst, du hättest Platten aus Redwood-Holz in deinem Hof. Ich nehme an, du denkst, deine Mutter wäre Vorsitzende von County Cookie gewesen. Ich nehme an, du denkst, ich brauche eine Menge Platz in einem kleinen Bett. Ich nehme an, du denkst, Schraffts hat Schokoladenblätter. Ich nehme an, du denkst, Mr Earl »Elbow« Reum hat mehr Charakter als ich. Ich nehme an, du denkst, in Nevada gibt es keine Lesben. Ich nehme an, du denkst, du wüsstest, wie man Pullover mit der Hand wäscht. Ich nehme an, du denkst, du würdest von Mary Jane schikaniert und dass die Leute dir schlechten Whisky servieren. Ich nehme an, du denkst, du hättest keine bösartige Anämie. Nimm die Vitamine. Ich nehme an, du denkst, Südstaatler sind ein bisschen unzeitgemäß.
(…)
Ende 1942, Anfang 1943 war ich zum ersten Mal im Süden. Mein Vater war in Durham stationiert, in North Carolina, und meine Mutter, mein Bruder und ich fuhren mit mehreren langsamen und überfüllten Zügen, um ihn dort zu besuchen. Zu Hause in Kalifornien hatte ich nachts geweint, ich hatte abgenommen, ich hatte meinen Vater gewollt. Ich hatte mir den Zweiten Weltkrieg als eine Bestrafung vorgestellt, die speziell dazu entworfen worden war, mich meines Vaters zu berauben, hatte meine Fehler aufgelistet und fand mich mit einer Egozentrik schuldig, die damals an Autismus grenzte und die mich noch immer in meinen Träumen, im Fieber und in der Ehe heimsucht.
Was die Reise betrifft, erinnere ich mich hauptsächlich daran, dass mir ein Seemann, der gerade auf der Wasp im Pazifik torpediert worden war, einen silbernen Türkisring gab und dass wir unseren Anschluss in New Orleans verpassten, kein Zimmer fanden und eine Nacht wach auf der überdachten Veranda des St. Charles Hotels verbrachten, mein Bruder und ich in zueinander passenden Seersucker-Sommeranzügen und meine Mutter in einem marineblau und weiß karierten Seidenkleid, das von der Reise staubig war. Sie deckte uns mit dem Nerzmantel zu, den sie vor der Hochzeit gekauft hatte und bis 1956 trug. Wir nahmen den Zug anstelle des Autos, weil meine Mutter das Auto einige Wochen vorher in Kalifornien einer Bekannten geliehen hatte, die es vor Salina in einen mit Salat beladenen LKW gefahren hatte, eine Tatsache, derer ich mir sicher bin, weil sie in den Reden meines Vaters immer noch Groll verursacht, bis heute. Zum letzten Mal hörte ich es meinen Vater vor einer Woche erwähnen. Meine Mutter reagierte nicht, legte nur die nächste Patience.
In Durham hatten wir ein Zimmer mit Mitbenutzung der Küche im Haus eines laizistischen Priesters, dessen Kinder den ganzen Tag dicke Brotscheiben mit Apfelbutter aßen und ihren Vater, wenn wir dabei waren, »Pastor Caudill« nannten. Abends brachte Pastor Caudill fünf oder sechs Literbecher Pfirsicheis mit nach Hause, und er, seine Frau und die Kinder saßen auf der Vorderveranda und löffelten Pfirsicheis aus den Bechern, während wir in unserem Zimmer lagen, unserer Mutter beim Lesen zusahen und auf Donnerstag warteten.
Donnerstag war der Tag, an dem wir den Bus zur Duke-Universität nehmen konnten, die das Militär übernommen hatte, und den Nachmittag mit meinem Vater verbrachten. Er kaufte uns in der Studentenvereinigung eine Coca-Cola, zeigte uns den Campus und machte Schnappschüsse von uns, die jetzt ich habe und die ich mir von Zeit zu Zeit anschaue: zwei kleine Kinder und eine Frau, die mir ähnlich sieht, sitzen an der Lagune, stehen am Wunschbrunnen, die Schnappschüsse immer überbelichtet oder unscharf und jeder einzelne jetzt verblasst. Dreißig Jahre später bin ich sicher, dass mein Vater auch die Wochenenden mit uns verbracht haben muss, aber offenbar sind mir seine Anwesenheit in dem kleinen Haus, seine Anspannung, seine aggressive Ausstrahlung und die Tatsache, dass er das Würfelspiel dem Essen von Pfirsicheis vorzog, so potentiell störend vorgekommen, dass alle Erinnerung an die Wochenenden getilgt ist.
An den anderen Wochentagen außer Donnerstag spielte ich mit Papierpuppen, die mir Mrs Caudill geliehen hatte, die Puppen hatten die Gesichter von Vivien Leigh, Olivia de Havilland, Ann Rutherford und Butterfly McQueen, wie sie in Vom Winde verweht zu sehen waren, und von den Nachbarskindern lernte ich, rohe Kartoffeln zu essen, die in den weichen Staub unterm Haus getaucht wurden. Ich weiß jetzt, dass es im unterernährten Süden normal ist, Dreck zu essen, so wie ich jetzt weiß, warum der Busfahrer sich am ersten Donnerstag, an dem wir nach Duke fuhren, weigerte, die Haltestelle zu verlassen, solange wir nicht von den hinteren Sitzen nach vorn gekommen waren, aber damals wusste ich das nicht. Ich wusste damals nicht einmal, dass meine Mutter unseren einige Monate währenden Aufenthalt in Durham alles andere als optimal fand.
Ich konnte nie genau sagen, was mich im Sommer 1970 dazu trieb, Zeit im Süden zu verbringen. Es gab keine journalistische Notwendigkeit, an irgendeinen der Orte zu fahren, an denen ich damals war; nirgendwo »passierte« etwas, keine berühmten Morde, Gerichtsverfahren, Integrationsverfügungen, Auseinandersetzungen, nicht einmal gefeierte Taten Gottes. Ich hatte nur das dunkle und unausgereifte Gefühl, ein Gefühl, das mich hin und wieder befiel und nicht schlüssig erklärt werden konnte, dass der Süden und besonders die Golfküste für Amerika einige Jahre lang das gewesen war, was, wie die Leute immer noch sagten, Kalifornien war und für mich gerade nicht zu sein schien: die Zukunft, die geheime Quelle negativer und positiver Energie, das psychische Zentrum. Ich redete nicht so gern darüber.
Ich hatte nur ein höchst flüchtiges »Bild« im Kopf. Wenn ich darüber redete, konnte ich nur Clay Shaw anführen und Garrison und einen Piloten, dem ich einst begegnet war und der mehrere Jahre mit Kleinflugzeugen zwischen dem Golf und namenlosen karibischen und zentralamerikanischen Landebahnen hin und her flog, mit Passagierlisten, auf denen nichts als »tropische Blumen« stand, ich konnte nur die Ahnung von Paranoia, fiebriger Verschwörung und grotesker Manipulation anführen, Pfirsicheis und einen unangenehmen Abend, den ich 1962 an der Ostküste von Maryland verbrachte. Kurz, ich konnte nur verwirrt klingen. Also flog ich, statt darüber zu reden, eines Tages im Sommer 1970 in Richtung Süden, mietete ein Auto und fuhr etwa einen Monat durch Louisiana, Mississippi und Alabama, traf keine Pressesprecher, berichtete nicht über Ereignisse, tat nichts außer, wie immer, herauszufinden, wo das Bild in meinem Kopf herkam.
(…)
Bei diesem Text handelt es sich um einen Auszug aus Joan Didions „Süden und Westen“.
Das Buch
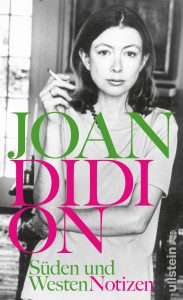 Wie in ihren hochgelobten Essays und Reportagen zeigt sich auch in diesem ursprünglichen Material Joan Didions Beobachtungsgabe, ihr Scharfsinn und ihr Gespür für beiläufige und doch vielsagende Szenen. Ergänzt werden ihre Reisenotizen um bisher ebenfalls unveröffentlichte Aufzeichnungen, die 1976 entstanden. Damals beobachtete sie in San Francisco im Auftrag des Rolling Stone den Prozess, der der Millionenerbin Patty Hearst wegen Bankraubs gemacht wurde. Der geplante Artikel erschien nie, doch Joan Didions Reflexionen bilden die Grundlage für ihre spätere autobiographische Auseinandersetzung mit Kalifornien.
Wie in ihren hochgelobten Essays und Reportagen zeigt sich auch in diesem ursprünglichen Material Joan Didions Beobachtungsgabe, ihr Scharfsinn und ihr Gespür für beiläufige und doch vielsagende Szenen. Ergänzt werden ihre Reisenotizen um bisher ebenfalls unveröffentlichte Aufzeichnungen, die 1976 entstanden. Damals beobachtete sie in San Francisco im Auftrag des Rolling Stone den Prozess, der der Millionenerbin Patty Hearst wegen Bankraubs gemacht wurde. Der geplante Artikel erschien nie, doch Joan Didions Reflexionen bilden die Grundlage für ihre spätere autobiographische Auseinandersetzung mit Kalifornien.
„Süden und Westen“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage.

