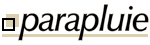
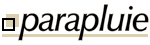 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 20: ohr
|
Wie wir mit der Welt hören |
||
von Brian Gygi |
|
In welchem Ausmaß Hörerlebnisse und deren Pegel subjektiv sind,-- das Blätterrauschen des einen ist der tieffliegende Jet des anderen -- kann man sich durch Zen-Meditation klarmachen, in der ein Ziel darin besteht, den auditiven Filter, mit dem wir uns jeweils subjektiv an unsere Umwelt anpassen, komplett auszuschalten. So erfahren wir unter anderem via negationis, warum auch ohrenbetäubender Hip-Hop unter Umständen seine Berechtigung hat. |
||||
|
||||
I. | ||||
Vergangenes Jahr zog ich aus einem ruhigen Wohngebiet in El Cerrito (Kalifornien) weg. In den vorangegangenen zehn Jahren, seit ich aus New York City weggezogen war, hatte ich immer den Wunsch nach einer urbaneren Umgebung gehabt. Und diese bot sich in der Innenstadt Oaklands ohne Zweifel. Ich hatte völlig vergessen, daß das Leben im Zentrum einer Großstadt nicht nur mit hellem Licht und permanenter Tätigkeit einhergeht, sondern auch mit einem mehr oder minder konstanten Geräuschpegel. Während meiner ersten schlaflosen Nacht, umgeben vom Donnern der Lastwagen und den Zurufen der Kundschaft an die Adresse des Drogenhändlers in der Wohnung neben mir (rätselhafterweise hatte die Vermieterin diesen Herrn gar nicht erwähnt), dachte ich bei mir: "Daran wirst du dich nie gewöhnen." Doch es brauchte kaum mehr als zwei weitere Nächte, bis diese ungebetenen Geräusche ganz wie von selbst immer mehr im Hintergrund untergingen. |
||||
Andere Leute in der gleichen Situation dagegen hätten vielleicht in genau entgegengesetzter Weise reagiert und jedem Zischen der Luftbremsen und jedem Brüller von "Ey Mann, ich bin's!" mit Furcht und Schrecken entgegengefiebert. Ihre Reaktion hätte also die Geräusche nicht ausgeblendet, sondern diese vielmehr bis zu einem Punkt verstärkt, an dem selbst ein moderater Geräuschpegel als unerträgliche Belästigung empfunden wird. Ein Merkmal autistischer Kinder ist es, daß diese selbst mittellaute Geräusche nicht ertragen können; Temple Grandin, eine autistische und anderweitig nicht behinderte Frau, berichtete dementsprechend von ihrer Erfahrung, bei jedem Klingeln der Schulglocke in Schreien ausgebrochen zu sein. Laut einer Theorie des Autismus besteht diese Behinderung in der Unfähigkeit, Stimuli zu unterdrücken, so daß die Umwelt permanent ungefiltert auf die Autistin einstürmt und so die Entscheidung erschwert, auf welche Stimuli reagiert werden soll. |
||||
Das, was wir nicht 'hören', ist ebenso wichtig wie das, was wir hören.[Anm. 1] Ich erinnere mich daran, daß ich während meiner Zeit in New York City einmal die Straße enlanglief, um von der wahrhaft ohrenbetäubenden Hip-Hop-Musik aus einem entgegenkommenden Auto regelrecht durchgeschüttelt zu werden. An sich ist so etwas in dieser Stadt überhaupt nicht ungewöhnlich. Allerdings fiel mir auf, daß die Autofenster geschlossen waren, was mich nur erahnen ließ, wie laut die Musik im Auto tatsächlich sein mußte. Einen Moment später bemerkte ich dann, daß im Auto zwei kleine Kinder saßen. Meine erste Reaktion darauf war: "Mein Gott, diese Leute bringen ihre Kinder zum Ertauben!" Dann aber wurde mir bewußt, daß man in New York City tatsächlich wesentlich besser zurechtkommt, wenn man in der Lage ist, eine Menge Dinge einfach zu ignorieren. Diese Betäubung mag also vielleicht als regelrecht adaptive Maßnahme angesichts einer Umwelt mit zu vielen Stimuli gelten. Glücklicherweise ist eine solcherart zwangsweise herbeigeführte irreversible Selektivität in der Regel nicht notwendig. In den meisten Hörsituationen können wir alles ausblenden, auf das wir uns nicht konzentrieren wollen. Man braucht nur eine Audioaufnahme einer beliebigen Situation zu machen, um darüber in Staunen zu verfallen, welche Geräusche man ursprünglich gar nicht wahrgenommen hat, während das, was man für klar und deutlich gehalten hat, sich irgendwo im Hintergrund abspielt. |
||||
Aus dem bisher Gesagten können wir schließen, daß wir bei weitem nicht alles hören. Dies trifft selbstverständlich auf alle unserer Sinne zu, und in mehrerlei Hinsicht ist dies einfach nur praktisch: wir würden verrückt werden, wenn wir andauernd unsere Kleider spüren oder uns unseres eigenen Körpergeruchs bewußt sein müßten. Allerdings scheint die Fähigkeit, Stimuli auszublenden, sich nicht ohne weiteres über verschiedene Modalitäten der Sinneswahrnehmung zu erstrecken -- weshalb wir uns unter anderem tatsächlich besser auf den zu findenden Parkplatz konzentrieren können, wenn wir das Autoradio ausschalten. Hier sind wir auf das Hören konzentriert: die Filter unseres auditiven Systems sind bemerkenswert gut dafür ausgebildet, flexibel und unmerklich notwendige von unnotwendigen Geräuschen zu sondern -- und das sogar im Schlaf. Die Notwendigkeit dieser auditiven Wachsamkeit ist übrigens als möglicher Grund dafür genannt worden, daß wir in unseren Träumen nur selten hören. Ein wunderbarer Anschnitt in Thomas Pynchons Gravity's Rainbow (dt. Die Enden der Parabel) beschreibt paradoxe Reaktionsmuster, nach denen leisere Stimuli stärkere Reaktionen hervorrufen als laute. Es wird von einem Kampfpiloten berichtet, der vor dem akustischen Hintergrund dröhnender Kampfflieger seelenruhig schläft, jedoch beim leisesten Türklopfen aufwacht. Hörwissenschaftler und Akustiker sprechen gerne vom Rauschabstand, doch im täglichen Leben gibt es so etwas wie pures Rauschen im Grunde gar nicht, sondern lediglich klangliche Information von variierender Nützlichkeit -- einer Qualität, die nicht vom Geräuschpegel abhängt. |
||||
Da Menschen ausgezeichnete Lernmaschinen sind, liegt die Vermutung nahe, daß wir beim evolutionären Wettlauf dadurch im Rennen bleiben, daß wir nicht nur auf Geräusche reagieren, sondern diese auch antizipieren lernen. (Menschen sind wahrscheinlich nicht allein dessen fähig: die herausleitenden Gefäße der cochlea, die die 'Stimmung' der auditiven Peripherie erlauben, sind bei den meisten Säugetieren gut ausbildet.) Diese Annahme wird von einer Vielzahl empirischer Forschungsergebnisse gestützt; so haben beispielsweise Worte, deren Auftreten innerhalb eines bestimmten linguistischen Kontextes sehr wahrscheinlich ist, eine bis zu 10 dB niedrigere Wahrnehmungsschwelle als Worte mit niedriger Wahrscheinlichkeit -- ein recht deutlicher Effekt, der dem Vorbeidonnern einiger Dutzend Müllwagen entspricht. Wir können sogar Worte hören, die gar nicht da sind: in einer Studie wurden einzelne Worte durch Rauschen ersetzt und diese dennoch wahrgenommen. Anstatt also auf die Welt zu hören, hören wir vielmehr mit dieser, indem wir das, was wir aufnehmen, permanent mit dem vergleichen, was wir erwartet haben, und auf der Grundlage der sich daraus ergebenden Widersprüche jenes interne Gebilde auf den neuesten Stand bringen, das ich unser Auditives Welt-Modell (AWM) nennen möchte -- ein Modell also, das unsere selektiven Reaktionen angesichts antizipierter Stimuli reguliert.[Anm. 2] |
||||
II. | ||||
William James, selten um eine prägnante Formulierung verlegen, bemerkte einmal lakonisch: "Jeder weiß, was 'Aufmerksamkeit' heißt." Wie viele denkwürdige Zitate dient auch dieses eher dem Aufsehen als der Aufklärung. Allerdings muß fairerweise gesagt werden, daß James weiterhin erläuterte, daß jene Aufmerksamkeit "das geistige Inbesitznehmen eines von scheinbar mehreren gleichzeitig möglichen Objekten oder Gedankengängen in klarer und lebensechter Form ist. Sie impliziert das Absehen von gewissen Dingen, um sich dadurch effektiv mit anderen befassen zu können [...]". Aufmerksamkeit ist jene grundlegende Fähigkeit, die es uns erlaubt, uns im Informationsüberfluß namens 'Welt' zurechtzufinden. Die beste Definition von 'Aufmerksamkeit', die mir bislang begegnet ist, stammt von dem berühmten Hörwissenschaftler Bruno Repp, der einmal bemerkt hat: "Es gibt kein Lernen, es gibt keine Aufmerksamkeit, es gibt kein Gedächtnis, es gibt nur ein Lernen von Dingen, ein Aufmerken auf Dinge und ein Gedächtnis für Dinge." Aufmerksamkeit wird demnach aller Wahrscheinlichkeit nach kein einheitlicher Vorgang sein; die Mechanismen nämlich, die uns auditives Aufmerken ermöglichen, sind recht verschieden von denjenigen, die die visuelle Aufmerksamkeit steuern, auch wenn beide aus funktionaler Perspektive sehr ähnlich erscheinen mögen. So findet beispielsweise alles Entscheidende des Sehvorgangs in der fovea statt, einem kleinen Ausschnitt der Retina. Das auditive System aber kennt keine vergleichbare lokalisierte Struktur. Dies mag erklären, warum unerwartete Geräusche uns so leicht auf dem falschen Fuß erwischen: sie zwingen uns dazu, unser AWM radikal umzupolen. Normalerweise verarbeitet unser AWM mühelos die überwiegende Mehrheit anfallender Geräusche, solange wir an unsere Umwelt angepaßt sind. "Vorbeirollender Lastwagen -- wie erwartet." "Schlägerei unten auf der Straße -- wie erwartet." "Muhende Kuh -- hmm, nicht wie erwartet! Aufwachen! Irgendetwas stimmt nicht!" |
||||
Säuglinge kommen höchstwahrscheinlich mit einem nur minimal entwickelten AWM auf die Welt, obwohl die physiologischen Hörstrukturen bereits bis zum sechsten Schwangerschaftsmonat gut ausgebildet sind, pränatales auditives Lernen sehr früh beginnt, und Spekulationen über auditive 'Urzustände' haltlos erscheinen. In jedem Falle hören wir, bevor wir sehen. Welcher Art mag also die Hörerfahrung für ein sehr junges System sein? Ist jedes neue Geräusch ein unerwarteter Lärm, der bis ins Mark geht? Eine große Menge an Forschungsergebnissen der Entwicklungspsychologin Lynn Werner lassen vermuten, daß Säuglinge große Schwierigkeiten damit haben, sich auf einen bestimmten Frequenzbereich zu konzentrieren und damit andere Bereiche auszublenden. Ist die von William James so genannte "blühende und summende Verwirrung" vielleicht nichts anderes als das Reich der tausend Lärmschocks? Werden wir jedesmal in eine pränatale Ursuppe ohne Bezüge zurückgeworfen, wenn wir unerwartete Geräusche hören? |
||||
An dieser Stelle sollte man sich daran erinnern, daß die etymologischen Wurzeln des englischen Wortes attention auf tendons (Sehnen) zurückgehen -- also etwas, das sich dehnt und Dinge verbindet. Um damit auf die eingangs zitierte Zenparabel zu kommen: die zweite edle Wahrheit des Buddha ist jene, daß die Wurzeln des Leidens Anhaftung, Anhänglichkeit ist. Inwiefern aber kann dann Aufmerksamkeit -- jene Fähigkeit, an etwas anzuhaften -- als eine der Grundlagen der Zen-Praxis gelten? |
||||
|
Unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt. Ihre genauen Grenzen sind nicht bekannt: einige Leute können sehr gut mehrere Dinge gleichzeitig tun, doch es ist allgemein eher üblich, sich auf nur einen Tätigkeitsfluß zu konzentrieren. Eine Konsequenz der eingeschränkten Aufmerksamkeit ist unsere Tendenz, die Welt in Vordergrunds- und Hintergrundsmuster einzuteilen. Wir scheiden so jenes, auf das wir uns konzentrieren wollen, von dem, was zu ignorieren ist. Sobald wir ein Muster inmitten des visuellen Rauschens erkannt haben, verstärkt sich diese Wahrnehmung wie von selbst. Wenn man einmal den Hund im links stehenden Muster (Abb. 1) erkannt hat, kann man dieses nie mehr einfach nur als eine Ansammlung von Punkten ansehen. (Falls Sie den Hund nicht entdecken können: er ist in Abbildung 2 weiter unten dunkel schattiert.) Shakyamuni Buddha sagte einmal, daß man vom Weg abkommt, sobald man die Welt in das, was ist, und in das, was nicht ist, einteilt. Der Hund mag also eine Buddha-Natur haben oder auch nicht (wie es in einem berühmten Koan heißt), doch die Person, die den Hund wahrnimmt, hat sich jedenfalls kurzzeitig von ihrer Buddha-Natur entfernt. |
|||
Im Bereich des Hörens gibt es zahllose Beispiele für eine entsprechende Sinn-Konstruktion aus scheinbar sinnlosen Geräuschen. Hier hören Sie ein Beispiel, in dem die komplexe harmonische Struktur der Sprachmelodie durch modulierte Sinuskurven ersetzt worden ist. Für die meisten Hörer klingt das daraus resultierende Geräusch wie eine Reihe von Pfeiftönen. Sobald man aber die semantische Botschaft kennt, die sich in diesem Sprachsegment verbirgt (klicken Sie dazu hier), so kann man das erste Beispiel nicht mehr nur als Pfeifen hören. |
||||
Das Ziel der Praxis des Zazen (Zen-Meditation), wenn man es denn ein Ziel nennen kann, ist es, vollständig und unmittelbar im Moment anwesend und sich dieses Momentes bewußt zu sein, also mit so wenig kognitiver Interferenz wie möglich zu hörensehenriechenfühlen. Eine der Methoden, um in dieser Weise anwesend zu werden, ist, sich auf nichts zu konzentrieren, indem man nach unten auf eine leere Wand blickt, so still, daß der eigene Atem durch das ganze Hals-Nasen-Ohren-System hindurchklingt. Man "öffnet die Hand des Denkens", wie der berühmte Zen-Meister Uchiyama Roshi formuliert, die Welt strömt auf einen ein, und es ist, als sei der Filter des AWM zwecks eines Austausches entfernt worden. Man merkt auf, aber auf die ganze Welt auf einmal. Während des Zazen-Sitzens habe ich einmal die Stimme eines außerhalb des Meditationsraumes Redenden als reines, einfaches Geräusch empfunden. Ein wahrlich seltsames, wunderbares Geräusch -- voll Resonanz und doch sehr hell, wie ein wellenhaftes, gurgelndes Platzen. Dabei achtete ich weder darauf, was die Person sagte, noch auf deren Geschlecht. |
||||
In diesem Zustand empfand ich eine tiefe Dankbarkeit dafür, einfach zu existieren. Ich bin da (attend to) für die Welt, in den anderen Bedeutungen dieses Wortes: jemandem aufwarten, dienen. Auf diese Aufmerksamkeit bezog sich der Zen-Meister des einleitenden Zitats, als er die Grundlage des Zen zu erläutern versuchte. Wenn ich diesen wünschenswerten Zustand durch die Zen-Praxis erreiche, bringt mich die Glocke, die das Ende der Zazen-Periode anzeigt, beinahe dazu, vor Schrecken von meinem Zafu (dem Meditationskissen) zu fallen. Weil ich mit der Welt, nicht auf diese höre, erwischt mich das immens laute (im Vergleich zur vorhergegangenen Stille) BARAAANG völlig unvorbereitet in der Art und Weise, wie es Klangwellen in Richtung meiner cochlea schickt. Dies ist der Zustand des von Shinryu Suzuki Roshi so genannten "Anfängergeistes" -- der Zustand des Säuglings, der nicht permanent vor der Welt Angst hat, sondern vielmehr "leer, frei von den Gewohnheiten des Experten, zum Akzeptieren und Zweifeln bereit, und allen Möglichkeiten gegenüber offen ist". |
||||
|
Doch dieser Zustand gelingt mir nicht oft. Er ist ebenso schwer zu erreichen, wie beizubehalten. Meistens sitze ich dagegen leicht verträumt auf meinem Kissen, denke über mein Leben nach, über meinen Hund, das süße Mädchen, das neben mir Zazen sitzt, und höre die Glocke beinahe gar nicht. Mein zendo-AWM weiß, daß die Glocke gleich läuten wird, es schraubt die Verstärkung des auditiven Inputs herunter, und in diesem Moment ist mir bereits ein Teil der Vielfalt der Welt verlorengegangen. Einschränkungen wirken immer in zwei Richtungen. Wir müssen uns nur immer wieder dran erinnern, was wir dabei verlieren. Können Sie sich jetzt, da Sie den Hund im nebenstehenden Bild gesehen haben, entsinnen, wie das Bild aussah, als es nur aus Punkten bestand? Ich kann es auch nicht, aber dennoch versuche ich es immer wieder gerne. |
|||
|
(Aus dem Amerikanischen von Martin Klebes.) |
||||
|
autoreninfo

Dr. Brian Gygi arbeitet momentan am Veterans Administration Medical Center in Martinez (Kalifornien), wo er sich mit Fragen der Trennung auditiver Ströme, ökologischer Akustik und auditiver Aufmerksamkeit bei jungen und älteren Hörern beschäftigt. Er promovierte in Kognitionswissenschaft und Psychologie an der Indiana University und erhielt seinen B.A. in Englischer Literatur von der Columbia University.
Veröffentlichungen:
Gygi, B., Kidd, G.R. & Watson, C.S.: Spectral-temporal factors in the identification of environmental sounds. In: Journal of the Acoustical Society of America, Nr. 155 (3), 2004, S. 1252-1265. -- Shafiro, V. & Gygi, B.: How to select stimuli for environmental sound research and where to find them? In: Behavioral Research Meth., Instr. & Comp, Nr. 36(4), 2004, S. 590-598.
|
||||
|
|