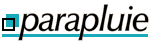
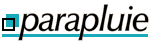 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 25: Übertragungen
|
Zwischenwelten der Phantasie |
||
von Dorothee Ostmeier |
|
In der derzeitigen Popularität der Phantasieliteratur spiegelt sich unsere Faszination an der Lockerung aller Denkstrukturen und -konventionen. Texte von Michael Ende und Cornelia Funke präsentieren Schreib- und Leseprozesse als magische Momente, welche die Grenzen zwischen Realitäten und Fiktionen verflüssigen und dabei die psychischen und sozialen Risiken ihrer Grenzzonen thematisieren. Gerade diese Risiken können verstanden werden als Voraussetzungen für eine "Kritik der ethischen Gewalt", wie sie Judith Butler als Grundlage einer neuen Ethik für eine Zeit der Übergänge vorschlägt. |
||||
Phantasieromane für Jugendliche haben Hochkonjunktur. Michael Endes Die Unendliche Geschichte kann eine weltweite Gesamtauflage von 40 Millionen Exemplaren verzeichnen, Cornelia Funkes Trilogie Tintenherz, Tintenblut und Tintentod hat bereits 10 Millionen erreicht und die US-amerikanische Filmgesellschaft New Line Cinema hat nun auch das cinematographische Potential der Funke-Bücher entdeckt: Tintenherz soll im Herbst diesen Jahres in die Kinos kommen. Funke könnte, obwohl sie in Los Angeles wohnt, vielleicht als die J.K. Rowling Deutschlands fungieren, von deren letztem Harry-Potter-Band im Juli 2007 allerdings bereits innerhalb der ersten 24 Stunden 15 Millionen Exemplare verkauft wurden. Es scheint also, daß das Experimentieren mit Zwischenwelten, in denen sich Phantasie und Realität überschneiden, ablösen, in Frage stellen oder in Konflikt geraten, zum absoluten Faszinosum geworden ist. Während es in den Harry-Potter-Folgen vor allem um die Erfolge und Mißerfolge in der Handhabung magischer Tricks und Techniken geht, wird in Endes und Funkes Texten das Lesen und bei Funke auch das Schreiben zum magisch unberechenbaren Phänomen, das bürgerlich fixierte Subjekt- und Identitätsstrukturen destabilisiert. Wenn sich Fiktionen zu jeder Zeit in Realitäten und Realitäten in Fiktionen wenden können, dann zerbrechen neben den Identitätsstrukturen auch die ethischen, die, wenn sie nicht mehr an die Konventionen patriachalisch bürgerlichen Denkens gebunden sind, der Fiktion Freiräume für ethische Experimente eröffnen. Vielleicht ist es gerade dieses Risiko, das sich in den märchenhaften Phantasietexten als Bezauberungspotential offenbart und auf das Judith Butler in einem ganz anderen Kontext als ethisches Prinzip der Zukunft verweist. In Kritik der ethischen Gewalt sieht Butler sozialen Fortschritt nur durch eine Ethik gegeben, die festgelegte Moral- und Identitätsstrukturen aufbricht und sich dem Risiko des total Unvertrauten öffnet. Ist es möglich, daß die gegenwärtige phantastische Literatur gerade solch ein Risiko beschwört und popularisiert, und zwar ausdrücklicher als die romantische? |
||||
Schon in romantischen Märchen geht es immer wieder um das Phantasieren über die Grenzverschiebungen zwischen einer Vielfalt von Realitäten. In Grimmschen Märchen folgen dabei magische und soziale Realitaten noch strengen Regeln, die beide Sphären voneinander trennen, bis das Magische am Ende oft für die Aufhebung sozialer Ungerechtigkeit sorgt. Doch in den sogenannten Kunstmärchen sind Phantasie und Realität, sobald sie wie bei Ludwig Tieck oder E.T.A. Hoffmann psychologisiert werden, nicht immer so leicht voneinander differenzierbar, da nun das phantastisch Unheimliche den banalen bürgerlichen Alltag bedrängt, ihn in manchen Fällen total zerstört oder aber im utopisch idealen Sinne um die Dimension des Phantastischen bereichert. Sigmund Freud hat die Macht des Unheimlichen als Umsetzung ödipaler Konflikte und Triebe beschrieben, C.G. Jung sieht Archetypen am Werk und literarisch orientierte LeserInnen identifizieren im Kontext idealistischer Philosophie Momente der romantischen Ironie, die den Sinn des Poetischen gerade an den Grenzen des Reflexions- und Sprachvermögens ansiedeln. Michael Ende und Cornelia Funke treiben diese Reflexionen poetisch weiter und konzentrieren sich dabei auf zwei aneinandergebundene zentrale Motive, nämlich auf das Lesen über das Lesen und das Schreiben über das Schreiben und die daran gebundenen dynamischen Grauzonen, die sich zwischen Phantasie und Identität schieben. |
||||
E.T.A. Hoffmann hat dieses Thema in "Der goldenen Topf" (1814/1819) und "Der Sandmann" (1817) angelegt. Im "Goldenen Topf" schreibt sich Anselmus durch das Kopieren alter Manuskripte in die Phantasie ein. Doch sein Erzähler, der sowohl Anselmus wie auch seine Phantasiewelten entwirft, stößt als reflektierendes "Ich" an die Kapazitätsgrenzen seiner Phantasiekonstruktionen. Der Ich-Erzähler kann demnach seine Geschichte nur beenden, nachdem er von seiner eigenen Figur, dem proteusgleichen Archivarius Lindhorst zum Arak eingeladen und in die Atlantisvision initiiert wird, die sich dann im visionären Prozeß verwirklicht. Der Erzähler erlebt sie wie einen Rausch: Die Erzählung wendet sich vom epischen Imperfekt ins absolute Präsens und endet mit Anselmus' direkter Apostrophe an die Geliebte, Serpentina, die mit einer pantheistisch und synästhetischen Geste die Ewigkeit von Glauben, Liebe und Erkenntnis zelebriert. Mit melancholischer Frustration beklagt sich der Ich-Erzähler, Autor und Produzent später über den Verlust der Vision und läßt sich dann von Archivarius Lindhorst trösten, der ihn an sein Visionserlebnis erinnert und fragt: "Waren Sie nicht soeben selbst in Atlantis, und haben sie denn nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besitztum Ihres inneren Selbsts?" Die poetische Realität der Phantasie ist nur als verlorene zu erinnern. Die Metapher "Meierhof" verlegt die exzentrisch-utopische Atlantisvision in gutbürgerliche Gesellschaftsvorstellungen und verweist leicht ironisch auf den bürgerlich verengten Zugang zur poetischen Wahrnehmung, die wohl allzusehr von "Besitz" und "artiger" Routine geprägt ist. In Hoffmanns Geschichte "Der Sandmann" fällt die Überschreitung jener Sphäre weniger subtil aus: Nathanael zerbricht am vom Horror gezeichneten und von Freud mit dem Ödipuskomplex assoziierten Zugang zum Phantastischen. Diese Beispiele von Hoffmanns narrativen Schlußvariationen leuchten die Bandbreite seiner auf das Phantastische gerichteten Spekulationen aus. |
||||
Bei Michael Ende ist es der zehn- oder elfjährige Junge Bastian, der sich gelangweilt von Familie und Schulalltag zurückzieht, "Die unendliche Geschichte" liest und sich plötzlich so in sie vertieft, daß er selbst zur Figur des gelesenen Romans wird. Insofern präsentiert Endes Text das Lesen der Unendlichen Geschichte selbst als Geschichte über das Lesen. Ungefähr in der Mitte des Buches verläßt Bastian die konkrete Realität seines Alltags, um dann nach bestandenen Abenteuern im Land Phantásien am Schluß in sie zurückzukehren. Die Fiktion seiner phantastischen Abenteuer durchbricht und revidiert die Fiktion seiner Alltagsrealität und untersucht das ethische Potential menschlicher Phantasiekapazität. |
||||
Durch das rot und blaugrüne Druckbild des Buches markiert Ende deutlich die Grenzen zwischen Phantásien und Alltagsrealität. Bastian verschwindet aus seiner Alltagsrealität (S. 190) und wird für die nächsten 229 Seiten mit blaugrünen Lettern in das Leben Phantásiens integriert, bis er dann am Schluß in seinen Alltag zurückkehrt. Die letzten acht Seiten sind wieder rot gedruckt. Im Übergangskapitel "Der Alte vom wandernden Berge" sind die Absätze noch farbig differenziert, doch gehen sie syntaktisch so manches Mal ineinander über, wenn in den letzten beiden Absätzen die farbige Differenzierung durch ein geschlossenes Satzgefüge unterwandert wird und zwischen dem gelesenen Buch "Die unendliche Geschichte" und dem Buch, das im Schicksalsgebirge Phantásiens verfaßt wird, eine Brücke schlägt. Das Phantastische dringt in den Alltag ein. |
||||
So reflektiert "Die unendliche Geschichte" über ihre eigene Entstehung und die Möglichkeiten ihrer Fortsetzung. Im Anfang liest Bastian die Geschichte, in der er dann selbst eine wesentliche Rolle übernimmt, und seine authentische und fiktive Identität sich so überschneiden: "Was da erzählt wurde, war seine eigene Geschichte! ... Er, Bastian, kam als Person in dem Buch vor, für dessen Leser er sich bis jetzt gehalten hatte!" (S. 188) Bastian, der Leser, wird zur gelesenen Figur, die das Geschehen in Phantasien weitertreibt und letzlich die Sphäre der Phantasie für zukünftige Leser rettet. So wird er zur Allegorie des Lesens, das nämlich nur dadurch, daß es die Distanz zum Text überwindet und sozusagen mitspricht oder -schreit, aktiv an seiner Phantasieproduktion teilnimmt. |
||||
Als Figur im Land "Phantásiens" hat Bastian zwei aneinandergeknüpfte Aufgaben: Phantásien vor der Zerstörung zu bewahren und dadurch gleichzeitig die "Menschenwelt" und die in ihr Verstrickten vor moralischer Dekadenz und Lügenspiel zu retten. Das Land Phantásiens würde ohne diesen Kontakt zu Bastian zugrunde gehen, da es an seine poetische Produktivität, seine Fähigkeit, Dingen Namen zu geben und Geschichten zu erzählen, gebunden ist. Phantásien hat keine Autonomie. Allerdings ist die Gefahr für Phantásien nicht überstanden, sobald Bastian es betritt. Er muß auch in seine Alltagsrealität mit all ihren Beschränkungen, in die Geschichte über die Geschichte zurückkehren, obwohl der Rausch Phantásiens in ihm den Wunsch weckt, in "Phantasien" zu verweilen und seine biographische Realität, nämlich die Realität des Lesers zu vergessen. An die Lust an den Phantasien des gelesenen Wortes ist die Antipathie gegenüber der Rückkehr in die bürgerliche Realität gebunden; Bastian schwebt zwischen seiner biographischen und der durch Wort und Sprache inspirierten phantastischen Identität. |
||||
In Phantásien erfüllt märchenhafte Magie alle Wünsche, Bastian wird attraktiv und mächtig, doch büßt er, ohne es zu bemerken, mit der Erfüllung eines jeden Wunsches Erinnerungen an seine biographische Realität ein, bis er sich letzlich auch nicht mehr an seinen eigenen Namen erinnert. Phantasierausch und Namensverlust bedrohen nicht nur seine persönliche Identität, sondern auch die Existenz der Phantasie selbst, denn ohne identitätsstiftenden Namen kann Bastian nicht mehr in seinen Alltag zurück. Der Imaginierende droht von seinen eigenen Imaginationen negiert zu werden. Dies ist paradox: Durch Identifizierung mit dem Phantastischen riskiert er die Epik des Alltäglichen und damit sein physisches Überleben. Die Kommunikation zwischen Phantasie und Realität ist von diesem Überlebenskampf beider Sphären geprägt, dem Michael Ende auch eine gewisse ethische Dimension einschreibt, wenn Bastian Verantwortung für beide trägt. |
||||
Bastians Abenteur, die Figuren, denen er begegenet und die kuriosen Landschaften, die er durchstreift, haben höchst allegorische Funktionen, die -- wie zum Beispiel bei Novalis vorgeprägt -- die Spannung zwischen Alltagsrealität und märchenhaft Phantastischem ausdrücklich an psychologische und philosophische Problemkonstellationen knüpfen. Dominant sind die Spannungen zwischen Lüge, moralischer Dekadenz und Wahrheit, Verblendung und Sehen, Alltagsbanalität und Wunder, zwischen Krankheit und Vitalität, Leben und Tod. |
||||
Es wäre leicht, von formalistischer Perspektive her konventionell narrative Märchenstrukturen und weitere typische, von Vladimir Propp für die Morphologie des Volksmärchens nachgewiesene "Spielzüge" und "Funktionen der dramatis personae" nachzuweisen, die hier allerdings den traditionellen Konflikt zwischen Gut und Böse auf den Konflikt zwischen Wahr und Falsch, Sehen und Verblendung verschieben. Anstatt am Ende wie Aschenputtel, Schneewittchen oder das tapfere Schneiderlein sozial aufzusteigen, gewinnt Bastian Einsicht in die spektakuläre Macht der Phantasie und ihrer Grenzen. Mit barockhafter Freude an Details ziseliert Ende das Spiel der Imaginationen, das Bastians Schicksal bestimmt. Sein Glück ist letzlich an zwei Fähigkeiten gebunden: Zunächst muß er der Kindlichen Kaiserin einen neuen Namen geben, um sie und ihr Land Phantásien vor Krankheit, Verwüstung und Zerstörung zu retten, doch dann muß er auch seinen eigenen "Wahren Willen" finden, um seine Alltagsrealität von Betrug und Lüge zu befreien. Diese doppelte Aufgabe fordert Bastians poetische und psychische Kompetenzen heraus. |
||||
In Bezug auf die poetischen Kompetenzen greift Ende mit seinen phantastischen Bildern und Erklärungen komplexe sprachphilosophische Themen und kabbalistische Ideen auf. Vielleicht am bekanntesten für diesen Kontext sind Walter Benjamins Reflektionen zur Sprachmagie der Namen im Zuge seiner Genesisdeutung in der Frühschrift "Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen". In der göttlichen Ursprache sind Signifikat und Signifikant nicht voneinander getrennt, sie beschreibt nicht vorgegebene Realitäten, sondern schafft und kreiert sie. Benjamin sieht Sprache nicht im linguistischen Sinn als Zeichensystem, als Mittel zum Zweck, sondern betont ihre Unmittelbarkeit, die nicht mitteilt, sondern neue Wirklichkeiten schafft. Von linguistisch-philosophischer Perspektive aus könnte man hier auch auf J.L. Austins Konzept des performativen Sprechens verweisen: Illokutionen greifen ein, verändern und üben Macht aus. |
||||
Vom Einsatz dieses performativen Sprechens ist die Existenz der kindlichen Kaiserin und ihres Reiches abhängig. Wenn Bastian ungefähr in der Mitte des Buches ihren Namen entwirft und ausruft, spricht er sich in die Phantasiewelt ein. Das laute Sprechen ist für den Fortgang der "Unendlichen Geschichte" notwendig. Mit seinem "fast besinnunglosem" Schrei "Mondenkind! Ich komme!", bei dem "ihm Tränen über das Gesicht liefen" (S. 190), durchbricht er die Stille seiner Lektüre, um daraufhin von dem "Sturmwind" in den Nachtwald Perelin und in die Nähe Mondenkindes getragen zu werden. Die Magie des Namens sorgt für die Kontinuität der Existenz Phantásiens und setzt den phantastischen Wandel von Bastians Existenz in Gang, der ihn allerdings auch den unberechenbaren Wünschen des eigenen Unbewußten ausliefert. Hier stoßen bezaubernde Sprachmagie und die den "Wahren Willen" gefährdenden Triebe des Unbewußten, die durch eine traditionell märchenhafte Dingmagie weiter stimuliert werden, aufeinander. |
||||
In Phantásien unterliegt Bastian der atavistischen Dingmagie des Amuletts Auryn, die ihm jeden Willen erfüllt und von der er sich wieder emanzipieren muß. Gerade in der Distanzierung von der ihm so eigenen Faszination, in der Distanzierung von der Dingmagie des Phantastischen und in der Besinnung auf die Namensmagie liegt die ethische Herausforderung, die Phantásien an ihn stellt. Ethik ist hier zunächst kein soziales Konzept, sondern bezieht sich auf den Umgang mit sich selbst, mit Phantasie und Willensdynamik. Bastian beharrt bis zum Schluß auf dem Besitz des Amuletts Auryn, das er erst im allerletzten Moment, als er bereits seinen eigenen Namen, den poetischen Code für die Rückkehr in die menschliche Welt, vergessen hat, zurückgibt. Nur sein aus Phantásien stammender Freund Atreyu kann ihn an seinen Namen erinnern und nur durch ihn findet Bastian zur Namensmagie zurück. Der erneute Zugang zur Poesie seines Namens läßt ihn seinen Alltag wiederfinden. Diese Neu- oder Wiederbenennung durch eine Figur der Phantasiesphäre lädt Bastians Namen mit phantastischem Potential auf und privilegiert die poetische Sprachmagie des Namens gegenüber der atavistischen Dingmagie des traditionellen Märchens. |
||||
Die traditionelle Dingmagie des Märchens, Bastians Amulett, bedingt die Konfrontation der Psyche mit sich selbst, zum Beispiel mit der Lust am Todestrieb, den die verführerische Nähe der morbiden und korrupten Eiskönigin darstellt. Aryn bietet Bastian die Möglichkeit, mit allen Wunsch- und Willenspotenzen zu experimentieren, Todes- und Lebenstriebe solange abzuarbeiten, bis sie sich selbst und ihre eigene Egozentrik überwinden und dadurch die eigene Psyche transzendieren. Die Namensmagie löst die Dingmagie ab und schreibt der Alltagsrealität die Poesie der Phantasie ein, die allerdings immer wieder durch willkürliche psychische Prozesse bedroht wird. In dieser ständigen Spannung zwischen Destruktion und Evokation der Poesie liegt auch die "unendliche" Potenz zur Innovation und Fortsetzung der Geschichte Bastians und all der Geschichten, die er initiiert und nicht abgeschlossen hat und die durch ihn als gelesene Figur immer wieder inspiriert werden. |
||||
Die endgültige Grenzüberschreitung Bastians liest sich wie eine Taufszene: Bastian springt in das ihn überaus beglückende "Wasser des Lebens". Diese vitalisierende Säkularisierung christlicher Heilsmotive verschiebt Konzepte göttlicher Transzendenz und Immanenz in die Sphäre sprachlicher Magie. Im Phantasieren arbeitet Bastian willkürlich arbiträre Wünsche und Triebe ab, um dadurch die persönliche Psyche für die Transzendenz der Phantasie, für seinen "wahren Willen" transparenter zu machen. |
||||
|
||||
In Tintenherz, Tintenblut und Tintentod gerät die Kategorie des "Wahren" ins Wanken, denn die Spannungen zwischen den "wahren" und fiktiven Realitäten verschärfen und verkomplizieren sich, da "Phantásien", hier die "Tintenwelt", durch ihre Faszination auch total traumatisiert. Letztlich entscheiden sich die Figuren immer wieder für sie und tauschen sie gegen die Alltäglichkeit ein, um in ihr zu verweilen. Es gibt zunächst keine Regeln und Gesetze, keinen märchenhaft "richtigen" oder "falschen Weg", sondern nur das Verwirrspiel unberechenbarer Worte, die von Dichtern und VorleserInnen verfaßt und gelesen werden. Cornelia Funke überrascht die Hauptfigur, den Buchbinder Mortimer, und später auch seine Tochter dadurch, daß sie beide beim lauten Vorlesen Figuren -- und letzlich auch sich selbst -- aus der Phantasiewelt in die konkrete Alltagsrealität hineinlesen und zur gleichen Zeit aus der konkreten Umwelt weglesen. Das Frustrierende daran ist, daß sie diese Prozesse nicht kontrollieren können, auch wenn sie es verzweifelt versuchen, und sich dadurch im Tiefsten selbst verletzen, wenn in Tintenherz Figuren, z.B Mortimers geliebte Frau, verschwinden, und verhaßte Figuren, wie z.B. der von faschistisch-fanatischem Brutalitäts- und Machtgehabe geprägte Caprikorn und seine Männer erscheinen. Mo erklärt: "Die Angst schmeckt ganz anders, wenn man nicht nur über sie liest, Meggie, ..." (Tintenherz, S. 156) Und Fenoglio, der in der Fiktion originale Verfasser, ist schockiert, daß sich die Geschichten gegen seine Intentionen weiterentwickeln: "Fällt dieser Geschichte nichts anderes ein? [...] Ich bin nicht länger ihr Verfasser. Nein! Nein der Tod ist es [...] Es ist sein Tanz, und egal, was ich schreibe, er nimmt meine Worte, und macht sie sich zu Dienern." (Tintenblut, S. 675) Fenoglio weiß von den "Lücken", die Worten und Geschichten eine Eigendynamik verleihen. Er klagt: "die Worte gehorchen mir schon lange nicht mehr. Sie tun es nur, wenn es ihnen paßt. Wie Schlangen haben sie sich gegen mich gewandt." (S. 677) |
||||
Im "grausamsten Fürst der Tintenwelt", so beschreibt Funke den Natternkopf in der Namenliste von Tintentod (S. 745), wird die Gefahr dieser "Schlangen" allegorisiert. In Tintentod spinnt Fenoglio die Geschichte der Figur des Natternkopfs weiter. Um Mortimer aus seinen Fesseln zu befreien, soll Mo dem Natternkopf ein leeres Buch binden, das ihm Unsterblichkeit verleihen soll. Doch Mo modifiziert die ihm zugeschriebene Rolle und stattet dieses "unendliche Leben" mit "unendlichem Leid" aus. (Tintentod, S. 113) Er feuchtet die Seiten an, sodaß das Buch allmählich verschimmelt und der Körper des Natternkopfes sich schmerzhaft zersetzt, ohne daß er jedoch sterben kann. Es geht nun vor allem um den heiklen Kampf, die Rache, Haß, Destruktionslust und das Revitalisierungsstreben des Natternkopfes zu bestehen, der in dem im Herbst 2007 erschienen Band Tintentod fortgesetzt wird. Auf weiteren 739 Seiten läßt Funke ihre Dichter und Leser versteckte oder verborgene Stränge der Geschichten weiterentwickeln. In diesem Labyrinth der Geschichten wissen viele Figuren nicht mehr, in welche Realität sie gehören wollen und wer oder was überhaupt die sich verstrickenden Geschichtenzüge zu kontrollieren vermag. Denn das ursprüngliche Buch Tintenherz wird umkämpft: das Entsetzen über ungewollte und ungeplante Entwicklungen seiner Charaktere zieht bei Fenoglio eine totale Schreibblockade nach sich. Orpheus, den Fenoglio als seinen Vertreter konzipiert und den er in seine Schreibkünste initiiert, kollaboriert letztendlich mit dem Natternkopf und setzt seine Talente zum egoistisch-sadistischen Vergnügen und zur Machtbereicherung ein. Er kopiert, variiert und modifiziert Bilder, Motive und Figuren des Originals. Seine Textfabrikationen basieren auf Plagiat. Mortimer spielt all die ihm zugeschriebenen Rollen, vom harmlosen Buchbinder bis zum besungenen, brutal verfolgten Räuber, der sich mit den marginalisierten Figuren solidarisiert und immer noch unter größten Qualen die Sehnsucht nach dem Wundervollen der Phantasie verteidigt. Letzlich greifen auch die weißen Frauen des Todes in das Geschehen ein. Der alte Kampf zwischen Gut und Böse verengt sich am Schluß auf das Buch des Natterkopfes: Der Natternkopf verfolgt Mortimer, damit der mit dem verschimmelnden Buch auch sich selbst heilt und ihm ein neues leeres Buch bindet. Leere heißt hier Unsterblichkeit ohne tödliche Qualen. Doch die weißen Frauen des Todes schließen einen anderen Pakt mit dem Buchbinder, nach dem er kein zweites Buch binden, sondern dem verschimmelnden Buch die den Natternkopf tötenden Worte "Herz, Blut, Tod" einschreiben soll. Sie tolerieren die Unsterblichkeit der im Natternkopf personifizierten Grausamkeit nicht. In bezug auf diese Aufgabe bleibt Fenoglios kreative Sprache stumm: er kann Mo kaum noch helfen, sodaß Orpheus' dämonische Fiktionen an Macht gewinnen. |
||||
Erst im allergefährlichsten Moment entsteht eine neue Sprache, eine völlig neue Fiktion, die Mortimer zum Schreiben des Todesurteils über den Natternkopf verhilft und die sogenannt "Guten" von Verzweiflung und Destruktion erretten: Mit der Autorität der Wissenden schreiben die weißen Frauen mit einem in Flammen getauchten Griffel die Geschichte von der Rettung Mos, die Meggie dann liest. Die Figuren des Todes werden so zu Autorinnen des Geschehens. Während vorher die Spannungen in der Unberechenbarkeit, Grausamkeit und Risikohaftigkeit der menschlichen Worte, in dem durch sprachliche Performanz ungeplant Evozierten gelegen hat, schreiben die weißen Frauen mit einem Griffel, der von Farid, einer "versehentlich aus 1001 Nacht herausgelesenen" Figur, schlafwandlerisch entzündet wird. Wind, Flammen und Geheimnis der Worte spielen mit biblischen Assoziationen an die Flammensprache des brennenden Dornbuschs (Exodus 2, 23-4,18) und des Pfingstwunders (Apostelgeschichte 2, 1-13), doch wird das heilige Potential hier auf die Phantasien des feminisierten Todes übertragen. Die phantastische Feuersprache der weißen Frauen unterbricht die sich bekämpfenden narrativen Entwürfe aller menschlichen Figuren und weist auf die Grenzen menschlicher Phantasiekapazität. Im Gespräch mit Mo stellt sich der Tod als "Große Wandlerin" (259) vor und als Autorität des Landes, "in dem es keine Worte gibt und aus dem doch alle Worte kommen." Die prälinguistische Präsenz des Todes präsentiert das Zwischen aller Sprachen und Geschichten, ermöglicht all ihre Verwicklungen, doch rächt er sich an allen, die versuchen, ihn dadurch zu kontrollieren, daß sie ihn selbst vernichten -- den Tod töten, um Unsterblichkeit zu fabrizieren. Die Geschichten schreiben und lesen sich fort, ohne daß ihre Agenten sie ganz zu kontrollieren vermögen, denn der Tod beharrt auf seinem Mitspracherecht. |
||||
Funke entwickelt immer wieder überraschend unvertraute Züge aus den Brüchen zwischen den sich verwickelnden Geschichten, die von den teilweise antagonistischen Autoren, ihren Kopierern, Vorlesern und anderen sich immer mehr autonomisierenden Figuren weitergesponnen werden. Das Zwischen der Worte verselbstständigt sich immer dann, wenn niemand damit rechnet. Die am Anfang des 20. Jahrhunderts viel diskutierte Sprachkrise, für die gerade Hugo von Hofmannsthals Chandos-Brief Parade steht, wird bei Funke zum Spielfeld der Phantasien, die die Figuren teils öffentlich, teils geheim entwerfen. Sie können sich der Diskurse, an denen sie teilnehmen, nie ganz bewußt sein, da deren Arbitrarität sich den jeweiligen Kalkulationen entzieht. Funke spielt mit dem Charm des Kontingenten, das sich zwischen sprachliche und außersprachliche Realitäten schiebt. Der Tod ist hier keine absolute Grenze wie in den romantischen Texten, die in Katastrophe oder Utopie enden, oder auch in Die Unendliche Geschichte, die durch den Tod der Phantasie bedroht wird. Letztere schließt am Schluß einen Kompromiß und domestiziert die Phantasie für die bürgerliche Psyche. In Tintentod dagegen spielt er eine immer aktivere Rolle in der Weiterentwicklung des Tintentraumas, das trotz Brutalität und ständiger Lebensbedrohung so fasziniert, daß ihm am Schluß niemand mehr entfliehen will, obwohl ein jeder neuer Geschichtsstrang immer wieder ein lebensbedrohliches Gewaltpotential produziert. Dies führt bei Caprikorn, Basta, Natternkopf, Hänfling und Orpheus zur Sehnsucht nach absolutistischer Willkürherrschaft, bei Mortimer, Eichelhäher und dem schwarzen Prinzen zur Menschlichkeit, die am Schluß von Tintentod dominiert, aber längst nicht garantiert ist. Fenoglio versteht dies sehr gut, wenn er Meggie, die um das Überleben ihres Vaters zittert, erklärt: "Dein Vater ist nicht meiner Worte wegen auf die Burg von Ombra geritten, sondern für die Kinder. [...] Vielleicht verändert diese Geschichte ihn, aber er verändert auch diese Geschichte. Er erzählt sie weiter, Meggie, durch das, was er tut, nicht durch das was ich schreibe. Auch wenn die richtigen Worte ihm dabei vielleicht helfen könnten [...]". (Tintentod, S. 466) Die Wiederholung von "vielleicht" zeigt die Unsicherheit darüber, wie fiktionale und konkrete Realitäten zusammenspielen. Gerade diese totale und für Mortimer lebensbedrohliche Unsicherheit hindert ihn nicht, sein Leben immer wieder aufs Spiel zu setzen. Insofern realisiert er eine Ethik, von der Judith Butler fordert, "uns eben dort auf Spiel zu setzen, in diesen Momenten des Unwissens, wo das, was uns bedingt und uns vorausliegt, voneinander abweicht, wo in unserer Bereitschaft, anders zu werden, als dieses Subjekt zugrunde zu gehen, unsere Chance liegt, menschlich zu werden, ein Werden, dessen Notwendigkeit kein Ende kennt." (Kritik der ethischen Gewalt, S. 144) |
||||
In über 2000 Seiten lassen Funkes Texte vielfältigste Fantasien, Träume und Ideologien aufeinanderprallen, um sie so zu destabilisieren und ihre Innovation immer wieder zu stimulieren. Die einzelnen Charaktere können sich nie vollständig über die Prinzipien ihrer Denk-, Schreib-, Lese und Phantasieprozesse Rechenschaft geben. Kein narrativer Zug ist von seiner Fixierung oder Ideologisierung von Werten, die immer auch Gegenpotentiale der Gewalt produzieren, ganz frei. Da jede Geschichte immer wieder unterbrochen wird, entzieht sich auch ihre jeweilige Ethik die eigene Basis -- es sei denn, die Figuren machen aus dieser Not eine Tugend und kalkulieren gerade das nicht berechenbare Risiko des Anderen, des Todes, -- also das Nichteinkalkulierbare -- mit ein. |
||||
|
autoreninfo

Dorothee Ostmeier (Associate Professor am Department of German and Scandinavian der University of Oregon) konzentriert sich in Lehre und Forschung auf Grenzzonen zwischen Literatur, Kultur und Philosophie vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Neben Arbeiten zu Nelly Sachs' sprachphilosophischer Poetik veröffentlichte sie in den letzten Jahren Essays zu Gender-Konstruktionen in den Dialogen von DichterInnen des frühen 20. Jahrhunderts. Im Kontext ihrer Seminare zur Tradition der Märchen, Magien und des Unheimlichen arbeitet sie an poetischen Zwischenwelten, die Fiktionen und Realitäten aneinanderbinden, magisch unberechenbare Phänomene stilisieren und Identitätsstrukturen, rationale und ethische Systeme erschüttern und revidieren.
|
||||
|
|