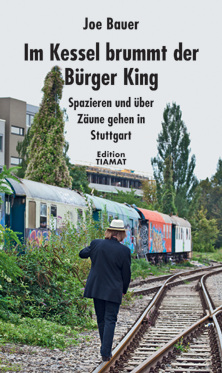|
Die kleine Leonhardstraße
in der Stuttgarter Altstadt riecht selten nach Kehrwoche. Der Asphalt und einige
Häuser sehen so mitgenommen aus wie die Frauen an der Ecke. Die Gegend zählt zum
historischen Kern der baden-württembergischen Hauptstadt, wahrgenommen wird sie
heute fast nur noch als Hort der Elendsprostitution. Die Historie des
Leonhardsviertels hat man im Rathaus vergessen und verdrängt wie viele Kapitel
der Stadtgeschichte. Vor Weihnachten 2013 organisierten Bürger eine Suppenküche
unter dem Motto: »Unsere Altstadt darf nicht vor die Hunde gehen!«

Im Haus Nummer acht der Leonhardstraße findet sich ein Animierschuppen namens
»Bierorgel«. Es gibt Überlebende, die dabei waren, als sich im Erdgeschoss und
Keller dieses Gebäudes die sozialistischen Rebellen trafen. Einer von ihnen ist
der Kabarettist, Autor und Aktivist Peter Grohmann. Vor einigen Jahren hat er
»Die Anstifter« ins Leben gerufen, eine Initiative, die mit den Stolpersteinen
des Berliner Künstlers Gunter Demnig an die Opfer der Nazis erinnert. Grohmann,
1937 in Breslau geboren, war in Stuttgart Mitbegründer des
politisch-literarischen Clubs Voltaire.

1965 eröffnen die Mitglieder im Haus eines liberalen Vorort-Bäckers namens
Fröschle am Straßenstrich den Club Voltaire. Zu den maßgeblichen Köpfen dieses
Ladens gehören neben dem gelernten Schriftsetzer Grohmann der Arbeiter Willi
Hoss, Schweißer beim Daimler, und Fritz Lamm, Angestellter und Betriebsrat der
»Stuttgarter Zeitung«. Lamm, 1911 in Stettin geboren, ist der charismatische
Mentor im Club Voltaire. Während der Nazi-Diktatur mehrfach verhaftet, floh er
über Frankreich und Casablanca nach Havanna. Erst 1948 konnte er zurück nach
Deutschland und ging nach Stuttgart. Der Journalist, ein jüdischer Sozialist mit
weltmännischem Lebensstil, wird 1963 aus der SPD ausgeschlossen. Immer wieder
verleumden ihn die Sozis wegen seiner Homosexualität. Lamms Freunde im Club
Voltaire schätzen ihn als Ehrenmann und großen Rhetoriker.

Der Treff hat seine Wurzeln in der Arbeiterbewegung, die Gründerväter kommen wie
Willi Hoss, der spätere Grünen-Politiker, aus der KPD und deren Umfeld. Eine
wichtige Rolle spielt der Jazz-Pianist Wolfgang Dauner: Als gelernter Mechaniker
und studierter Musiker verkörpert er die kulturellen Pole des Clubs.

In diese Atmosphäre platzt Joseph Fischer. Der 1948 geborene Sohn eines
ungarischen Metzgers aus dem nahen Fellbach-Oeffingen hat 1965 vorzeitig das Bad
Cannstatter Daimler-Gymnasium verlassen und eine Fotografenlehre begonnen.
Legendär die Geschichte, wie Grohmann gerade die Wände des Voltaire-Kellers
streicht, als Fischer ihn fragt, was der kleinbürgerliche Scheiß zu bedeuten
habe. Er schnippt seine Zigarette in den Farbeimer und kommentiert das mit den
Worten: »Schöner Wohnen!« Auf diese Art macht Joseph »Joschka« Fischer in
Stuttgart seine politische Grundausbildung, 1968 zieht er nach Frankfurt weiter.

Als der Voltaire-Veteran Grohmann fast ein halbes Jahrhundert später wieder
mitten in der Stadt an die Front des Protests muss, weil konservative Politiker
und die Deutsche Bahn AG das Immobilienprojekt Stuttgart 21 vorantreiben,
begreift er die Reaktionen der Bürger nicht. Täglich verbreiten auswärtige
Medien das abgedroschene Vorurteil, es sei eine Sensation, »ausgerechnet die
biederen Schwaben« gehen auf die Straße. Offensichtlich kennen die meisten
dieser Leute weder Gegenwart noch Geschichte dieses widerborstigen Volks. Der
Filz aus 58 Jahren CDU-Regierung im Land hat die Auseinandersetzung mit der
Geschichte stets verhindert und die Wahrheit oft genug verleugnet.


Geht man von der Leonhardstraße 8 ein paar Schritte weiter, in die Jakobstraße
6, steht man vor der kleinen Milieu-Kneipe »Jakob-Stube«. Den Hinweis auf einen
großen Sohn der Stadt an diesem Gebäude suchte man bis vor kurzem vergebens. In
dem Barockhaus wurde am 2. Januar 1807 Wilhelm Zimmermann geboren. Er machte
nicht nur als renitenter  Student
und protestantischer Theologe, als schwäbischer Dichter und
radikaldemokratischer Abgeordneter Furore. Vor allem als Historiker ist er ein
Begriff, mit seinem Buch »Der große deutsche Bauernkrieg« schuf er ein
Standardwerk. Während der Revolution 1848/49 saß Zimmermann in der Frankfurter
Paulskirche in der Nationalversammlung. Der schwäbische Charakterkopf und
fleißige Familienvater schrieb Tausende von Buchseiten und bewahrte sich zeit
seines Lebens seinen rebellischen Geist. Heute ist Wilhelm Zimmermann in seiner
Geburtsstadt so vergessen wie die revolutionären Aufstände im Land, auch wenn
1998, zum 1848er-Jubiläum, Baden-Württembergs Großkopfete eine peinliche
Nostalgie-Show inszenierten. Sie setzten sich die Heckerhüte der Revolutionäre
auf. Student
und protestantischer Theologe, als schwäbischer Dichter und
radikaldemokratischer Abgeordneter Furore. Vor allem als Historiker ist er ein
Begriff, mit seinem Buch »Der große deutsche Bauernkrieg« schuf er ein
Standardwerk. Während der Revolution 1848/49 saß Zimmermann in der Frankfurter
Paulskirche in der Nationalversammlung. Der schwäbische Charakterkopf und
fleißige Familienvater schrieb Tausende von Buchseiten und bewahrte sich zeit
seines Lebens seinen rebellischen Geist. Heute ist Wilhelm Zimmermann in seiner
Geburtsstadt so vergessen wie die revolutionären Aufstände im Land, auch wenn
1998, zum 1848er-Jubiläum, Baden-Württembergs Großkopfete eine peinliche
Nostalgie-Show inszenierten. Sie setzten sich die Heckerhüte der Revolutionäre
auf.

In Zimmermanns Schriften wird deutlich, wie die Politik den Widerstandsgeist im
eigenen Land verdrängt. Es dauert lange, bis man den Maler und Altarkünstler
Jerg Ratgeb, in den Siebzigerjahren des 15. Jahrhunderts in Schwäbisch
Gmünd/Ostalbkreis geboren, auch als Kanzler der aufständischen Bauern im 16.
Jahrhundert würdigte. In Pforzheim, der Heimat des Stuttgarter
Kurzzeit-Ministerpräsidenten Stefan Mappus, war wegen Hochverrats zum Tode
verurteilt und von vier Pferden auseinandergerissen worden.

Der schwäbische Widerstand zieht sich kontinuierlich durch die Geschichte des
Landes, die Rebellen konnten allerdings nicht verhindern, dass man »die
Schwaben« bis heute für biedere, spießige Duckmäuser hält. Maulfaul und
»verdruckt«, geizig und vom Putzwahn besessen. Im Zweifelsfall hilft der Hinweis
auf den schwäbischen Diminutiv, das »Ländle« als Eiland gestriger Tüftler und
Schaffer zu verdummen. Kaum einer weiß es, in Stuttgart leben mehr Ausländer als
in jeder anderen deutschen Stadt. Gegen die Klischees von der Behäbigkeit der
Schwaben, die beim Orgasmus »Sodele« stöhnen, helfen am wenigstens Hinweise auf
vormals populäre Denker wie Hegel und Schiller. Es sind die Vergessenen und
Verdrängten, die zeigen, wie viel Widerspruchsgeist, aber auch Stumpfsinn, im
Land beheimatet ist.

Als eines der wichtigsten Wahrzeichen des Widerstands und seiner Unterdrückung
steht die Festung Hohenasperg bei Ludwigsburg, einst »Demokratenbuckel« genannt,
heute ein Vollzugskrankenhaus. Schon 1525 hat man dort den aus der Gegend von
Heilbronn stammenden Bauernführer Jakob »Jäcklein« Rohrbach gefangengehalten.
Der bekannteste Insasse des neben Stuttgart-Stammheim berüchtigsten schwäbischen
Kerkers ist der 1739 in Obersontheim bei Schwäbisch Hall als Pfarrerssohn
geborene, in Aalen aufgewachsene Dichter und Musiker Christian Friedrich Daniel
Schubart. Zwei Jahre nachdem er Herzog Carl Eugens Mätresse Franziska von
Hohenheim als glimmende, stinkende »Lichtputze« verhöhnt und den heimischen
Menschenhandel mit Englands Militär angeprangert hat, sperrt man ihn 1777 in der
Burgfestung Asperg ein. Ohne Prozess wird Schubart mehr als zehn Jahre in einem
Turmverlies misshandelt, darf lange Zeit weder lesen noch schreiben. Im Mai 1787
setzt ihn Carl Eugen nach der Intervention der Preußen und vieler
Intellektueller auf freien Fuß und ernennt ihn sogar zum Musik- und Theaterchef
am Stuttgarter Herzogshof. Begraben ist Schubart, ein schwäbischer
Freiheitsheld, wie andere große Denker auf dem Stuttgarter Hoppenlaufriedhof,
heute eine Ruhe- und Gedenkstätte, die von der Autostadt angeblich aus
Geldmangel vernachlässigt wird.


Mehr als siebzig Jahre nach Schubart inhaftiert die Obrigkeit einen heute kaum
bekannten Mann auf dem Hohenasperg, der eine wichtige Rolle in der 48-er
Revolution spielen sollte. Es ist der 1816 in Dürrwangen bei Balingen geborene
Glasfabrikant und republikanische Agitator Gottlieb Rau. Vor einer riesigen
Volksversammlung in Heilbronn hält er im Frühsommer 1848 eine aufputschende
Rede: »Es ist der Weg der Wahrheit, der Weg der Entschiedenheit, den wir
einschlagen müssen, denn nur die Wahrheit kann uns frei machen. Wir müssen
wegwerfen jene Halbheit der Gesinnung, jenes unentschiedene Schwanken, das uns
von jeher Knechtschaft und Unterdrückung gebracht hat, und müssen offen bekennen
die Farbe, der wir folgen. Wir müssen laut bekennen, dass das gedankenlose
Geschrei für die konstitutionelle Monarchie mit breitester Grundlage der
Untergang ist für die deutsche Einheit, der Tod für uns und unsere Kinder.«

Rau wird verhaftet und auf die Festung Hohenasperg gebracht. 1851 wird er in
einem spektakulären politischen Prozess zu dreizehn Jahren Haft verurteilt. Als
er 1853 begnadigt wird, geht er nach Amerika und eröffnet in New York ein Hotel,
bald Anlaufstelle für deutsche Einwanderer. In den USA werden die deutschen
Revolutionsflüchtlinge wie Rau als »Fourty Eighters« geführt; viele von ihnen
kämpfen später im amerikanischen Bürgerkrieg mit Abraham Lincoln gegen die
Sklaverei.

Als einer der schillerndsten schwäbischen 48-er-Revolutionäre gilt Albert Dulk.
1819 in Königsberg geboren, landet der Schriftsteller und Revolutionär nach
vielen Reisen, auch nach Italien und Ägypten, 1858 in Stuttgart. Mit seiner
Ehefrau Johanna und zwei weiteren Frauen lebt dieser frühe Hippie in einer WG.
In der Hochzeitsnacht, so heißt es, hat er seiner Frau den Beischlaf verweigert,
weil er nicht etwas machen wollte, »das alle so machen«. Dulk ist Freidenker,
schließt sich der Arbeiterbewegung an und durchschwimmt den Bodensee. Weil er in
Heilbronn wegen Volksverhetzung mehr als ein Jahr Haft absitzen muss, feiern ihn
die Sozialdemokraten als Märtyrer. Am 29. Oktober 1884 stirbt Dulk an
Herzversagen auf dem Stuttgarter Bahnhof. Als man seinen Leichnam nach Gotha
überführt, weil Feuerbestattungen in Württemberg verboten sind, gehen trotz des
gewaltigen Polizeiaufgebots Tausende von Arbeitern auf die Straße. Der Trauerzug
zum Güterbahnhof gilt heute als die größte Demonstration der württembergischen
Sozialdemokraten in der Zeit von Bismarcks berüchtigten Sozialistengesetzen.
Ähnlich viele Widerständler am Bahnhof werden 130 Jahre später wieder beim
Protest gegen Stuttgart 21 gezählt, wenn auch mit geringer SPD-Beteiligung.

Die rote Linie der schwäbischen Rebellen zieht sich im 19. Jahrhundert so
konsequent durch die Geschichte, dass man sich als Schwabe wundert, warum »die
Schwaben« als der Arbeit und dem Konsum verfallene Jasager mit starkem Hang zur
»Gemütlichkeit« gelten. Querdenker schauen zwangsläufig über den Tellerrand
hinaus. Der Dichter Georg Herwegh, 1817 in Stuttgart als Sohn eines Gastwirts
geboren, pflegt Kontakte mit Michail Bakunin und Karl Marx, mit George Sand und
Heinrich Heine.

Im Frühjahr 1848 steht er an der Spitze der deutsch-demokratischen Legion, einer
Freiwilligentruppe von Arbeitern, die den badischen Aufstand bewaffnet
unterstützt. Auf seinen Wunsch wird Herwegh, ein entschiedener Gegner der
Bismarck'schen Machtpolitik, in der Schweiz beerdigt.
Bis heute behaupten selbsternannte Volkskundler in den Medien, schwäbische
Frauen gingen lieber in der Schweiz einkaufen, um ihre von den Pietisten
geschmähte Freude am Luxus zu verbergen. Den Hang zum schwäbischen
Understatement beschrieb der 1813 in Reutlingen geborene Theologe und
Schriftsteller Hermann Kurz als Zweifel an der eigenen Größe: »Die Schwaben
müssen ihre einheimischen Produkte erst vom Ausland plombiert zurückerhalten,
ehe sie daran glauben.« Kurz kämpfte entschieden für die Freiheit der Presse,
weit couragierter als viele Journalisten von heute. 1845 veröffentlichte er die
demokratische Streitschrift »Das freye Wort«; er stritt so unverdrossen für das
Recht auf Meinung, dass er für eine Weile in den Knast musste, auf den
Hohenasperg, wo sonst.

Noch immer ist die öffentliche Aufarbeitung der schwäbischen Rebellen-Geschichte
mühsam, das gilt auch für das 20. Jahrhundert. In den Zwanzigerjahren war das
Leben in der schwäbischen Hauptstadt städtischer und cooler. Bauhaus-Architekten
wie Peter Behrens, Mies van der Rohe und Richard Döcker wirkten in der Stadt,
abstrakte Maler wie Oskar Schlemmer, Alfred Hölzel und Willi Baumeister standen
für eine kulturelle Veränderung, von der man heute in dieser Stadt nur träumen
kann. In diesem Klima der Moderne, des Aufbruchs wächst die 1910 in Stuttgart
geborene Jüdin Gerta Pohorylle heran. Als aufgeweckte junge Frau besuchte sie
Ausstellungen, Varieté-Shows und Sportereignisse. Als Neunzehnjährige zieht sie
mit ihrer Familie nach Leipzig; nachdem sie Flugblätter gegen die Nazis verteilt
hat und erwischt wird, flieht sie nach Paris. Im Exil begegnet sie einem
ungarischen Fotografen namens André Friedmann. Beide werde schon bald unter den
Namen Robert Capa und Gerda (jetzt mit »d«) Taro als engagierte Kriegsfotografen
im Kampf gegen die Faschisten im Spanischen Bürgerkrieg berühmt. 1937 kommt
Gerda Taro bei einem Luftangriff von Hitlers Legion El Condor in der Nähe von
Madrid ums Leben. Den Trauerzug zu ihrer Beerdigung auf dem Pariser Friedhof
Père Lachaise begleiten zigtausend Antifaschisten, Dichter wie Louis Aragon und
Pablo Neruda halten die Grabreden. In Stuttgart dauert es bis 2008, ehe man
Gerda Taro nach Interventionen engagierter Bürger einen (bis heute schäbig
gestalteten) Platz widmet.

Gerda Taros Geschichte wird zurzeit in Hollywood verfilmt, ins CDU-geführte
Baden-Württemberg passte sie so wenig wie die vielen, nicht mit Soldatenorden
geschmückten Widerstandskämpfer der Nazi-Diktatur, beispielsweise die
Stuttgarter Gruppe Schlotterbeck. Da gibt es die Geschichte vom Stuttgarter
»Kabelattentat«. Vier junge Kommunisten beendeten am 15. Mai 1933 die
Rundfunk-Übertragung von Hitlers Rede mit dem Hackebeil. Kurz zuvor, am 30.
Januar 1933, waren in der Nähe von Reutlingen die Textilarbeiter in den
inzwischen berühmten Mössinger Generalstreik getreten. Bis heute gilt diese von
der KPD organisierte Widerstandsaktion in der nur 4200 Seelen zählenden Gemeinde
am Fuß der Schwäbischen Alb als in Deutschland einzigartiger Versuch, Hitlers
sogenannte Machtübernahme zu verhindern. Die Nazis vertuschten den mutigen
Aufstand.


Wie beim Mössinger Generalstreik brauchte es bei anderen antifaschistischen
Heldentaten Jahrzehnte, bis man im Schwäbischen an Menschen erinnerte, die im
Kampf gegen den Faschismus ihr Leben ließen, wie der in Königsbronn auf der
Ostalb aufgewachsene Schreiner Georg Elser. Am 8. November 1939 ging bei einer
Nazi-Feier im Münchner Bürgerbräukeller eine Bombe hoch, die Elser in
nächtelanger Arbeit in eine Säule eingebaut hatte. Hitler überlebte, weil er
vorzeitig den Saal verlassen hatte, um wegen des sich anbahnenden schlechten
Wetters früher als geplant in sein Flugzeug zu steigen.

Das Vertuschen der Vergangenheit, die Mär, der einfache Mann habe gegen die
Nazis nichts tun können, dürfte auch ein Grund gewesen sein, dass die
Baader-Meinhof-Gruppe maßgebliche Mitglieder und Unterstützer im Schwäbischen
rekrutierte: die Pfarrerstochter Gudrun Ensslin, den Gastwirtssohn Willy-Peter
Stoll, den Künstlersohn Christof Wackernagel. Einer der besten Kenner der Szene
war der lange in Stuttgart lebende Schriftsteller und Rechtsanwalt Peter O.
Chotjewitz; er vertrat Baader in den Siebzigern im Stammheimer Prozess. Als er
im Dezember 2010 starb, wurde er auf seinen Wunsch auf dem Stuttgarter
Dornhaldenfriedhof beerdigt. Dort ist auch das Grab von Ensslin, Baader und
Jan-Carl Raspe. Chotjewitz erzählte gern, das schwäbische, vor allem das
Stuttgarter Bürgertum habe aus seiner liberalen, rebellischen Tradition heraus
eine Zeitlang RAF-Ideen unterstützt, und damit meinte er nicht nur Anwälte wie
den 2002 verstorbenen Klaus Croissant und den, nach achtjähriger Abwesenheit in
Beirut, seit 1986 wieder ehrbar praktizierenden Jörg »Jogi« Lang. In seinen
Erinnerungen hat der vielgereiste Schriftsteller Chotjewitz dem rebellischen
Stuttgart ein Denkmal gesetzt: »In Stuttgart hat im August 1907 unter
Beteiligung von Lenin und anderen ein Sozialistenkongress stattgefunden, der
erste sozialistische Weltfrauenkongress hat vor dem Ersten Weltkrieg in
Stuttgart stattgefunden, in Stuttgart konnte Clara Zetkin Hauslehrerin bei dem
Kapitalisten Robert Bosch sein … und nach dem Krieg hatten wir einen Kommunisten
namens Eugen Eberle, der bundesweit bekannt war, vierzig Jahre lang im
Gemeinderat.«

Zu den bekanntesten schwäbischen Querköpfen zählt auch der Obstbaukundler,
Baumschneider und Bürgerrechtler Helmut Palmer. 1930 als unehelicher Sohn einer
christlichen Bauerntochter und eines jüdischen verheirateten Metzgers in
Stuttgart geboren, kämpft er in kernigem Schwäbisch gegen Altnazis, staatliche
Willkür und wird als »Remstal-Rebell« gefürchtet und verehrt. Der Gärtner mit
seiner virtuosen Baumschnitt-Begabung kandidiert regelmäßig als Einzelkämpfer
bei Wahlen und sitzt wegen seiner Streitbarkeit auch im Knast. 1974 holt er zum
Schrecken der konventionellen Parteien bei den Oberbürgermeisterwahlen in
Schwäbische Hall mehr als vierzig Prozent der Stimmen. 2004 stirbt er in
Tübingen an Krebs. Kaum mehr als drei Jahre später wird sein Sohn Boris als
konservativer Grüner Oberbürgermeister von Tübingen und signalisiert damit
bereits eine politische Entwicklung in Baden-Württemberg. 2011 kommen im Land
die Grünen an die Macht, und der neue Ministerpräsident Kretschmann ist sehr
darum bemüht, seine Vergangenheit in der KPD/ML als mentalen Unfall in seiner
Biografie darzustellen.

Wenn viele Bürger heute immer noch gegen Stuttgart 21 auf die Straße gehen, wenn
sich anständige und verdiente Männer wie der unermüdliche Kulturarbeiter Peter
Grohmann gegen die Politik des Größenwahns auflehnen, erinnert das die Medien
nicht etwa an gescheite, radikaldemokratische Köpfe vom Schlage Friedrich
Schillers und Ludwig Uhlands. Ahnungslose Reporter faseln seit Jahrzehnten
lieber was von Kehrwoche, von frühzeitig hochgeklappten Gehsteigen und
»Wutbürgern« in Halbhöhenlage.

Die Floskel vom schwäbischen Spießer macht deshalb weiterhin so hartnäckig die
Runde wie bei selbstironischen Landsleuten ein alter Witz über ihre angebliche
Lustfeindlichkeit: »Warum haben die schwäbischen Pietisten Sex im Stehen
verboten? Er könnte in Tanz ausarten.«

|
Neue
Geschichten
von Joe Bauer:
Im Kessel
brummt der Bürger King
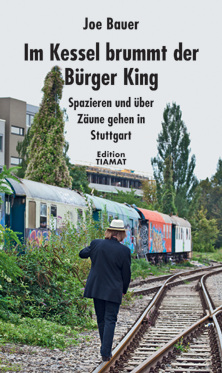 Spazieren und über Zäune gehen in
Stuttgart Spazieren und über Zäune gehen in
Stuttgart
Edition Tiamat
Critica Diabolis 202
Broschur, 192 Seiten
14.- Euro
978-3-89320-171-6
Leseprobe
Joe Bauer
schreibt über die Tiefen und Abgründe des Talkessels. Seine
Spaziergänger-Geschichten führen in den Mythos von Stammheim, in die
Relikte des Rotlichtmilieus und an einen lebensgefährlichen
Wasserfall. Immer wieder auch zu den Stuttgarter Kickers.
|
 Glanz&Elend
Glanz&Elend