|
|
||
|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
||
|
Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie Impressum & Datenschutz |
||
|
|
||
|
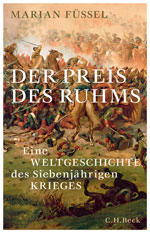 |
Eine Küchengeschichte des
Siebenjährigen Krieges |
|
|
Der Preuße Georg Wilhelm Tempellhoff war wohl der erste Autor, der Ende des 18. Jahrhunderts von einem „Siebenjährigen Krieg“ sprach, andere bezeichneten die Auseinandersetzung zwischen Preußen, Österreich und Russland auch als den Dritten schlesischen Krieg. In Kanada und den Neuenglandstaaten wiederum nannte man die zeitgleiche Auseinandersetzung zwischen den Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien den French and Indian War und in Russland sprach man vom Preußischen Krieg. Fraglos war der Siebenjährige Krieg eine globale Auseinandersetzung. Dies war er aber nicht etwa deshalb, weil zwischen 1755 und 1763 an verschiedensten Punkten in der Welt zur gleichen Zeit gekämpft wurde und dabei außer den europäischen Mächten auch lokale Akteure mit ihren eigenen Zielsetzungen einbezogen waren. Das Besondere am Siebenjährigen Krieg war tatsächlich, dass er im Gegensatz zu allen vorangegangenen großen europäischen Konflikten seit dem Pfälzischen Erbefolgekrieg bis zum Österreichischen Erbfolgekriege erstmals auf außereuropäische Ursachen zurückging. Vom umkämpften Ohiotal sprang der Funke nach Europa und belebte dort die nicht wirklich gelösten Rivalitäten aufs Neue. Frankreich fürchtete um seinen amerikanischen Besitz, der sich in einem lockeren Halbkreis von Louisana im Süden über die großen Seen bis zur St. Lorenz-Bucht erstreckte und die bevölkerungsreichen Neuenglandstaaten auf einen schmalen Küstensaum beschränkten. Auf Dauer zu halten war dieses ausgedehnte Gebiet freilich nur durch eine den Briten ebenbürtige Kriegsflotte, die Frankreich aber nicht besaß und in absehbarer Zeit auch nicht aufstellen konnte. Ging aber das nordamerikanische Festland verloren, drohte Frankreich auch der Verlust seiner ertragreichen Zuckerrohrinseln in der Karibik. Ein Kollaps des Staatshaushaltes wäre die unausweichliche Folge. Einzig durch die Besetzung eines europäischen Faustpfandes, das einen hohen Wert für Großbritannien besaß, ließ sich, so das Versailler Kalkül, die drohende Entwicklung noch abwenden. Infrage kamen die österreichischen Niederlande, im Wesentlichen das heutige Belgien oder das Kurfürstentum Hannover, das deutsche Stammterritorium König Georgs II., dass er zum Leidwesen der britischen Politiker immer noch in Personalunion regierte. Da sich Frankreich im bevorstehenden Krieg mit dem Inselkönigreich nicht noch Österreich zum Gegner machen wollte, blieb ihm nur das norddeutsche Kurfürstentum als lohnendes Ziel. Preußen als bisheriger Alliierter Frankreichs war jedoch mit Russland und Österreich im Rücken nicht bereit, für Versailles die Kastanien aus dem Feuer zu holen und schloss stattdessen im Januar 1756 die Konvention von Westminster, die das deutschsprachige Reichsgebiet vor einem Angriff Dritter schützen sollte. Das sich düpiert fühlende Versailles entschloss sich daraufhin zu einem Wechsel der Allianzen und näherte sich dem schon lange werbenden Österreich an. Während Wien hoffte, mit Frankreichs starker Armee das entscheidende Übergewicht über Preußen gewonnen zu haben und zielbewusst auf einen Krieg mit dem Hohenzollernstaat zusteuerte, spekulierten die Franzosen insgeheim darauf, mit der stillschweigenden Billigung des Kaiserpaares das Kurfürstentum Hannover, einen immerhin neutralen Reichsstand, angreifen zu dürfen. So wurde aus dem Konflikt um das amerikanische Ohiotal ein neuerlicher Waffengang um Schlesien herauf beschworen.
Dem Göttinger
Professor Marian Füssel geht es indes in seiner jetzt beim Beck-Verlag in
München erschienenen 600-seitigen Monografie über den Siebenjährigen Krieg nicht
um derartig trockene strategische Kalküle. Er möchte neue Wege beschreiten und
jenseits der Kabinettsbeschlüssen und Memoranden eine multiperspektivische Sicht
auf das weltumspannende Geschehen präsentieren, eine Sicht vor allem der
einfachen Leute auf diesen Krieg. Insgesamt wird Füssel seinem Anspruch nicht gerecht, den Siebenjährigen Krieg als einen globalen Krieg darzustellen. Zwar schildert er die Kriegsereignisse auf den einzelnen Kriegsschauplätzen oft sehr ausführlich, doch bringt er jenseits der ausführlich referierten Details keine wirkliche Vernetzung der weltweiten Geschehnisse zustande. Dass Frankreich im Reich nicht Krieg gegen Preußen führte, sondern wenigstens bis zur Schlacht von Minden (1759) versuchte, das Kurfürstentum Hannover zu besetzen, hat Füssel offenbar gar nicht begriffen. Prinz Ferdinand von Braunschweig, der Sieger von Minden, bleibt bei ihm weiterhin ein preußischer General, der Friedrichs westliche Flanke verteidigte, obwohl er seine Befehle und Geldmittel längst aus London erhielt. Die Schlachtverläufe des Kriegs liest man, sofern es vielleicht noch interessiert, überhaupt besser bei anderen Autoren nach. Dafür erfährt man in Füssels Buch viel von den Sichtweisen der Zeitgenossen, was wie gesagt gut und wichtig ist, um auch einen kulturgeschichtlichen Aspekt ins Spiel zu bringen, aber eben nicht immer relevant. Inwiefern etwa vergrößert die Sichtweise des Bäckermeisters Jürgen Abelmann aus Hannover, den Füssel gleich eingangs auf anderthalb Seiten zu Wort kommen lässt, der aber außer der Besetzung Hannovers durch die Franzosen im Winter 1757/58 nicht ein einziges Ereignis des Krieges selbst erlebt hat, unser Wissen über diesen Krieg? Da stehen dann solche Sätze wie: "Das wallende Meer in seinen Fluten mit Menschenblut bespritz! Die Donnerwetter mit niedergeschlagenem Hagel! Die Fluten der Ströme und meilenweite Felder ersäuft!" Füssel adelt den Text als "Nahsicht", doch mancher Leser dürfte am Ende nur fragen: So what!
Zu der vom
Verlag versprochenen "spannenden Darstellung" dürfte wohl auch Füssels betont
gekünstelte Wissenschaftssprache kaum passen, von der hier auch ein Beispiel
zitiert werden soll: "Im Sinne eines dialektischen Wechselspiels von durch den
Krieg forcierten Vergleichsanreizen bzw. Möglichkeiten und den Vollzügen
konkreter Vergleichspraktiken verstärkte sich das [unfreiwillige Vergleichen von
Menschen unterschiedlicher Herkunft] wechselseitig". Im Zusammenhang mit der
Schlacht von Prag (6. Mai 1757) spricht Füssel im selben Stil von
"naturräumlichen Gegebenheiten". Kann man nicht einfach nur "Gelände" schreiben?
|
Marian Füssel |
|
|
|
||