|
|
||
|
Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
||
|
Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie Impressum & Datenschutz |
||
|
|
||
|
 Uwe Schütte Annäherungen Sieben Essays zu W.G. Sebald Böhlau Verlag 275 Seiten, mit 7 s/w-Abb., gebunden 23,99 € 978-3-412-51381-8
|
Enzyklopädie der Melancholie |
|
|
Einer
breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist Sebald vor allem durch seine
späten, erzählenden Werke, zunächst im angloamerikanischen Raum, über diesen
Umweg auch in seinem ungeliebten Heimatland, und durch die Züricher Vorlesungen,
die 1997 unter dem Titel Luftkrieg und Literatur veröffentlicht wurden.
Die Hauptthese dieser Vorlesungen von der ausgebliebenen Trauerarbeit über die
größte nationale Katastrophe Deutschlands, die Sebald zufolge nach Kriegsende
literarisch niemals angemessen
aufgearbeitet wurde, sorgte kurzfristig für einen Eklat im deutschen Feuilleton.
Ein Rascheln sollte es wieder nur gewesen sein im Blätterwald, ein Beben von
mittlerer Stärke auf der Richterskala der täglichen Hiobsmeldungen, wie man im
Nachhinein feststellen muss. Vergessen scheint heute wieder, was damals immerhin
Anlass für eine öffentliche Diskussion war. Ein Lapsus, der Sebalds provokanten
Befund von der Erinnerungslosigkeit der Deutschen freilich nur bestätigt, wenn
man fairerweise hinzufügt, dass der Gedächtnisschwund heute längst ein globaler
ist, also nicht nur das Ergebnis einer nationalen Verdrängungsleistung im
Dienste des unmittelbaren Überlebens, sondern Produkt der Überforderung durch
die medial vermittelte Informationsflut, eine synchrone Begleiterscheinung der
Nachrichtenexplosion.
Warum heute, wo das Aufspüren
und Erforschen sozialer, ethnischer und kultureller Randzonen selbst zu einem
prestigeträchtigen, autonomen Forschungszweig innerhalb der Kulturwissenschaften
mutiert ist, Sebalds literarisches Erbe noch immer seltsam anachronistisch
anmutet, wird noch zu klären sein. Weil aber vom Unzeitgemäßen mitunter der
nachhaltigste Anreiz ausgeht, ist der Ruhm dieses Werks untergründig gewachsen,
sprunghaft zuletzt durch die tragischen Umstände von Sebalds eigenem Ende, das
den sehr persönlichen Charakter seines literarischen Unterfangens noch einmal zu
unterstreichen schien. Denn Sebald nahm offenbar tatsächlich aus persönlicher
Neigung auf sich, was heute nicht selten nur noch durch professionelle
Profilierungssucht motiviert ist. Die Radikalität seiner Position, die singuläre
Gestalt seines mäandernden, im hohen Ton der Elegie verfassten Spätwerks lässt
sich vielleicht am besten ermessen, indem man ihr den Realismus der
Trümmerliteratur gegenüberstellt. Sachverstand und Kompromissbereitschaft waren
die Gebote der Stunde Null, die jene, denen die undankbare Aufgabe
zufiel, von einer traumatisierenden Vergangenheit in eine lebbare Gegenwart und
vertrauensvollere Zukunft überzuführen, zu einem Ton konzilianter Offenheit
verpflichtete. Melancholisches Mitgefühl leitet daher den Blick dieses gestrengen Phänomenologen, leitet, aber trübt ihn nicht. Vor dem Abdriften ins Trüb-Sentimentalische bewahrt seine Melancholie ihre konkrete, historische Perspektive und eine intellektuelle Disziplin, die in der Literatur heute ihresgleichen sucht. Der Ambivalenz jedes großen literarischen Unternehmens, das sich vorzugsweise an Zustände und Leidenschaften heftet, die sie vorgeben muss, beseitigen zu wollen, entgeht freilich auch Sebald dadurch nicht. Er ist sich ihrer schließlich selber durchaus bewusst, etwa wenn er nach den versteckten Motiven seiner Forschungsinteressen fragt und sie schließlich in dem Trauma seiner Kindheit gefunden zu haben meint. Einer Kindheit, die, wie er zugibt, zwar relativ glimpflich verlief „in einer von den unmittelbaren Auswirkungen der sogenannten Kampfhandlungen weitgehend verschonten Gegend“. Dennoch sei es ihm „bis heute, wenn ich Photographien oder dokumentarische Filme aus dem Krieg sehe, als stammte ich, sozusagen, von ihm ab und als fiele von dorther, von diesen von mir gar nicht erlebten Schrecknissen, ein Schatten auf mich, unter dem ich nie ganz herauskommen werde. (LuL) Kaum etwas, schreibt er an anderer Stelle, verbinde er mehr mit dem Wort Stadt „als Schutthalden, Brandmauern und Fensterlöcher, durch die man in die leere Luft sehen konnte“(A), weshalb eben diese Bilder der Zerstörung „perverserweise, und nicht die ganz irreal gewordenen frühkindlichen Idyllen, (...) so etwas wie ein Heimatgefühl in mir hervorrufen.“ (LuL) Was war, lebt allein in den Nachwehen fort, die Gegenwart ist in der Vergangenheit nur als Phantomschmerz, welcher Erinnerung konstituiert, überhaupt greifbar.
Dass die Traurigkeit der
Melancholie grundlos sei, ist eine psychologische Binsenweisheit und meint, dass
nicht die Realität des Objekts, sondern die Tiefe der Empfindung seines
Verlustes ausschlaggebend sei für die Herausbildung der Krankheit, die
Identifikation des Melancholikers mit dem verlorenen Gegenstand. Bemerkenswert
an Sebalds persönlichem Fall aber ist, dass seine Schwermut eine kollektive
Amnesie zum gegenstandslosen Gegenstand hat. Mehr als von der inneren
Gestimmtheit des Melancholikers erfährt man daher in diesem Werk von den
gesellschaftlichen Determinanten des persönlichen Curriculum, das für gewöhnlich
einen Leidensweg verzeichnet, dessen Lauf sich zurückverfolgen lässt manchmal
bis in weit hinter die eigene Geburt zurückreichende, kollektive
Schuldzusammenhänge. Über die Komplexität solcher Zusammenhänge von kollektivem
Verhängnis und individuellem Schicksal, Zeitgeschichte und Biographie vermitteln
Sebalds akribisch recherchierte Texte und Dokumente so manches. Wie auch über
die Notwendigkeit der Empörung. Empörung als Zurückweisung jenes Teils der
eigenen Leidensgeschichte, der nicht endogen ist, und für den der Kliniker die
Gründe nicht in der Psychologie des Patienten suchen muss, sondern in der
Sozialpathologie des gesellschaftlichen Umfelds. Ich trinke Bier in kleinen Schlucken, stehe da weiter mit dem Weihnachtskuchen im Arm, und ich begreife, daß es tatsächlich ein Drecksvolk ist mit ihren Kellnern und Frisören, ihren Verhaltensweisen, die arrogant sind, wenn sie sich bedienen lassen können, mit ihrer kleinkrämerhaften Agilität, ihrer Comichaften Unruhe, ihrem Kinder-Fetischismus und ihrem sogenannten „leichteren“ Leben, das nichts anderes heißt als verwohnen, zersiedeln, auswohnen, mit ihren Papst- und Madonnenbildern, mit ihrer blödsinnigen römischen Vergangenheit, die nichts als Ruinen sind, und mir wird das alles an winzigen Einzelheiten klar, an großen Löchern in den Wänden aus Pappe an der Treppe und den geschniegelten Frisuren der Leute, „dolce far niente“ am Arsch, (...) „der liebliche Süden“: ein Autofriedhof. Dann Steine, Wäsche, was sonst noch? Elektrische bunte Lichter, die mechanisch an und ausgehen. „Bene“? In Ruinen sind amerikanische Automaten installiert. Was geht das mich an, ich bin für die Verrottung nicht verantwortlich, ich habe auch keinen romantischen Blick dafür. Ich hau ab. Davon habe ich genug gesehen. (Rolf Dieter Brinkmann) Oder so: Unbegreiflich erschien es mir jetzt, als ich nach Lowestoft hineinging, wie es in einer verhältnismäßig so kurzen Zeit so weit hatte herunterkommen können.(...) Gleich einem unterirdischen Brand und dann wie ein Lauffeuer hatte der Schaden sich fortgefressen, Bootswerften und Fabriken waren geschlossen worden, eine um die andere, bis für Lowestoft als einziges nur noch die Tatsache sprach, daß es den östlichsten Punkt markierte auf der Karte der britischen Inseln. Heute steht in manchen Straßen der Stadt fast jedes zweite Haus zum Verkauf, Unternehmer, Geschäftsleute und Privatpersonen versinken immer weiter in ihren Schulden, Woche für Woche hängt irgendein Arbeitsloser oder Bankrotteur sich auf, der Analphabetismus hat bereits ein Viertel der Bevölkerung erfaßt, und ein Ende der stetig fortschreitenden Verelendung ist nirgends abzusehen. Obgleich mir dies alles bekannt war, bin ich nicht vorbereitet gewesen auf die Trostlosigkeit, die einen in Lowestoft sogleich erfaßt, denn es ist eine Sache, in den Zeitungen Berichte über sogenannte unemployment blackspots zu lesen, und eine andere, an einem lichtlosen Abend durch Zeilen der Reihenhäuser mit ihren verschandelten Fassaden und grotesken Vorgärtchen zu gehen und, wenn man endlich angelangt ist in der Mitte der Stadt, nichts vorzufinden als Spielsalons, Bingohallen, Betting Shops, Videoläden, Pubs, aus deren dunklen Türöffnungen es nach saurem Bier riecht, Billigmärkte und zweifelhafte Bed&Breakfest Etablissements mit Namen wie Ocean Dawn, Beachcomber, Balmoral Albion und Layla Lorraine. (RdS)
Es sind Stellen wie diese,
die Susan Sontag vielleicht zu der defätistischen Bemerkung veranlasste, Sebald
vermittle in seinen Büchern etwas von dem Lebensgefühl eines Abendländers am
Ende der abenländischen Zivilisation. Und wirklich erscheint der Okzident darin
als Flucht- und Endpunkt gleichermaßen der allgemeinen zivilisatorischen
Entwicklung. Wem das Schreckliche so nahe rückt, der muss es nicht mehr in der Weite suchen. Sebald jedenfalls genügte schon ein kleines Hotelzimmer in einer mitteleuropäischen Stadt, um direkt ins Herz der Finsternis vorzustoßen und Exemplarisches über unsere Gegenwart, wie er sie nun einmal vorfand, zu sagen. (Und man kann die folgende Stelle nicht lesen, ohne mit Entsetzen an Sebalds eigenen gewaltsamen und anonymen Tod zu denken, den er auf der Straße fand, in seiner Wahlheimat England immerhin, wie übrigens auch Brinkmann): Wie oft, dachte ich mir, bin ich nicht schon so in einem Hotelzimmer gelegen, in Wien, in Frankfurt oder in Brüssel, und habe, die Hände unterm Kopf verschränkt, nicht wie hier auf die Stille, sondern mit wachem Entsetzen auf die Brandung des Verkehrs gehorcht, die zuvor schon stundenlang über mich hinweggegangen war. Das also ist, habe ich mir dann immer gedacht, der neue Ozean. Unaufhörlich, in großen Schüben über die ganze Breite der Städte kommen die Wellen daher, werden lauter und lauter, richten sich weiter und weiter auf, überschlagen sich in einer Art Phrenesie auf der Höhe des Lärmpegels und laufen als Becher aus über Asphalt und die Steine, während von den Stauwehren an den Ampeln bereits neue Wogen hereinrauschen. Ich bin im Verlauf der Jahre zu dem Schluß gelangt, daß aus diesem Getöse jetzt das Leben entsteht, das nach uns kommt und das uns langsam zugrunde richten wird, so wie wir das langsam zugrunde richten, was da war lange vor uns. (SG) Es gibt zu dieser Stelle im Werk Sebalds eine andere, die sie ergänzt und weiterdenkt. Sie hält in einer ausgedehnten Bewegung, ähnlich einer langen und langsamen Kamerafahrt, den Blick des Reisenden aus dem Fenster eines Flugzeugs auf das Land unten fest. So, aus der Vogelperspektive betrachtet, erscheint es wieder weit und der im Zoom fokussierte Horror in luftiger Höhe aufgehoben in einer Schwerelosigkeit, Leichtigkeit ohnegleichen. Das Meer ist nun nicht mehr der ununterbrochen brandende Verkehr, sondern wird am Horizont sichtbar als grün schimmernder Dunstkreis so wie dem Auge des Astronauten der ganze Planet vielleicht in der unvorstellbaren Entfernung, die die von allen guten Geistern verlassene Erde wieder sich selbst überlässt: Nirgends aber sah man auch nur einen einzigen Menschen. Gleich ob man über Neufundland fliegt oder bei Einbruch der Nacht über das von Boston bis Philadelphia reichende Lichtergewimmel, über die wie Perlmutt schimmernden Wüsten Arabiens, über das Ruhrgebiet oder den Frankfurter Raum, es ist immer, als gäbe es keine Menschen, als gäbe es nur das, was sie geschaffen haben und worin sie sich verbergen. Man sieht die Wohnstätten und die Wege, die sie verbinden, man sieht den Rauch, der aufsteigt aus ihren Behausungen und Produktionsstätten, man sieht die Fahrzeuge, in denen sie sitzen, aber die Menschen selber sieht man nicht. (...) Wenn wir uns so aus der Höhe betrachten, ist es entsetzlich, wie wenig wir wissen über uns selbst, über unsern Zweck und unser Ende, dachte ich mir, als wir die Küste hinter uns ließen und hinausflogen über das gallertgrüne Meer. (RdS)
Zitate aus:
Das
Zitat von Rolf Dieter Brinkmann ist entnommen dem Buch: Rom.Blicke,
Hamburg 1991 |
Bücher von W. G. Sebald:
|
|
|
|
||
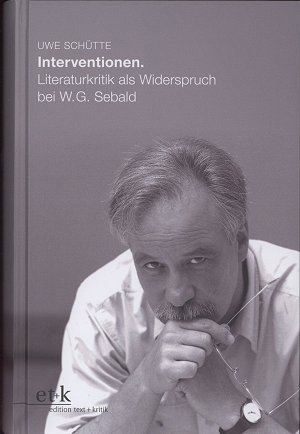


 Unheimliche
Heimat
Unheimliche
Heimat Schwindel.
Gefühle
Schwindel.
Gefühle Nach
der Natur
Nach
der Natur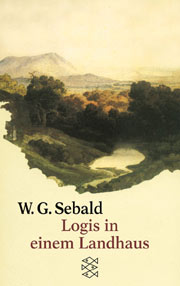 Logis
in einem Landhaus
Logis
in einem Landhaus Die
Ringe des Saturn
Die
Ringe des Saturn Die
Beschreibung des Unglücks
Die
Beschreibung des Unglücks Die
Ausgewanderten
Die
Ausgewanderten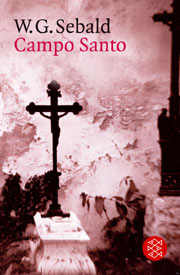 Campo
Santo
Campo
Santo