- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Ă–sterreichische AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Neuerscheinungen
- Alle Rezensionen seit 1997
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- AutorInnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Y
- AutorInnen Z
- Rezensionen Hörbuch
- Interviews / Portraits
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner



FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Elisabeth Buxbaum: Des Kaisers Literaten.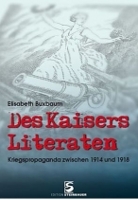 Kriegspropaganda zwischen 1914 und 1918. Des Kaisers Literaten, also all jene, die sich – mit unterschiedlicher Begeisterung – dem Dienst mit der Waffe durch den Dienst mit dem Wort im Kriegsarchiv oder im Kriegspressequartier entzogen, kennt man vor allem im sarkastischen Blick von Karl Kraus. Er attackierte in der Fackel wie in Die letzten Tage der Menschheit unerbittlich seine Journalisten- und Schriftstellerkollegen, die es sich im Hinterland im Kriegsarchiv ,gerichtet' hatten – was Kraus nicht tun musste, er war dienstuntauglich. Viermal musste allerdings auch er zur routinemäßigen Musterung antreten und dabei wusste er es sich einmal sogar terminlich zu richten. Um eine Urlaubsreise in die Schweiz wie geplant antreten zu können, intervenierte er im September 1915 erfolgreich bei seinem Bekannten, dem Präsidenten der Wiener Reichsstatthalterei Alexander Friedrich Lothar Graf Castell-Rüdenhausen. Elisabeth Buxbaum legt nun eine systematische Zusammenschau der Aktivitäten der Literaten in der Literarischen Gruppe des Kriegsarchivs und der Berichterstatter im Kriegspressequartier vor und wertet dafür Briefe und Tagebücher ebenso aus wie die erhaltenen Akten und Unterlagen. Für manche der Autoren gibt es mittlerweile Einzeluntersuchungen, wie Regina Schaunigs Buch zu Robert Musils Propagandaschriften im Ersten Weltkrieg Der Dichter im Dienst des Generals (Kitab 2014). Auch die gar nicht friedliche Haltung Stefan Zweigs, der sich erst im Rückblick zum großen Europäer stilisiert hat, ist seit langem bekannt. Zweigs Wende zum Pazifisten kam erst relativ spät. Noch am 30. März 1917 warnt Franz Werfel den Kollegen in einem Brief, nicht durch freiwillige Mitarbeit an der Zeitschrift des Kriegsarchivs Donauland unnötig weitere Schuld auf sich zu laden (S. 210). Der Überblick vermag aber zusätzliche Kontexte herzustellen, etwa die Funktionsweise der Netzwerke unter den Literaten, die wohl auch fatale Ansteckungsprozesse in Sachen Kriegsverherrlichung ausgelöst haben. Franz Karl Ginzkey und vor allem Rudolf Hans Bartsch, der sich als Berufsoffizier 1914 umgehend reaktivieren ließ und gewissermaßen an beiden Sphären Teil hatte, also das Vertrauen der Autoren wie der Militärs besaß, haben bei den Vorgesetzten für viele der Kollegen in der literarischen Truppe im Kriegsarchiv interveniert, auch für Rilke und Zweig. Selbst waren sie um schroffe Kriegsgesänge nie verlegen, besonders wild reimte Ginzkey vor sich hin. Buxbaum gibt einige dieser Ginzkeyschen Kriegsgesänge in ganzer Länge wieder (S. 102-109) und – ohne dass das im Buch ausgesprochen würde – zeigt das auch die Fatalität im Umgang mit der Kriegsberichterstatterin Alice Schalek. Während Ginzkey nach 1918 über Nacht seinen Nimbus als feinsinniger Poet zurückerhielt, hat Kraus den Rufmord an Alice Schalek fortgesetzt und erfolgreich verhindert, dass sie eine intellektuelle Existenz nach ihrer Zeit als Kriegsberichterstatterin aufbauen hätte können. Zu den uneifrigen der literarischen Gruppe gehörte Alfred Polgar, der nach Kräften versuchte, nicht zu viel sagen bzw. schreiben zu müssen. In seinen Feuilletons wusste er jene Untertöne einzuschleusen, die – ohne ein Fall für die Zensur zu werden – das „Geschehen da draußen“ auch in einem Theaterbericht hörbar machten. (S. 140) Weniger skrupulös war Felix Salten; sein Feuilleton „Es muß sein“ in der Neuen Freien Presse vom 29. Juli 1914, abgedruckt gleich unterhalb des Kriegsmanifests des Kaisers „An meine Völker“, ist im Buch ausführlich zitiert (S. 144f.). Im Dienst des Kriegspressequartiers kommen dann Robert Musil, Alexander Roda Roda und das Prager Bataillon mit Werfel und Kisch in den Blick, aber auch die Reservisten Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal und Anton Wildgans. Spannend an der Zusammenstellung ist, wie in den Briefen der Zeit die differenten Stimmlagen hörbar werden, mit denen Autoren wie Zweig oder Hofmannsthal – je nach dem Adressaten – ihre Kriegsbegeisterung oder ihre Angst vor einem Fronteinsatz, ihren Überdruss oder ihren Heldenmut äußerst unterschiedlich artikulierten. Ein wenig irritiert die sprachliche Ebene des Buches: die Formulierungen geraten mitunter etwas flapsig, die Bilder verrutschen leicht. „Frühzeitig begab er sich in die Arme der Presse und blieb ihr getreuer Anhänger bis an sein Lebensende“ (S. 146), heißt es etwa über Felix Salten. Manchmal wirken auch die eingestreuten Werturteile der Autorin verstörend emotional oder eigentlich persönlich. Ein nüchternerer Ton hätte der Sache vielleicht gut getan. Dem Verlag aber ist zu wünschen, dass die Neigung zu seitenlangen Zitaten keine Urheberrechtsprobleme aufwerfen möge. (red)
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 22 – Paul Divjak
Mit Rebranding flugschrift greift der Autor und KĂĽnstler Paul Divjak das Thema von... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |