- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen





FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Hugo Bettauer: Die freudlose Gasse.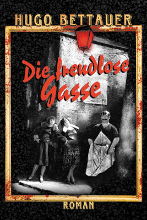 Roman. Link zur Leseprobe Hugo Bettauers Roman „Die freudlose Gasse“ erschien 1923 in Fortsetzungen in der Zeitung „Der Tag“ und 1924 in Buchform. Bekannt ist der Text – beziehungsweise sein eingängiger Titel – heute noch durch die (Stummfilm-)Verfilmung von Georg Wilhelm Pabst aus dem Jahr 1925 mit der noch jungen Greta Garbo. Der Milena-Verlag hat „Die freudlose Gasse“ nun in seiner Reihe „revisited“, mit einem Nachwort des Germanisten Murray G. Hall versehen, neu aufgelegt. Im Jahr 1921 in der Melchiorgasse im siebenten Wiener Gemeindebezirk angesiedelt und von sexueller Ausbeutung, langsamem Niedergang, raschem Aufstieg und Doppelmoral handelnd, ist „Die freudlose Gasse“ sozusagen mit der von Stephen Greenblatt beschriebenen kulturellen Poetik des Ortes und der Zeit geschrieben und verwoben. Ohne weiteres ließen sich Bezüge zur Tradition sozialkritischer Wienerlieder („D‘Hausherrensöhnln“), zu Schnitzlers Soziogrammen (vom „Reigen“ bis zur „Traumnovelle“ oder zu „Fräulein Else“) oder zum real-fiktionalen Figureninventar von Karl Kraus‘ „Fackel“ herstellen. Ödön von Horvaths Klassiker „Geschichten aus dem Wiener Wald“ (1931), der ja in einer ähnlich freudlosen Gasse, der Lange Gasse im achten Bezirk, spielt, steht Bettauers Roman thematisch besonders nahe, insbesondere was die schwierige Situation von jungen Frauen in der Zwischenkriegszeit betrifft. Da Bettauer allerdings keineswegs den platten Effekt wie die überdeutliche Beschreibung scheut, ist „Die freudlose Gasse“ aus literarisch-ästhetischer Sicht nicht mit den genannten kanonisierten Werken der österreichischen Literatur vergleichbar. Wenig subtil werden holzschnittartig Figuren und soziale Verhältnisse gezeichnet. Um den Thrill zu gewährleisten, muss es einen Mord geben, natürlich an einer jungen, schönen, reichen, leichtsinnigen und ehebrechenden Frau, natürlich in der Melchiorgasse. Der Journalist Otto Demel und die Wiener Polizei machen sich daran, das Verbrechen aufzuklären. Die junge, schöne, arme und unschuldige Grete Rumfort gerät indessen in die Fänge einer Kupplerin, weil sie sich selbst und ihre depravierte Familie retten möchte: „Nein, nein, nein, sie wollte nicht länger dumm sein, wollte ihren Anteil am Leben haben, wollte nicht mehr mitansehen, wie die Mutter sich zu Tode grämte, die Geschwister vor Hunger weinten und kaum noch trockenes Brot hatten.“ (S. 45) Als Demel als Untermieter in die ehemals herrschaftliche Wohnung der Rumforts in der Melchiorgasse zieht, verliebt sich Grete in ihn (und er sich in sie). Aus Angst und Stolz bittet sie ihn aber nicht um Hilfe. Die Melchiorgasse wird von Bettauer als paradigmatisches Soziotop im Wien der Zwischenkriegszeit erzählt. Für die reichen Männer der Stadt ist sie jedoch nur ein Transitraum, den sie für amoröse Abenteuer betreten. Und die neuen Diskurse der 20er Jahre, die in Wien nicht unbedingt als „roaring twenties“, sondern eher typisch österreichisch als „schnurrende Zwanziger“ zu bezeichnen sind, finden überhaupt anderswo statt, werden über die Gruppe der jungen Billionärstochter Regina Rosenow dargestellt. Freizügigkeit sowie die Befreiung von Konventionen und Geschlechterstereotypen sind für diese versnobten Twens identitätsstiftend. Es ist anzunehmen, dass Bettauer mit der Beschreibung dieser Gruppe ein wenig provozieren wollte, auch wenn das heute alles recht harmlos wirken mag. Zu dieser Gruppe gehört nun auch ein gewisser Egon Stirner, der auf der „Who’s dunnit“-Ebene des Romans im Mittelpunkt steht. Stirner ist auf der Suche nach der totalen Leidenschaft: „Wo aber ist das Weib, das echte, triebhafte, geistvolle, launische und doch hingebungsvolle Weib, das jedes Beisammensein zum hohen Fest, jede Umarmung zum glühenden Erlebnis macht?“ (S. 63) Da er auch in Geschäftsdingen rücksichtslos erfolgreich agiert, ist er nicht nur für Regina Rosenow „ein Mann, ein ganzer Mann“. (S. 64) Selbstverständlich bekommt Stirner, die Eigenschaften einer Person müssen bei dieser Art Roman ja mit dem Aussehen korrelieren, bei Bettauer „kalte[…] und doch schillernde[…] Raubtieraugen“ (S. 66). Im Verlagstext zum Autor wird erwähnt, dass Bettauer mit Karl Kraus in die Schule gegangen ist. Kraus war nun kein Romancier und beklagte sich auch mitunter, dass er immer nur die Primärtexte anderer kommentieren könne: „Bald ist’s wieder so, daß ich den letzten Schmierer, eben jenen, der selbst verfaßt hat was ich nur zitierte, beneide“. (Fackel 508–513, April 1919, S. 3) Doch Kraus‘ sekundäres Schreiben besitzt eine unglaubliche Originalität (was sich ja auch in den „Letzten Tagen der Menschheit“ zeigt), gerade im Hinblick auf seine Sprachkritik, aus der er seine Zeitkritik entwickelt. Bettauer verwendet leider genau jene plumpe Zeitungssprache, die Karl Kraus so verachtet hat. Dennoch fällt das Urteil von Kraus über seinen Schulkameraden, der angeblich bessere Aufsätze als er selbst geschrieben hat, in Anbetracht der Ermordung Bettauers durch einen NS-nahen Zahntechniker milde aus: „Von Bettauer weiß ich nur, daß er immerhin ein besserer Schriftsteller war als jene, die seine Wunden mit Steinen beworfen haben.“ (Fackel 686–690, Mai 1925, S. 7) Murray G. Hall schreibt in seinem Nachwort: „Sein literarisches Werk wird wohl niemand für genial halten. Daß Hugo Bettauer aber ein guter Journalist war, der für die Nachwelt die Atmosphäre im Wien der zwanziger Jahre erfaßt hat, kann man ihm nicht absprechen.“ (S. 199) Diesem Urteil kann uneingeschränkt zugestimmt werden. Gerald Lind
Originalbeitrag Für die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder. |
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RÃœHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |