- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

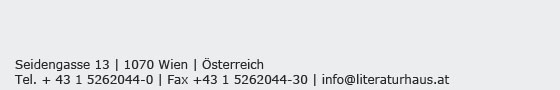
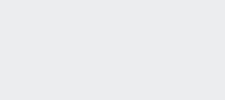


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Leseprobe: Fred Wander - "Der siebente Brunnen."Wie man eine Geschichte erzählt. Drei Wochen nach dem Gespräch, von dem ich nun berichten werde, sollte Mendel sterben. Natürlich konnte ich das damals nicht wissen, noch weniger er selbst, obwohl er zu jener Zeit schon sehr geschwächt war. Aber noch immer hatte er seine äußerste Konzentration auf das Betrachten menschlichen Verhaltens gelenkt, überschüttete er uns, auf dem Holzplatz, beim Abladen von Baumstämmen oder auf dem Marsch, mit glühenden Schmähungen, Flüchen, Verherrlichungen der Schönheit, mit seinen zu Versen geschmiedeten düsteren Prophezeihungen, Wortergüssen, mit seinem Stolz. - Einmal, als ihn einer unserer Wächter mit einem Kübel Wasser übergoß, weil er stehend eingenickt war, beim Schichten von Holz, vor Müdigkeit und Schwäche, und die Gestiefelten schallend lachten (es fror an diesem Tag, die Posten waren in Schafpelze gekleidet, hatten von Sattheit und Wärme rote Wangen), da streckte sich Mendel, sein nasses graues Haar klebte in der Stirn, die Augen lugten scharf darunter hervor, nicht hassend oder klagend, sondern gespannt. Was tut dieser Mensch, fragten die Augen. © 2005, Wallstein Verlag, Göttingen.
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |