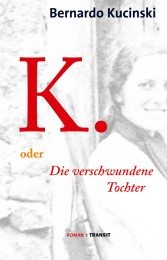 „Alles ist erfunden, doch fast alles ist geschehen“
„Alles ist erfunden, doch fast alles ist geschehen“
– Von Christiane Quandt.
Brasilien scheint auf den ersten Blick kein Land, wo Vergangenheitsbewältigung großgeschrieben würde. Eher die Gegenwart, Tanz, Körperkult und Karneval scheinen in diesem Land wichtig. Denkmäler, Orte der Erinnerung an die Opfer der verschiedensten Phasen von Gewalt verfallen tatsächlich eher, als dass sie so gewürdigt würden wie die Erinnerungsorte und Mahnmale des 2. Weltkrieges in Europa, vor allem in Deutschland.
Auch in Lateinamerika ist Brasilien (noch) eines der Länder, die erst langsam eine aktive Erinnerungskultur bezüglich ihrer blutigen Militärdiktatur (1964‒1985) betreiben; einige hispanoamerikanischen Länder wie Chile oder vor allem Argentinien sind Brasilien in der wissenschaftlichen, literarisch-kulturellen und politisch-gesellschaftlichen Aufarbeitung der Geschichten von Verschwundenen um einige Schritte voraus. Doch auch hier beginnt nach und nach die gesellschaftliche und vor allem wissenschaftliche Diskussion über die letzte überaus gewalttätige Diktatur.
Schreiben gegen die Schuld und das Vergessen
Es kommt somit wohl nicht von ungefähr, dass dieser Roman, der gegen das Vergessen und gegen die Schuld der Überlebenden anschreibt, von einem als Wissenschaftler und Journalist renommierten Autoren verfasst wurde und nicht von einem ‚reinen‘ Literaten. Bernardo Kucinski lehrt und forscht an der Universität von São Paulo und war lange Jahre als Berater des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva tätig. Er erzählt in diesem Buch die Geschichte der eigenen Familie, die über Generationen eine Geschichte der Verfolgten ist, denn als polnischer Jude musste sein Vater Majer Kucinski in den 1930er Jahren fliehen, was die Familie letztlich nach Brasilien führte.
Bernardo Kucinskis Vater hat als fiktionalisierte Figur K. in dem Roman „K. oder die verschwundene Tochter“ eine wichtige Erzählerstimme inne. Fragmentarisch und auf verschiedenen zeitlichen Ebenen begleitet der Leser seine immer verzweifeltere und letztlich vergebliche Suche nach der verschwundenen Tochter. „Mayn tayer tekhterl“ nennt der dem Jiddischen verschriebene Vater und Autor, durch seine Liebe verblendet, zunächst die unbeholfene Heranwachsende mit der dicken Brille. Doch ist es auch „mayn tayer tekhterl“, dessen Verschwinden ihn im Wortsinne umtreibt, bis er nach zermürbenden Jahren der Suche zusammenbricht, als er endlich von Stimmen aus dem Gefängnis die Antwort auf die bohrende Frage erhält: Wo ist sie? Was ist mit ihr geschehen?
 Viele Stimmen und das hässliche Gesicht des Alltags
Viele Stimmen und das hässliche Gesicht des Alltags
Beeindruckend überzeugend lässt der Autor nicht nur den suchenden und fragenden Vater sprechen, er flicht auch die Stimmen eines führenden Militärpolizisten und Folterers, dessen Handlangers, eines ehemaligen Generals, der den Putsch nicht mitgemacht hat, der Geliebten des Polizeichefs, einer traumatisierten Hausangestellten und Putzhilfe des Folterzentrums und anderer mehr oder minder Beteiligter ein. So ergibt sich ein erschreckendes Mosaik des Apparats von Folter und Verschwiegenheit, Druck und Gewalt, Angst und Verrat, der bis zur Fertigstellung des Romans seine Tentakel ausstreckt und mit falschen Informationen über das Auftauchen der Tochter (lebend!) Verwirrung und Elend stiftet.
Durch verschiedene Erzählinstanzen, innerhalb und außerhalb der erzählten Welt, die Einblicke geben in die Innenwelt der Figuren blickt der Leser allzu ungeschönt in die Abgründe der menschlichen Psyche und die Banalität des Bösen. Der Alltag, der immer trotzdem weitergehen muss, und die Mechanismen des Nicht-Hinsehens, die den Einzelnen retten, sind im Falle der Geliebten des Polizeichefs ganz besonders beeindruckend getroffen. Sie ist und bleibt menschlich ‒ auch sie wurde getrieben durch die Liebe zu ihrem Bruder, den sie nur durch das Verhältnis mit dem Polizeichef retten konnte.
Geister der Vergangenheit und der Gegenwart
Beklemmend sind die vielen Textstellen, an denen allzu plakative Parallelen zu den Erlebnissen des in Polen verfolgten jüdischen K. offenbar werden, dessen Schwester ein ähnliches Schicksal erlitt wie in der literarischen Gegenwart die Tochter. Das Leiden des Bruders und Vaters nimmt kafkaeske Züge an, als er, als Bruder und als Vater, von je anderen, und doch ewig gleichen Generälen und Informanten erst gelockt, dann verhöhnt wird – heute sagen sie, sie sei festgenommen worden, morgen wird es geleugnet, übermorgen taucht ein angeblicher Brief von ihr aus dem Ausland auf. Niemand sagt die Wahrheit, alle haben Angst. Jeder Hoffnungsschimmer muss aber verfolgt werden, K. (auch hier denken wir an Kafka) wird betrogen, verliert Geld doch: Die Hoffnung ist nicht tot zu kriegen.
Plastisch und greifbar ist das Lavieren zwischen Hoffnung und Verzweiflung des Suchenden. Die existenzielle Müdigkeit, die notwendig auf das Hin und Her zwischen Hoffnung und Enttäuschung folgt. Nichts geht mehr und doch muss es weitergehen. Die Gerichtsverhandlung über die unrechtmäßige Aufhebung des Arbeitsverhältnisses der Tochter mit der Universität nach deren Verschwinden muss mit dem Aufschrei des Vaters enden: „Und was ist mit meiner Tochter? Wo ist meine Tochter?“
Das Verstummen vor dem Unsagbaren
Nur durch die Vielfalt der Stimmen ist es möglich, das Bild des Schreckens anzudeuten, das diese Geschichte bietet. Die ehemalige Haushaltshilfe in einem geheimen Gefängnis der Militärpolizei offenbart in einer qualvollen, aber kathartischen Sitzung mit einer Therapeutin die Bilder des Schreckens. Sie ist psychisch und physisch völlig zerstört durch das, was sie „da unten“ sah und kann dadurch nicht mehr arbeiten. Aber: „Was war da unten?“ Schier unaussprechlich sind die traumatischen Erinnerungsfragmente von blutigen Segeltüchern, einer Tonne voll Gliedmaßen, den Fleischerhaken an der Decke und dem Gartenschlauch, der alle Spuren verwischt. Dort unten bringt man sie hin, wenn sie gestanden haben. Und bis sie gestehen, hält Dr. Leonardo die Gefangenen am Leben.
An diesen Schrecken scheitert für den fiktionalen K. die jiddische Sprache. Nicht nur der Vater, sondern auch der Schriftsteller kommt an die Grenzen, die Grenzen des Sagbaren. Doch der tatsächliche Autor scheitert nicht. Für ihn ist der Abstand groß genug, der Kontakt zur Schwester locker genug und der räumliche Abstand weit genug, um sich diesem Thema literarisch zu stellen. Für den Wissenschaftler Bernardo Kucinski bietet hier die Literatur durch die verschiedenen Perspektiven und Erzählinstanzen, durch die Balance zwischen Historiographie und Fiktion, zwischen Emotionalität und kaltblütiger Wahrhaftigkeit einen Weg dem Unsagbaren zu trotzen und es doch spürbar zu machen.
Die Komplexität der Form bildet die Komplexität der Erinnerung ab, was dem Vater nicht gelang, gelingt dem Sohn. Das Unsagbare nicht ungesagt zu lassen, kann nur fern von Wissenschaft gelingen, in Texten, die Leerstellen füllen und andere neu erschaffen, die fabulieren dürfen über das, was wirklich geschah und wie es geschah, die bei Schmerz, Trauer und Verzweiflung eines Suchenden verweilen und auch die Seite der ‚anderen‘ und die harten Fakten der Forschung einfließen lassen und alles zu einem komplexen und tief erschütternden Text formen, der auch in der Übersetzung von Sarita Brandt die große Leerstelle körperlich spürbar macht, die die ‚Verschwundenen‘ in der brasilianischen Gesellschaft hinterlassen haben und beim deutschen Publikum die düstere Erinnerung an das Dritte Reich wachrufen.
Tief ergriffen und verstört, doch auch dankbar für die Courage des Autoren und der Übersetzerin verlässt man diesen Text und hofft, eine solche Zeit der Unterdrückung und Verfolgung niemals selbst erleben zu müssen.
Christiane Quandt
Bernardo Kucinski: K. oder die verschwundene Tochter. Roman. Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Sarita Brandt. 144 Seiten. Berlin: Transit-Verlag 2013. 16,80 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Porträtfoto: © Privat, Quelle: Transit Verlag.











