Ein Interview mit dem Buchautor Volker Kitz
 Volker Kitz hat Jura und Psychologie in Köln und New York studiert und anschließend Erfahrungen unter anderem als Lobbyist, Wissenschaftler, TV-Journalist, Drehbuchautor und Musiker gesammelt. Er arbeitet heute als Anwalt, forscht am Max-Planck-Institut in München und ist Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität. Zusammen mit dem Kölner Psychologen Manuel Tusch hat er gerade im Campus-Verlag ein Buch veröffentlicht: Das Frustjobkillerbuch – Warum es egal ist, für wen Sie arbeiten.
Volker Kitz hat Jura und Psychologie in Köln und New York studiert und anschließend Erfahrungen unter anderem als Lobbyist, Wissenschaftler, TV-Journalist, Drehbuchautor und Musiker gesammelt. Er arbeitet heute als Anwalt, forscht am Max-Planck-Institut in München und ist Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität. Zusammen mit dem Kölner Psychologen Manuel Tusch hat er gerade im Campus-Verlag ein Buch veröffentlicht: Das Frustjobkillerbuch – Warum es egal ist, für wen Sie arbeiten.
Herr Kitz, in Ihrem Buch zitieren Sie eine Reihe von Studien, die im Schnitt zeigen: 80 Prozent der Menschen sind frustriert und mit ihrem Job völlig unzufrieden. Woran liegt das?
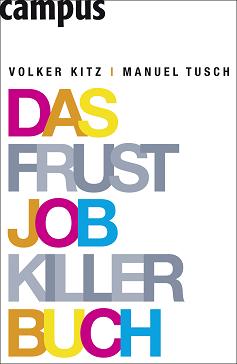 Allein in Deutschland sind das rund 35 Millionen Menschen. Das ist natürlich schon ein Knaller. Wir haben zwei Jahre lang recherchiert und mit vielen Betroffenen gesprochen – aus verschiedenen Altersgruppen, Tätigkeitsgebieten, Hierarchieebenen. Das Ergebnis: Die Erwartungen an unsere Arbeit sind einfach zu hoch. Der Job soll Spiel, Spaß und Spannung bieten, Lebenssinn, Selbstverwirklichung, Anerkennung, nur nette Leute um uns herum, und natürlich viel Geld. Nach diesem Job suchen wir ein Leben lang – aber kein Job der Welt kann uns all das jemals geben. Deshalb tun wir uns selbst einen großen Gefallen, wenn wir umdenken, die rastlose Suche beenden und unsere Energie sinnvoller nutzen. Wie das geht, erklären wir in unserem Buch.
Allein in Deutschland sind das rund 35 Millionen Menschen. Das ist natürlich schon ein Knaller. Wir haben zwei Jahre lang recherchiert und mit vielen Betroffenen gesprochen – aus verschiedenen Altersgruppen, Tätigkeitsgebieten, Hierarchieebenen. Das Ergebnis: Die Erwartungen an unsere Arbeit sind einfach zu hoch. Der Job soll Spiel, Spaß und Spannung bieten, Lebenssinn, Selbstverwirklichung, Anerkennung, nur nette Leute um uns herum, und natürlich viel Geld. Nach diesem Job suchen wir ein Leben lang – aber kein Job der Welt kann uns all das jemals geben. Deshalb tun wir uns selbst einen großen Gefallen, wenn wir umdenken, die rastlose Suche beenden und unsere Energie sinnvoller nutzen. Wie das geht, erklären wir in unserem Buch.
Sie sagen zugleich: Jobwechsel haben keinen Sinn, kein Job ist besser als der jetzige. Sicher eine gute These, um ein Buch zu verkaufen. Aber meinen Sie das ernst?
Absolut, denn wir haben bei unseren Befragungen etwas Verblüffendes festgestellt: Es gibt ein sehr überschaubares Set an Problemen, das die Leute immer wieder und wieder nennen. Diese Probleme lauten im Wesentlichen: „Ich verdiene zu wenig Geld“, „Der Chef weiß meine Arbeit nicht zu schätzen“, „Alle quatschen mir rein“, „Jeder Tag ist gleich“, „Alle Kollegen und Kunden sind geisteskrank“. Diese Probleme tauchen in ähnlicher Form überall auf. Die Hoffnung sprießt also gerade aus den traurigen Umfragezahlen: Wenn zig Millionen Menschen allein in unserem Land derart unzufrieden mit ihrer Arbeit sind und alle über die gleichen Dinge klagen – dürfen wir dann ernsthaft glauben, das liegt nur daran, dass wir alle den falschen Job, die falsche Chefin und die falschen Kollegen haben? Müssen wir wirklich alle nur einmal Bäumchen wechsle dich spielen, einen Platz nach rechts rücken, ein bisschen die Jobs, die Chefs, die Büros und die Kolleginnen tauschen – und dann wird alles gut?
Jobs sind heute längst keine Berufe für ein Leben mehr. Oft haben Menschen vier, fünf oder noch mehr Lebensabschnittsjobs hinter sich – und in keinem einzigen davon waren sie wirklich zufrieden. Sie kommen vom Regen in die Traufe und geben sich doch immer wieder der trügerischen Hoffnung hin: Beim nächsten Chef wird alles anders! Der nächste Chef kommt und geht, und natürlich werden manche Dinge anders. Aber besser werden sie meist nicht. Die Suche nach einer Arbeitswelt, in der es diese Klagen nicht gibt, kann daher immer nur enttäuscht werden. Selbst Leute in Vorstandsetagen beklagen, sie könnten ja nichts entscheiden und seien unterbezahlt. Uns ist es erstmal wichtig, die Einsicht zu vermitteln, dass ein Job immer bestimmte Macken hat. Insofern ähnelt der Beruf einer Liebesbeziehung: Den perfekten Partner gibt es nicht, und ebenso wenig gibt es den perfekten Job. Diese Einsicht setzt viel Energie frei, die wir dann in wirksamere Methoden investieren können, glücklich zu werden.
Natürlich gibt es Grenzfälle: Wenn ich nicht nur unzufrieden bin, weil ich gern mehr Geld auf dem Konto hätte – was jeder will –, sondern wenn ich mich tatsächlich objektiv weit unter dem Marktwert verkaufe, dann ist es Zeit zu wechseln. Wenn es nicht nur die ständigen normalen Reibereien mit Chef, Kollegen und Kunden gibt – die jeder hat –, sondern handfestes Mobbing, dann ist es Zeit zu wechseln. Die Kunst besteht darin, zu unterscheiden zwischen einem echten Einzelfallproblem und den Problemen, die untrennbar mit der Arbeitswelt verbunden sind. Wir neigen dazu, unseren eigenen Fall viel zu schnell als Einzelfall zu sehen. In Wahrheit stoßen Sie nur an Probleme, die jeder andere auch hat.
Kommen wir auf die Motive zu sprechen, warum Menschen einen Beruf ausüben: Geld, Macht, Anerkennung, Freiheit, die Welt verbessern – alles sinnlos?
Das sind alles gute Gründe für die Jobwahl. Aber jeder Grund hat seine Probleme und sein Enttäuschungspotenzial. Nehmen wir zum Beispiel das Motiv „Welt verbessern“: Auffällig ist, dass gerade bei Leuten, die im gemeinnützigen Bereich arbeiten, die Unzufriedenheit besonders groß ist. Denn sie haben in der Regel besonders unrealistische Erwartungen an ihre Arbeit und ihren Einfluss auf das Weltgeschehen. Diese Erwartungen werden meistens enttäuscht. Unter Ärzten und Lehrern etwa – die ja einen unbestritten sinnvollen Beruf ausüben – ist die Zahl der Frustrierten sehr hoch. Man ist eben doch nur einer von sechs Milliarden Menschen, egal ob man bei den Vereinten Nationen die Welt verbessern will oder ob man bei einer Unternehmensberatung arbeitet. Diese Einsicht macht vielen Leuten zu schaffen. Wir mögen es nicht, einer von vielen zu sein. Aber das können wir nicht ändern. Wir untersuchen alle gängigen Motive für die Berufswahl und erklären, was sie leisten können – und was eben nicht. Wer das einmal verstanden hat, hat einen Großteil seines Lebens verstanden.
Aber Geld ist nun mal der Nerv der Arbeit. Darin drückt sich Wertschätzung ebenso aus wie es Erfolg zumindest etwas messbar macht. Dass Geld allein nicht glücklich macht, haben wir inzwischen verinnerlicht. Trotzdem ist es ein starker Ansporn. Was ist daran verkehrt?
Geld ist wichtiger, als viele zugeben wollen, machen wir uns nichts vor. Aber wenn eines durch Studien belegt ist, dann das: Wir können nie genug verdienen. Der Klassiker unter diesen Studien ist das Zwei-Welten-Experiment: Man stellt Probanden vor die Wahl zwischen zwei finanziellen Welten. In der einen Welt verdienen sie 60.000 Euro, während das Durchschnittseinkommen bei 30.000 Euro liegt. In der anderen Welt verdienen sie das Zehnfache: 600.000 Euro. Allerdings liegt in dieser Welt das Durchschnittseinkommen bei einer Million. Was glauben Sie: Für welche Welt entscheiden sich die befragten Menschen mehrheitlich? Für den zehnfachen Betrag, der aber unter dem Durchschnitt liegt? Nein. Die meisten Menschen sind bescheiden. Sie würden den niedrigeren Betrag nehmen – ihnen ist es viel wichtiger, dass ihr Einkommen über dem ihrer Mitmenschen liegt, als dass es absolut gesehen besonders hoch ist. Nun wird es aber auf der Welt immer jemanden geben, der mehr verdient als wir. Wer also den Job sucht, in dem er genug verdient, wird sein Leben mit einer endlosen, aufreibenden Suche vergeuden.
Eine Ihrer Thesen ist: Wer ein dominantes Motiv hat, den wird kein Job der Welt befriedigen. Was meinen Sie damit?
Wir neigen dazu, den Job aufgrund eines dominanten Motivs zu wählen: Geld oder Status oder Sinn oder Spaß. Die Erwartungen an diesen ausschlaggebenden Aspekt steigern wir dann derart, dass die Realität sie nicht erfüllen kann. Das ist so, wie wenn wir mit Weihnachten in erster Linie eine knusprige Gans verbinden und nur daran denken. Wenn die Gans dann am Ende nicht so knusprig ist, wie wir es uns seit Wochen ausgemalt haben, ist das ganze Fest im Eimer. Dabei hätte es so viele andere Dinge gegeben, über die wir uns hätten freuen können: nette Menschen um uns herum, einen schönen Weihnachtsbaum, festliche Musik. Wenn wir auch beim Job von allem ein bisschen, aber von keinem zuviel erwarten, dann werden wir viel seltener enttäuscht. Wir nennen das einen Erwartungsmix.
Nun kann man sich seine Kollegen schlecht aussuchen. Die einen nerven, andere mobben. Sie sagen: Beim nächsten Chef wird auch nichts anders. Aber sind das nicht starke Motive für einen Jobwechsel?
Ständige Störungen empfinden die Beschäftigten als größte Belastung im Berufsleben. Diese Störungen sind andere Menschen – mit denen wir einmal so gern zu tun haben wollten. So ziemlich jeder will einen Job, in dem er mit Menschen zu tun hat. Wer wollte auch sein Berufsleben allein vor einer weißen Wand verbringen? Oder nur mit Computern? Wo aber Menschen sind, wird es immer Spannungen und Reibungen geben. Es ist wichtig, dass wir unseren Ärger darüber nicht auf unsere konkreten Kunden und Kolleginnen projizieren, sondern als unvermeidbaren Preis dafür ansehen, dass wir nicht allein sind. Auch im nächsten Job werden manche nerven, denn Sie sagen es bereits in der Frage: Man kann sich seine Kollegen schlecht aussuchen. Es gibt keinen Job, in dem wir nur Menschen vorfinden, die wir mögen. Danach zu suchen, ist Zeitverschwendung.
Jetzt mal konkret: Machen Sie den Job, den Sie haben, zu dem Job, den Sie wollen, lautet eine Ihrer Empfehlungen. Wie soll das praktisch gehen?
Wir stellen unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Probleme vor: Wer Streit mit dem Chef oder den Kollegen hat, sollte zum Beispiel eine gewisse Distanz zu den Dingen entwickeln – hierfür gibt es psychologische Tricks. Wer Lob und Anerkennung für seine Arbeit vermisst, dem zeigen wir Übungen auf, mit denen er seinen Selbstrespekt stärken kann. Man kann mit bestimmten Methoden auch seine materielle Zufriedenheit steigern, ohne dass ständig mehr Geld auf der Gehaltsabrechnung steht. Besonders begeisterte Rückmeldungen haben wir bisher für unsere Anleitung zur Kommunikation mit den nervigen Mitmenschen bekommen. Wir verfolgen hier die Methode der gewaltfreien Kommunikation, die schon sehr vielen Menschen geholfen hat, besser mit den Kolleginnen und dem Chef klarzukommen. Bewährt hat sich vor allem die so genannte Ich-Botschaft. Bei ihr steht nicht der Du-Vorwurf im Vordergrund, sondern eine sachliche Beschreibung aus der eigenen Perspektive. Der andere fühlt sich dann nicht so schnell angegriffen und ist leichter bereit, Zugeständnisse zu machen. Das funktioniert erstaunlich gut.
Angeblich spielt Psychohygiene dabei eine wichtige Rolle…
…Psychohygiene bedeutet, Gefühle kontrolliert zuzulassen. Wir wenden dafür hoch wirksame Vorgehen aus der Traumatherapie an. Bei einem Bad-Job-Day zum Beispiel kommen in uns Gefühle wie Ärger, Traurigkeit oder Hass hoch. Der erste Schritt besteht darin, dass wir diese Gefühle ernst nehmen und als Bestandteil unserer Persönlichkeit würdigen. Das klingt zunächst einmal ein bisschen komisch, denn wir haben in der Regel gelernt, dass man solche Gefühle einfach nicht haben darf: Wer wütend ist, ist böse oder gar ein schlechter Mensch. Wir verwechseln im Alltag das Akzeptieren mit dem Ausleben unserer Gefühle. Dass ich wütend werde, wenn meine Kollegin mal wieder zu spät dran ist, das ist ganz normal und ein gesunder Mechanismus. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich sie gegen die Wand klatschen muss. Wir leiten die Leser an, mit ihren Gefühlen umzugehen, ohne dass sie ihre Umwelt durch schlechte Laune verprellen. Und das bedeutet nicht einmal, dass man einfach die Klappe halten und alles in sich hineinfressen soll. Im Gegenteil: Wir können mit gewaltfreier Kommunikation durchaus unsere Meinung sagen – ohne dass wir jemandem schaden, nicht einmal uns selbst.
Führen Ihre Empfehlungen nicht zwangsläufig zu Entwicklungs-Stillstand, wenn wir uns mit allem nur noch arrangieren?
Ganz im Gegenteil. Wir ermutigen die Menschen zu neuen Einsichten – und dazu, sich selbst zu verändern. Und gehört es nicht zu den schönsten und größten Fortschritten im Leben, neue Einsichten zu bekommen und sich selbst weiter zu entwickeln?
Als Selbstständige haben Sie gut reden. Welche Ihrer Empfehlungen fallen Ihnen denn selbst besonders schwer?
Wir haben beide schon selbstständig und angestellt gearbeitet. Deshalb wissen wir: Auch im Leben der Selbstständigen tauchen all die Quälgeister aus der Angestelltenwelt wieder auf, manchmal nur in leicht abgewandelter Form. Ein Selbstständiger hat zum Beispiel nicht damit zu kämpfen, dass sein Chef ihm Anerkennung verweigert. Er hat gar keinen Chef, der ihm diese Anerkennung geben könnte. Weil er aber auch nur ein Mensch ist und Anerkennung genauso braucht wie alle anderen, muss er sie sich auf andere, oft viel mühsamere Art und Weise besorgen. Und die Rolle des früheren Chefs als Freiheitsbegrenzer können ganz leicht die Kunden übernehmen: Sie geben Anweisungen, sie kritisieren, sie können auch ganz schön schikanieren. In der Tat fällt es uns manchmal selbst schwer, nicht von dem perfekten Job zu träumen, in dem es all diese Probleme nicht gibt. Aber dann kneifen wir uns selbst in den Arm und sagen uns: Willkommen in der Wirklichkeit!
Vielen Dank für das Gespräch.








blogfeuer
Und 80% beklagen sich über das Arbeitsklima innerhalb der Abteilung oder im Unternehmen. Und das ist schon etwas, was nicht in jeder Firma gleich ist!
Das Gras ist zwar überall gleich Grün, aber manche Kühe machen mehr muh als andere..
Miriam Semrau
Sehr interessantes Interview. Spricht mir aus der Seele. Die Suche nach dem Perfekten muss in jedem Lebensbereich zur Frustration fuehren. Ganz einfach, weil es auch keine dauerhaft gueltige Definition des Perfekten gibt.
Mir faellt hierzu immer wieder ein “Love it, Change it, or Leave it”. Viele vergessen, dass zu “change it” auch die eigene Einstellung zaehlt. Ich arbeite auch gerade wieder intensiv daran. Das hoert wohl nie auf.
Jan Schmidt
Klasse Interview. Allerdings glaube ich, dass das in der Theorie viel leichter ist als in der Praxis. Hinzu kommt, dass man sich vielleicht mit seinem Gehalt psychologisch arrangieren kann, aber wenn alles teurer wird, so wie aktuell, nutzt einem das gar nichts. Und die größten Gehaltssprünge sind nun mal mit einem Jobwechsel zu erreichen.
Tinkerbell
Spannendes Interview. Ich denke ein Jobwechsel muss gut überlegt sein, aber hin und wieder ist er eben bitter nötig. Das Buch werde ich in der Buchhandlung sicher mal anschauen :-)
Volker Kitz
@blogfeuer: Richtig, das Klima ist für viele das Problem. Aber: Wenn es in 80% der Unternehmen nicht stimmt – wie groß ist dann schon rein rechnerisch die Chance, dass die äußeren Umstände sich im nächsten Job bessern? Wir setzen daher darauf, sich von solchen äußeren Umständen unabhängig zu machen. Das kann man lernen.
@Miriam Semrau: Genau so ist es.
@Jan Schmidt: Natürlich ist die Theorie fast immer leichter als die Praxis. Aber manchmal lohnt sich ein Versuch, weil man mit ihm viel gewinnen kann.
@Tinkerbell: In gut überlegten Ausnahmefällen hilft tatächlich nur ein Jobwechsel. Diese Fälle behandeln wir im Kapitel “Wann Wechsel wirklich Wunder wirken”.
Schneid
Habe “Das Frustjobkillerbuch” inzwischen gelesen, nachdem ich durch das Interview darauf aufmerksam wurde. Ich muss sagen – Kompliment an die Autoren. Es hat mir wirklich interessante Einsichten geboten, die sonst oft nicht so ausgesprochen werden…
Jochen Mai
Mir hat es auch gut gefallen. Zumal die Kernaussage stimmt.
meistermochi
“Wenn wir auch beim Job von allem ein bisschen, aber von keinem zuviel erwarten, dann werden wir viel seltener enttäuscht.”
genau mein ansatz! weil konfuzius sagt:
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So bleibt dir mancher Ärger erspart.
Eva
Genau….und das (Von allem ein bisschen, von keinem zu viel, so wird man seltener enttäuscht….) dann auf alle Lebensbereiche (Job, Beziehung, Freizeit,…) anwenden …… Gäääähhhhhhhnnnnnn
Was für eine Binsenweisheit.
Oh Mannnnn…
Wenn ich mir die Kugel gebe, kann ich auch nicht mehr enttäuscht werden.
Keiner erwartet dass alles besser wird, aber es wird anders.
Pingback: OjE-Blog » Archive » “Warum es egal ist, für wen Sie arbeiten”
Jens
Natürlich gibt es immer bessere Jobs, aber leider sind gerade die deutschen Arbeitnehmer total statisch und das hilft dämlichen Vorgesetzten Ihr Nichtskönnen zu vertuschen und ihre “Launen” auszuleben. Daher ist es vor allem wichtig, sich ständig nach einem anderen Job um zusehen und sich weiter zubilden, denn dann können einem Drohungen nichts mehr anhaben, da man einfach den Job wechseln. Wichtig ist das man zu sich selber ehrlich ist und sich nicht blenden läßt. Es reicht zuviel Geld zu verdienen, das man gut über die Runden kommt bei einem Job der einen NICHTS stresst und bei dem man möglichst wenig Wochenstunden arbeiten muß, damit man Zeit für sich und Familie hat. Das macht glücklich… und nicht das Gelaber aus dem Buch.
Pingback: „Menschenskind – Was die Weihnachtsgans mit dem Job zu tun hat“ auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!
Olaf
Sehr reißerischer Titel der aber dann durch wirklich fundierte Aussagen unterstützt wird.
Interessant finde ich eigentlich schon den Begriff “Job” im Titel und im Interview. Vielleicht bin ich ein Erbsenzähler aber ich finde “Job” ist defintiv etwas anderes als das was vor Jahren in den guten alten Zeiten ;-) – ein “Beruf” war. “Job” klingt für mich halt doch immer nach :Hauptsache irgendwas wo ich schnell und möglichst optimal Geld verdienen kann und wenns nicht optimal läuft wird eben gewechselt.
Da im Interview der Vergleich mit einer Liebesbeziehung gemacht wird , fällt mir eben ain dass auch ähnliche psychologische Mechanismen wirken könnten . Eine “altmodische” Einstellung, die fdavon ausgeht dass, fast egal was passiert, dies eine lebenslange Beziehung bleiben soll beeinflusst das Gesamverhalten und führt zu einem völlig anderen Verhalten als die meiner Mainung nach derzeit moderne Enstellung “wenn was nicht passt kann ja jederzeit gewechselt werden”
Pingback: „Blogschokolade 2008 – Mein persönlicher Jahresrückblick“ auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!
Pingback: „Kollegen versus Job – Was ist schlimmer?“ auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!
Peter Müller
Das Interview geht gar nicht und ist eher als Warnung davor zu verstehen, das zugehörige Buch zu lesen.
Eines steht fest: Es gibt immer mehr „Jobs“, statt Arbeitsplätze, Stellen und Berufe. Das ist aber noch lange kein Grund dafür, dazu aufzurufen, die schleichende Prekarisierung der Arbeitswelt, die zwar vielem dient, aber am wenigsten den Menschen, einfach widerspruchslos hinzunehmen und sich in sein Schicksal zu fügen. Die Lösung soll also darin liegen, sich ein paar Selbstvorwürfe machen „Meine Einstellung ist daran schuld, dass ich nicht zufrieden bin, meine übertriebenen Erwartungen sind es.“, seine Einstellung zu ändern und sich innerlich selbst zu verbiegen? Also mit Vollgas eine fatalistische Grundhaltung einnehmen und in einer ohnmächtigen „Ich kann ja sowieso nichts daran ändern.“-Einstellung einfach verharren? Toll! Auf so ein Buch haben wir alle gewartet. Diese seltsame These „Kein Job ist besser als der jetzige“ ist doch Nonsens und eher ein weiterer Aufruf dazu, sich der Ohnmacht hinzugeben. In meinem Umfeld kenne ich kein einziges Beispiel, bei dem derjenige, der seine Arbeitssituation durch Wechsel geändert hat, danach unzufriedener war als vorher. Ganz im Gegenteil. Jeder Wechsel war mit einem riesigen Sprung an Zufriedenheit und Lebensqualität verbunden. Und wenn ich Aussagen wie diese lese: „Es gibt keinen Job, in dem wir nur Menschen vorfinden, die wir mögen. Danach zu suchen, ist Zeitverschwendung.“, also wenn das auf den Begriff der Arbeit bezogen ist (nicht auf den Begriff des „Jobs“!) das ist schon echt krass und völliger Humbug! Ich finde es erschreckend, wie die ganzen jajajaja-sagenden Medien auf diese Aussagen voll einsteigen, die ich für höchst gefährlich und schädlich für die intrinsische Motivation von Arbeitnehmern halte. Die wertvollste Quelle des persönlichen Glücks ist das Gefühl, selbst sein Leben nach eigenen Vorstellungen steuern und gestalten zu können. Und jetzt soll man sich von Tusch/Kitz einreden lassen, dass das gar nicht geht?
Jochen Mai
@Peter Müller: Sie sollten vielleicht unterscheiden zwischen “Das Interview geht gar nicht” und “den darin gemachten Aussagen widerspreche ich”. Denn das Interview geht genau deshalb natürlich schon: Es schildert eine Meinung und deren Argumentationslinie. Der kann man folgen oder widersprechen. Das Interview deswegen nicht zu führen (= “geht gar nicht”), hieße zugleich seinen Horizont zu beschränken. Und das wäre dümmer als jede Kontroverse.
Peter Müller
@Jochen Mai:
Oh sorry, da habe ich angesichts der aus meiner Sicht ziemlich katastrophalen Standpunkte und Thesen des Autorenduos etwas zu sehr um mich geschlagen und Sie gleich mit erwischt. Es war nicht beabsichtigt, die Tatsache, dass dieses Interview geführt und veröffentlicht wurde, negativ zu kritisieren – das alleine ist selbstverständlich enorm wichtig, damit kontroverse Diskussionen überhaupt erst entstehen können.
Das Buch werde ich mir wohl trotzdem besorgen und durchlesen, um eine entsprechende Rezension schreiben zu können. Das, was die Autoren in ihren Interviews und TV-Auftritten zum Besten geben, klingt schon derbe nach einer Art Aufruf, sich freiwillig und ohnmächtig ins Schicksal zu fügen und sich auf diese Weise entmündigen zu lassen. Und die Tatsache, dass das alles auch nahezu überall völlig unreflektiert und unkommentiert stehen bleibt, macht einem schon Angst.
Pingback: „Neue Deutsche Welle – Jedes vierte Unternehmen will entlassen“ auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!
Pingback: „Job gefunden – Die Reise beginnt“ auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!
Pingback: „Zweckbeziehung – Muss man seinen Job lieben?“ auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!
Pingback: „Dossier Probezeit: So gewinnen Sie im neuen Job“ auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!
Pingback: Rezension “Das Frustjobkillerbuch” | Public Correlations
Pingback: Sucht Euch gute Chefs! « Chef-Blog