06 Januar 2011
Unendlicher Spaß I: Chaos und Kosmos
Ich lese in der Regel affirmativ. Ich lese so lange affirmativ, bis ich nicht mehr kann. Bei manchen Büchern kann ich schon nach der ersten Seite nicht mehr. Bei „Unendlicher Spass“ nähere ich mich der Mitte und kann noch ziemlich gut. Ich kann sogar immer besser. Zweimal habe ich allerdings die Segel streichen müssen. Das erste Mal war der Grund ein inhaltlicher, in das Eschaton-Spiel (Seite 464 ff) bin ich, trotz mehrfachem Strategiewechsel nicht hineingekommen. Beim zweiten Mal war der Grund ein sprachlicher. Der Bericht eines Schweizers bei den Anonymen Alkoholikern (Seite 507). Ich stamme aus Rumänien, bin zweisprachig aufgewachsen und lebe seit 2006 in Berlin. Ich bin – möglicherweise war das ein Fehler – über Österreich eingereist. Ich habe noch nie einen Schweizer reden hören oder, was ein Schweizer eben so redet, in Schriftform gesehen und so habe ich kein einziges Wort verstanden. Also: Kompliment an den so genannten Übersetzer (ich meine das ernst), Chapeau Herr Blumenbach!
Bevor ich mich in kommenden Beiträgen auf den Inhalt einlasse, möchte ich mich erst einmal mit der Form beschäftigen. Mit der Form dieses Dings, dieses Etwas, das schon im Titel die Negation von Form führt, das infinite, in-finis. Dabei gibt es nur eins, was keine Form hat und das zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur keine Form hat, sondern gar nichts: das Nichts. Möglicherweise gibt es noch etwas, das keine Form hat: das Alles. Beides scheint mir unvorstellbar. Weil unsere Sprache die Vorstellung von Nichts und von Alles nicht zulässt. Diese Sprachauffassung lässt sich in Kürze so skizzieren: die Welt ist wie sie ist, weil unsere Sprache so ist wie sie ist. Wäre die Sprache eine andere, wäre auch die Welt eine andere. Unsere Grammatik strukturiert die Welt, nicht die Quarks, die schwarzen Löcher, die Antimaterie oder ähnliche Gespenster. Das ist sehr malerisch und auch hübsch anzuschauen, aber es sind Metaphern. Das sind Sprachbilder, das ist keine exakte Mathematik. Nichts und Alles können wir uns nicht vorstellen, aber was dazwischen liegt, das können wir uns vorstellen.
(Was sagt Clemens Setz dazu? Ist es möglich, dass Mathematik und Sprache eine gemeinsame Ebene herausbilden? Wie könnte das aussehen? Geht das in die Richtung von Wittgenstein und Valery? Muss die Sprache exakter werden oder die Mathematik metaphorischer? Oder gibt es einen dritten Weg, eine Schnittmenge?)
Die Frage lautet: Chaos oder Kosmos? Unordnung oder Ordnung? Ist dieses unförmige Ding mit seinen tausend Tentakeln, seinen in alle Richtungen wuchernden inhaltlichen wie sprachlichen Eskapaden und Exzessen einfach nur chaotisch? Gibt es eine übergreifende Form für all das Disparate in diesem Text? Braucht es die überhaupt? Anders gefragt: ist die Unendlichkeit, der wohl zentrale Begriff dieses Romans, nur durch das Chaotische darstellbar? Dann würde jeder Versuch einer Reduktion dieses Chaotischen seiner Intention zuwiderlaufen; beispielsweise die Reduktion auf ein Muster, auf etwas Wiederkehrendes und deswegen Vorhersehbares: Aus den wirklichen Bewegungen der Vergangenheit wird auf die möglichen der Zukunft, aus dem Bestimmten wird auf das Unbestimmte geschlossen.
Auch DFW erfindet das erzählerische Rad nicht neu. Die Tradition des chaotischen Erzählens, der „Tristram Shandy“ von Sterne, ist von Herrn Niemann angesprochen, und Joyce ist mehrfach genannt worden. Es gibt andere Versuche, „Die blaue Villa in Honkong“ von Alain Robbe-Grillet ist ein Text mit einer zyklischen Struktur; „Rayuela“ von Julio Cortazár ist ein Roman mit zwei Strukturen, einer linearen und einer aleatorischen. Es ließen sich weitere Texte nennen, die mit der Form experimentieren. Wir können dabei auf organische Begriffe zurückgreifen und von Wucherungen sprechen. Wir können mit der Mathematik von selbstähnlichen, sich wiederholenden, fraktalen Figuren sprechen, oder mit Deleuze und Guattari, die das Wort Chaosmos geprägt haben, von Rhizomen. Wahrscheinlich finden sich noch weitere Begriffe, die sich produktiv verwenden lassen und denen eines gemeinsam ist: das Zurücktreten des linearen und chronologischen Nacheinander zugunsten einer collagierten Gleichzeitigkeit.
Ich habe mir das Bild des Mobiles zurechtgelegt. US als Mobile mit drei selbständigen Teilen oder Erzählzentren. Die Tennisakademie E.T.A. um Hal Incandenza, die Drogenentzugsanstalt Ennet House um Don Gately und die Québecer Separatisten um Remy Marathe. Jedes der drei Erzählzentren besteht aus ihren eigenen Figuren – bei der Tennisakademie sind das neben Hal die anderen Jungs, die Familienmitglieder des Incandenza Clans mit den Brüdern Hals Orin und Mario, dem Storch, dessen Vater, der Moms und ihrem Halbbruder C.T. – in die sich die Figuren der anderen Erzählzentren mischen. Die drei Teile des Mobiles bilden keine streng voneinander getrennten Entitäten. Es gibt keinen eigentlichen Erzählfaden, keinen klassischen Plot, vielmehr arrangieren sich die Mobileteile immer wieder neu und anders.
Dieses Mobile hängt im Raum, nicht in der Zeit. Anders als beim linearen Erzählen – das sind natürlich Mischformen, es kann keine absolute Überwindung des temporalen und sukzessiven Erzählens geben, weil es keine Überwindung des sukzessiven Lesens gibt – tritt beim mobilierten Erzählen die Zeit in den Hintergrund. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Figuren und die Art, wie sie präsentiert werden. Hugh Steeply und Remy Marathe stehen seit mehr als siebenhundert Seiten (Stand meiner Lektüre) in der bitterkalten Wüstennacht auf einem Felsvorsprung. Die beiden erinnern an Wladimir und Estragon, nur dass sie spannende philosophische Gespräche führen und bewaffnet sind. Möglicherweise hängt das auch zusammen und es würde so manches philosophische Seminar beleben, wenn die Dozenten, statt mit Büchern und Zitaten mit einer Kalaschnikow bewaffnet wären. Immerhin weiß der Leser, dass die beiden irgendwann in Bewegung geraten. Und wenn sie nur den Finger am Abzug bewegen. Bei anderen Personen ist selbst diese minimale Bewegung nicht sicher. Erdedy beispielsweise, wird erst fünfhundert Namen nachdem er eingeführt worden ist, zum zweiten Mal erwähnt. Und verschwindet dann auch gleich wieder hinter anderen Mobileteilen. Oder die U.S.S. Millicent Kent, die wie ein Kriegsschiff heißt, wohl mit einer ähnlichen Tonnage ausgestattet ist und Mario, beim Versuch ihn zu küssen, den Thorax einquetscht. Welche Funktion hat der skurrile Guru Lyle, der Bewohner des Fitnessraums der E.T.A., der sich einzig durch das Ablecken der verschwitzen Jungenkörper ernährt? Welche Bedeutung hat die Clipperton Episode, der Tennisspieler, der sich bei jedem Match die Pistole an die Schläfe hält und droht abzudrücken, sollte er unterliegen? Welche Rolle hat Wardine, außer der Darstellung ihres Idioms? Haben all die Lebensgeschichten der Anonymen Alkoholiker und Drogensüchtigen, die vielen kleinen Erzählpartikel, die sich in den Vordergrund drehen, ins Interesse des Lesers und ins Licht des Betrachters, und die dann wieder weg sind, haben die eine Funktion?
Ist ihre Funktion vielleicht die, das Chaos darzustellen? Chaos, wo alles gleichzeitig da ist, und wo der Zeit keine ordnende Funktion zukommt. Durch immer neue, einander ähnelnde Wiederholungen, Bewegungen, Drehungen entstehen Momentaufnahmen und Konstellationen. Aber es entsteht kein strenges, nach früher und später geordnetes Kontinuum. Und gerade dadurch, so scheint‘s, hat dieser Roman viel Zeit. Er hat alle Zeit der Welt. Oder gar keine.
Und nun beginnt das Phantasieren. Ich habe erst die Hälfte des Textes gelesen, den Rest muss ich mir vorstellen. Ich versuche mir das so hinzubiegen, wie ich das haben will. Und wenn’s nicht hinhaut, dann ist das, wie Wallace das so schön am Eingang seines Buches formuliert, als er sich an die Leser wendet, „Produkt Ihrer eigenen krankhaften Phantasie“. Außer den drei gleichberechtigten Erzählzentren hat US ein viertes Zentrum. Ich unterstelle, dass es sich dabei um das Zentrum des gesamten Mobiles handelt: Joelle van Dyne. Die Hauptdarstellerin des Films „Unendlicher Spass“, der all jene lähmt, die ihn anschauen. Diese Unterstellung ist natürlich davon motiviert, dass der Film für den Roman titelgebend ist. Es spricht auch etwas gegen diese Annahme: Joelle ist kein Erzählzentrum wie die anderen drei, sie ist eine vereinzelte Figur. Ich rücke sie so stark in die Mitte, weil ich am Thema Schönheit meine greifen zu können, was es mit dem Begriff der Unendlichkeit in US auf sich hat. Um eine Unendlichkeit zu konstruieren – also nicht die sprachlich unfassbare, ganz große, unvorstellbare Unendlichkeit, sondern eine, sagen wir, mittelgroße Unendlichkeit – braucht es eigentlich nur ein Gegensatzpaar: Alles und Nichts, Chaos und Kosmos, Schönheit und Entstellung. Alles was zwischen den jeweiligen Gegensätzen liegt, ist eine Unendlichkeit.
Ist Joelles Schönheit der Grund für ihre permanente Verschleierung? Eine moderne Medusa, die jeden zu Stein erstarren lässt, der sie anschaut. Oder ist der Grund der Verschleierung ihre Entstellung durch einen angeblichen Säureangriff? Immerhin ist sie die Vorsitzende der L.A.R.V.E., „Liga der Absolut Rüde Verunstalteten und Entstellten“. Ist Joelle unmenschlich schön oder ist sie unerträglich hässlich? Ist sie lediglich ein Phantasma (oder, in der Sprache der Amüsierwilligen, ein Funtasma)? Ist nicht jedes Sehen, jedes äußere Bild das auf ein inneres stößt, im Kern bereits phantasmagorisch? Es gibt ja in jeder sinnlichen Wahrnehmung eine Konfrontation zwischen Phantasie und Wirklichkeit. In der Schönheit ist diese Konfrontation jedoch besonders prägnant.
Wer von menschlicher Schönheit spricht, der spricht nicht von einem rein ästhetischen Wohlgefallen, sondern von Liebe und Begehren. Und sei es nur das Begehren, den anderen zu sehen. Erkennen zu wollen, wer einem da gegenüber steht. Auch wenn er in Wirklichkeit nur erkennt, wie er aussieht. Dieses Erkennen findet durch den Blick statt, das gegenseitige einander Anschauen. Das ist ein Geschehen, das sich zwischen zweien ereignet, kein solipsistischer Akt. Schönheit ist nicht das, was einer hat oder besitzt, sondern was ein anderer ihm zuschreibt. Menschen sind nicht schön, sozusagen von Natur aus, sondern sie werden es, indem ein Gegenüber ihnen diese Schönheit zuschreibt. Der Schleier unterbindet diese Zuschreibung. Dem einen ist das Sehen genommen, dem anderen das Gesehen werden. In dieser Situation ist weder der vor noch der hinter dem Schleier ganz er selbst. Der Sehende stellt nicht nur die Ungesehene in Frage, sondern auch sich selbst. Das ist eine partiell doppelte Blindheit, beiden Beteiligten fehlen die Zuschreibungen des anderen.
Der Betrachter, der Leser weiß nicht, was sich hinter dem Schleier verbirgt. In diesem Nichtwissen sind die beiden Gegensätze Schönheit und Entstellung ganz nah beieinander, weil beides möglich ist. Es wird wohl nur das eine der Fall sein, aber in der Möglichkeitsform ist beides gleichzeitig präsent. Oder ist Joelle, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, beides zugleich? Wie Pat Montesian, die Leiterin von Ennet House, deren eine Gesichtsseite nach einem Schlaganfall entstellt, deren andere Seite aber schön ist. Ist Joelle eine Figur, die selbst ein Mobile ist, so dass bisweilen das eine und dann das andere im Vordergrund steht? Ist sie schön, so tritt ihre Entstellung zurück. Und umgekehrt. Ist eine solche Gleichzeitigkeit von einander Ausschließendem denkbar? Ist Joelles Verschleierung eine Maskerade oder ist sie echt? Oder beides zugleich?
Gleichzeitigkeit bedeutet, dass wir etwas nicht in eine temporale Struktur, in eine Verlaufsform bringen können. Da ist etwas, das nicht Vergangenheit wird. Es ist immer Gegenwart und Anwesenheit. Gleichzeitigkeit ist womöglich der lähmende, versteinende, erstarrende Kern dieses Phantasma. Möglicherweise erstarren nicht nur die anderen, die, die sie zu Gesicht bekommen, sondern auch Joelle selbst. Ich habe im Zusammenhang des einander Anschauens und sich gegenseitig Erkennens von einer partiell doppelten Blindheit gesprochen. Der Schleier unterbindet das intersubjektive Geschehen zwischen den beiden, die gegenseitigen Zuschreibungen und Projektionen: der andere wird zu einer leeren Leinwand und man selbst wird es dadurch ebenfalls. Dieses Selbst, das wir nicht sind, sondern durch die Zuschreibungen des anderen werden, lässt sich in so einer Situation nicht greifen. Ein Selbst wird erst dort das eigene Selbst, wo wir es durch einen anderen begreifen.
Ist das Chaotische näher am Anfang und am Ursprung? Am Ursprung der Welt und des Erzählens von diesem Ursprung. Geht Erzählen bereits mit einem Verlust jeden Ursprungs einher? Bedeutet das, dass der Versuch, das Chaotische wiederherzustellen oder sich ihm mimetisch anzunähern, ein Irrweg ist? Oder ist die Beobachtung, die zur Hälfte eine Unterstellung ist, dass der chronologischen Zeit eine untergeordnete Rolle zukommt, falsch? Und wenn sie doch richtig sein sollte, gilt dies nur für mehr oder minder experimentelle Formen wie US sie in dem Unendlichen konstruiert. Oder ist das eine allgemeine Tendenz? Bietet die Gleichzeitigkeit von Ereignissen einem Erzähler andere Möglichkeiten, andere erzählerische Mittel?
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten zwanzig Jahren vollkommen verändert. Die strenge Einteilung von Arbeitszeit und Freizeit ist nahezu obsolet. Durch Telefon und Internet ist jeder jederzeit erreichbar und hat Zugriff auf Rechner, Server, Daten. Aus dem wohlgeordneten und streng voneinander getrennten Nacheinander des Lebens ist eine Gleichzeitigkeit geworden. Wir sind immer bei der Arbeit. Oder nie. Es wäre doch erstaunlich, wenn solche tiefgreifenden Veränderungen keinen Niederschlag in der Literatur fänden. Bieten Mobile, Collage oder Rhizom Erzählmodelle, die die strenge Anordnung der Zeit in ihre Extensionen nicht bietet? Hat das Folgen für die Bedeutung von Erinnerung und Antizipation in fiktionalen Texten? Oder sind das Experimente, die es immer gegeben hat, die aber an dem Fundament der strengen Aufeinanderfolge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht rütteln können? Gibt es eine Tendenz zum chaotischen Erzählen, eine narrative Entropie? Hat jemand Antworten auf solche Fragen? Oder braucht es die gar nicht?
Dem Unendlichen kann man sich wohl nur auf eine einzige Weise nähern: kontinuierlich. Das hat DFW mit US getan. Dabei hat er, wie es aussieht, kein Ende gefunden. Weil’s keins gibt. Das kann einer als grandiosen Ausblick empfinden. Aber auch als Aussichtslosigkeit. David Forster Wallace, der sich im Unendlichen aufgehalten hat, zwischen den absoluten Gegensätzen, in einem Dazwischen, muss sich dann doch zu einer Seite hinüber geneigt haben. Welche der beiden das auch gewesen sein mag, er ist dabei offenbar aus dem Gleichgewicht gekommen.
Wenn auch nicht jede Zeile gleich erhellt:
geschehn aus unablässigem Bestreben.
Aléa hat’s hierher gestellt,
und zwar soeben.
Geschrieben: Januar 6th, 2011 unter - Wallace, D.F. : Unendlicher Spaß, desaströs, Lessons & Lectures










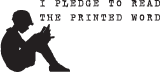


Pingback von Menschliche Schönheit als “partiell doppelte Blindheit” « Der Buecherblogger
Datum/Uhrzeit 6. Januar 2011 um 12:53
[...] (AleaTorik über die Figur der Joelle in David Foster Wallace “Unendlicher Spaß”) [...]