12 Januar 2011
Unendlicher Spaß III: Verschleierung und Enthüllung
In meinem ersten Beitrag „Chaos und Kosmos“ habe ich die Behauptung aufgestellt, man könne anhand von Gegensatzpaaren Unendlichkeiten beschreiben. Ich wollte Joelle van Dyne als das Zentrum des Romans verstehen. Nicht allein, weil sie die Hauptrolle in dem Film spielt, der dem Roman seinen Titel gibt, sondern vor allem weil sich am Thema Schönheit, an der Gegensätzlichkeit von Schönheit und Entstellung, der Begriff der Unendlichkeit fassen lässt. Dieser Begriff scheint mir für das Verständnis des Romans von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit.
Beim Stand meiner Lektüre, Seite 1100, gibt es neben einer Handvoll Anspielungen auf Joelle lediglich drei größere Textstellen, in denen sie eine Rolle spielt. Die Party der Freundin Molly Notkin, auf der sie Crack raucht und eine Apnoe erleidet (S. 316 – 344), das Gespräch mit Gately im Ennet House (S. 766 – 776) und schließlich ihr Bericht über das Verhältnis zu Orin und seiner Familie (S. 1056 – 1073). Ich möchte lediglich das Gespräch zwischen Joelle und Gately näher anschauen. Das sieht vom Umfang her kaum aus wie das Zentrum eines 1500-Seiten Romans. Die beiden sitzen am frühen Morgen im Erdgeschoss der Entzugsanstalt und schauen aus dem Fenster. Gately fragt Joelle wie es unter ihrem Schleier aussieht. Er will sich ein Bild von ihr machen.
Um zu verstehen, was es heißt, sich ein Bild zu machen, untersuche ich einige Zeilen aus der „Penthesilea“ von Heinrich von Kleist. Die Figur der Penthesilea steht historisch betrachtet an einer Zäsur. Als Vertreterin eines primitiven Volkes, ja als seine höchste Repräsentantin, ist ihr die individuelle Partnerwahl nicht erlaubt. Eine Amazone muss einem Mann im Kampf begegnen. Geht sie als Siegerin aus der Konfrontation hervor, kann sie mit dem Besiegten nach Belieben verfahren. Was die Amazonen von den Besiegten wollen, ist eindeutig: sie wollen mit ihnen schlafen. Sie wollen lieben und geliebt werden. Aber Liebe ist nur unter dem Patronat der Gewalt denkbar. Die Gegner auf dem Schlachtfeld verstehen nicht, dass diese Frauen Gewalt anwenden, weil sie das Gegenteil wollen. Individualisierung – durch persönliche Interessen oder die selbständige Wahl eines Liebespartners – ist den Amazonen aus historischen Gründen nicht erlaubt. Penthesileas Mutter hatte ihr auf dem Totenbett jedoch prophezeit, dass sie sich in Achill verlieben werde. Mit der Liebe, und mit der Sehnsucht nach einem bestimmten Liebesobjekt – also nicht mehr einem Mann, den der Zufall ihr im Kampf zuführt – beginnt Penthesilea ihre Individualisierung. Schlafen kann man zur Not noch mit jedem, aber lieben kann man nicht jeden. Um dem überlieferten Selbstbild Genüge zu tun, muss sie den Held der Griechen, als sie vor den Toren Trojas aufeinandertreffen, im Kampf unterwerfen. Als Individuum aber ist sie ihren eigenen Empfindungen unterworfen. Es kommt im Verlauf der Tragödie zu einer Konfrontation verschiedener Ebenen der Persönlichkeit Penthesileas. In der 15. Szene, da sie, einem Irrtum unterliegend, sich als Siegerin des Zweikampfes wähnt, will Achill wissen, wer sie ist und was, sollte seine Seele ihn fragen, er ihr sagen könne. Darauf antwortet Penthesilea:
„Wenn sie dich fragt, so nenne diese Züge
Das sei der Nam‘ in welchem du mich denkst.-
Zwar diesen goldnen Ring hier schenk‘ ich dir,
Mit jedem Merkmal das dich sicher stellt;
Und zeigst du ihn, so weist man dich zu mir.
Jedoch ein Ring vermiß’t sich, Namen schwinden;
Wenn dir der Nam entschwänd, der Ring sich misste:
Fänd’st du mein Bild in dir wohl wieder aus?
Kannst du’s wohl mit geschloßnen Augen denken?“
Erst als Achill ihr das Bild zurückspiegelt, das sie von sich selbst hat, erst als er ihr dies Selbst bestätigt, nennt sie ihm ihren Namen. Der Name ist ihr ebenso unwichtig wie ihre Funktion als Königin. Sie fragt nach ihren Zügen, nach ihrer Eigenheit. Achill soll Penthesileas „Züge nennen“ und ihr Bild, ihr Gesicht, ihr Auftreten, ihr Sprechen, ihre Individualität – das was sie von den anderen Amazonen unterscheidet – ; dies sei „der Nam‘ in welchem du mich denkst“. Am Ende der Tragödie steht Penthesilea fassungslos vor der verstümmelten Leiche des Achill. Sie fordert Rechenschaft und will wissen, wer für diese unfassbare Tat verantwortlich ist. Der letzte, der 24. Auftritt, ist das Beste, was ich aus der deutschen Dramatik kenne. Penthesilea blickt, heißt es in den letzten Zeilen des vorhergehenden Auftritts „in das Unendliche hinaus“. Sie, die die Handlung immer weiter getrieben hat und die, von ihrer Begierde getrieben, kaum einen Moment der Ruhe erlebte, steht da, handlungsunfähig, ja geradezu gelähmt. Sie weiß nicht, dass sie selbst es war, die Achill zerfleischt hat, weil ihr dieses Selbst im Konflikt divergierender Ebenen ihrer Persönlichkeit abhanden gekommen ist. Diese konfligierenden Seiten sind Freiheit und Zwang, Selbstbestimmung und Unterwerfung, Matriarchat und Patriachat und vor allem Selbstbild und Fremdbild. Das Bild, das sie von sich hat, lässt sich nicht als ein einheitliches verstehen und erkennen. Die Einheitlichkeit muss Penthesilea erst wiederherstellen. Diese Wiederherstellung ist zu verstehen als ein Zurückgewinnen ihrer Handlungsfähigkeit. In vollkommener Übereinstimmung von Rede und Handlung, von Wort und Tat erschafft sie ihr Selbst, und zwar als ein einheitliches, indem sie sich, oder besser gesagt indem sie dieses Selbst vernichtet. Sie stellt das Bild von sich wieder her, indem sie sich tötet.
Der Schleier ist heute, soweit ich weiß, ausnahmslos in arabischen Gesellschaften akzeptiert und teilweise auch gefordert. Er ist ein Attribut der Frau. Das Weibliche ist das Verschleierte. Durch den Schleier soll der Blick unterbunden werden. Aber die verschleierte Frau sieht die Blicke der anderen ja dennoch. Sie kann sogar unbeobachtet zurückschauen. Und der Mann schaut ja trotz des Schleiers hin, er ist womöglich umso neugieriger. Verschleierung soll, so die gängige Interpretation, das Begehren des Mannes im Zaum halten. Es gibt allerdings auch eine Verschleierung, die gerade in westlichen Gesellschaften besonders stark ausgeprägt ist, die Kleidung. Kleidung dient kaum noch ihrer ursprünglichen Funktion, dann bräuchten wir nicht fünf Mäntel und zehn Paar Schuhe. Die Kleidung ist ein Spiel mit der Nacktheit. Auch hier geschieht die (Ver-) Kleidung vor allem auf dem Körper der Frau. Frauen müssen jederzeit sexy, erotisch und begehrenswert sein. Der weibliche Körper wird in taillierte Kleider gezwängt, Frauen stöckeln mit hohen Absätzen und Hotpants durch die Gegend und zeigen in manchmal geradezu grotesken Dekolletés ihre Brüste in der Öffentlichkeit herum. Auf ihren Körpern findet ein Spiel statt, das zwischen Enthüllung und Verbergen changiert, zwischen Verheimlichen und Veröffentlichen. Dieses Spiel ist ein Spiel mit dem Blick des anderen. Das Gesicht ist der Ort, an dem dieser Blick aufgenommen, erwidert oder abgewiesen wird. Wenn Blicke nicht zugelassen werden, dann wird das Begehren nicht zuglassen. Das Begehren zu sehen und zu erkennen. Zu sehen, wie der andere aussieht und zu erkennen, wer er ist. Während der Schleier arabischer Gesellschaften das Weibliche in den Hintergrund drängt, um das Begehren im Zaum zu halten, will die Verkleidung westlicher Gesellschaften das Weibliche in den Vordergrund rücken, um dieses Begehren gerade zu entfachen.
Und wie man der einen Gesellschaft vielleicht vorhalten könnte, sie habe keine Vorstellung von der Lust, so könnte man der anderen vorhalten, sie habe keine von der Scham. Aber womöglich zeigt sich in den Schlafzimmern beider Gesellschaftsmodelle, dass sie sehr wohl einen Begriff vom jeweils anderen haben. Die scheinbare Zügellosigkeit westlicher Lebensformen, die Ausrottung der Intimität durch Voyeurismus, zieht möglicherweise die Mauern der Schamhaftigkeit umso höher. Auch die Gegensätze Lust und Scham müssen in einem Verhältnis zueinander stehen, sonst sind sie keine Gegensätze und eröffnen keine Unendlichkeiten, sondern lediglich Abgründe.
Das Gespräch zwischen Joelle und Gately dreht sich um dieses Thema, um Sehen und Verbergen, um Begehren und Entbehren, um den Blick und die Lust, die den Schleier lüften, und um die Scham, die ihn aufrechterhalten will. Eingeleitet wird es mit dem scheinbar absurden Beispiel einer Frau, „bei der jedes Bein kürzer war als das andere“. Bei einem Vergleich dient in der Regel die eine Seite als absoluter Wert, an der die andere Seite gemessen wird. Diese Relation zwischen Maß und Gemessenem fällt hier aus: beide Beine sind kürzer! Wittgenstein sagte einmal, und es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass DFW diese Stelle kannte: „Man kann von einem Ding nicht aussagen, es sei 1 m lang, noch, es sei nicht 1 m lang, und das ist das Urmeter in Paris.“ Ein wenig verkürzt (!) ausgedrückt: Man kann das Maß an das zu Messende halten, aber danach das Gemessene an das Maß zu halten, ist sinnlos. Mehr noch, es ist absurd. Weil man dann überhaupt keine Aussage mehr treffen kann, weder über das Maß noch über das Gemessene. In der Behauptung jedes Bein sei kürzer als das andere fällt das Maß weg, und damit der absolute Wert, an dem der relative gemessen werden könnte. Ein wenig gestreckt (!) könnte man sagen: genau darum dreht sich auch das folgende Gespräch zwischen Gately und Joelle, um den Wegfall jeglichen Maßes, um Maßlosigkeit. Es geht um Schönheit und Entstellung. Und damit um ein Sujet, für das es kein Maß gibt.
Dieses Gespräch hat zwei Ebenen. Beide Ebenen sind gleichzeitig präsent. Auf der ersten Ebene will Gately von Joelle lediglich die Erlaubnis zu fragen, was sich hinter dem Schleier verbirgt. Sie soll mit Ja oder Nein antworten. Auf dieser Ebene erhält er eine indirekte, ablehnende Antwort. Trotz dieser Ablehnung fragt er, das ist die zweite Ebene, dennoch nach ihrer konkreten Entstellung. Und auf dieser Ebene erhält Gately, trotz der Ablehnung auf der ersten Ebene, auch eine Antwort. Weil er die Ablehnung auf der ersten Ebene erhalten hat, nimmt er die Antwort auf der zweiten Ebene auch nicht ernst. Obwohl er dort genau das zu hören bekommt, wonach er gefragt hatte. Die beiden Ebenen hemmen sich gegenseitig.
Gately will wissen was „fehlt“. Er wird mit seinen Fragen immer direkter „darf ich fragen, wie du entstellt bist?“, und dann fragt er ganz konkret, „was dahinter los ist, ob du schielst oder einen Bart hast“. Joelle antwortet auf seine Fragen nicht mit einer konkreten Auskunft zu ihrem Aussehen. Sie erklärt ihm stattdessen sehr genau die Gründe für das Tragen des Schleiers mit ihrer Mitgliedschaft in der L.A.R.V.E., der „Liga der Absolut Rüde Verunstalteten und Entstellten“. Deren Mitglieder erklären, indem sie den Schleier anlegen, „dass sie ihre Sichtbarkeit zu verstecken wünschen“. Hinter dem Schleier versteckten die Entstellten nicht nur ihr Gesicht, sondern ihre Scham darüber, sich verstecken zu wollen. Komprimiert heißt das: „Du versteckst dein Verstecken.“ Joelle zeigt Gately, dass bei ihm genau dieselbe Struktur vorliegt, wenn er glaube, er sei nicht plietsch genug, sich seiner Unplietischigkeit schäme und sie vor anderen zu verbergen suche. Danach geht das Gespräch wieder zu Joelle über und sie antwortet auf die konkreten Fragen schließlich mit einem Paradoxon. Wie immer ihre dann folgenden Formulierungen in der konkreten Situation und im Roman zu bewerten sind, da es diverse Anspielungen auf einen Säureangriff gibt, sie beantwortet die Frage sogar drei Mal direkt hintereinander: „Ich bin dermaßen schön, dass ich jeden fühlenden Menschen ganz einfach um den Verstand bringe. […] Ich bin so schön, dass ich entstellt bin. […] Ich bin vor Schönheit entstellt.“
Was ist denn Schönheit? Ist das Faszinierende an ihr das Enthüllende? Oder ist es vielmehr das Rätselhafte, das Verschleierte und Verkleidete? Schönheit bei Menschen ist keine abstrakte Schönheit. Der Betrachter fühlt sich hingezogen, oder sogar hineingezogen. Er taut auf und schmilzt dahin. Womöglich fühlt er sich auch abgestoßen von zu viel Schönheit und Oberfläche. Die Frage nach Schönheit wird die U.S.S.M.K., die die Wimpern Marios vor Verlangen die Wände hochgehen lässt, anders beantworten als Gately. Joelle war als junge Frau ungewöhnlich schön – es sind nicht viele Schönheiten, die dieses Buch bevölkern, spontan fällt mir nur noch Avril ein und die Schönheit dieser beiden Frauen wird wohl einer der Gründe sein, warum sie einander nicht mochten – inzwischen liegen aber Jahre des Crackrauchens hinter ihr. Aus dem schönen Gesicht ist wohl ein zumindest beanspruchtes Gesicht geworden. Sie hat vermutlich, wie die vielen Junkies in diesem Buch, wie Hal und sein Vater, miserable Zähne. Wenn sie noch welche hat.
Wie ist dieses Gespräch für die Figur der Joelle zu bewerten? Liegt ihr Reiz, nicht nur in dieser Situation, sondern auch in dem Film, womöglich gerade in dieser Ununterscheidbarkeit, in der Gleichzeitigkeit einander ausschließender Gegensätze? Ununterscheidbarkeit, die anhält, solange sie den Schleier trägt. Nach der Schlägerei und der Verletzung Gatelys sagt Joelle, dass sie sich nach langer Zeit zum ersten Mal vorstellen könne, den Schleier abzulegen. Das legt eher die Vermutung nahe, dass sie nicht etwa befürchtet ihr Gegenüber erstarre vor Schreck oder Anbetung. Das Anlegen des Schleiers hat wohl etwas mit dem Beziehungsende zu Orin zu tun, mit dem Ende einer Liebe und wenn sie jetzt an das Ablegen des Schleiers denkt, bedeutet das womöglich eine neue Liebe: Gately. Mit dem Ablegen des Schleiers käme nicht nur etwas ans Licht, die konkrete Entstellung, es verschwände auch etwas anderes, die Indifferenz, die Ununterscheidbarkeit. Vielleicht ist es gerade das, vor dem Joelle zurückschreckt. Als Madame Psychosis hatte sie in ihrer Radiosendung aus einer Schönheitsbroschüre folgenden Satz vorgelesen: „Die Wichtigkeit einer Maske liegt darin, den Kreislauf anzuregen.“ Also in übertragendem Sinne, Vorstellungen anzuregen und Phantasien zu beflügeln. Damit hätte es, wenn die Maske fällt, ein Ende.
Interessant in diesem Zusammenhang ist die Frage, was mit Joelle nach der Beziehung zu Orin geschehen ist. Denn zuvor war sie lediglich ungewöhnlich schön, aber noch nicht, was sie jetzt ist: lähmend schön oder lähmend abstoßend oder lähmend unentschieden. Ist die Faszination dieser Frau im Film vielleicht eher darin zu suchen, was Marathe vermutet, dann „Reiz plus Dichte“ zu viel für den Betrachter sei. Somit wäre die Wirkung der Joelle im Film eher in den Fähigkeiten des Regisseurs als in denen seiner Darstellerin zu suchen. Die Fläche für Projektionen – Kinoleinwand und Gesichtsschleier fallen hier zusammen – ist jedenfalls, solange man nichts sieht, außerordentlich groß. Vielleicht ist es gerade dies, was sich als das Lähmende erweist. Ähnlich wie in der Eifersucht, wo nicht der Betrug das Lähmende ist, die Tatsache, das Ja oder das Nein, sondern die Unsicherheit, ob er tatsächlich stattfindet. Die Unsicherheit über den anderen und die Unmöglichkeit Treue oder Untreue voneinander zu unterscheiden, da beides gleichermaßen möglich ist.
Welche Begriffe man auch nutzen mag – Unsicherheit oder Indifferenz oder Gegensätzlichkeit oder Dichotomie oder Gleichzeitigkeit – man könnte dies noch weiter treiben, bis hin zur modernen Physik und zur Unschärferelation. Ja sogar bis zu einer geschlechtlichen Unschärferelation: An einer Stelle wird Joelle einmal Jo Elle genannt. Ist sie vielleicht ein Mann (eine Frage, die letztlich wohl nur Jesus Jerkoff beantworten kann)? Orin, der Frauenheld, der gar nicht genug Sexualobjekte akquirieren kann und der ihnen nach dem Sex eine Acht auf die Flanken malt, das mathematische Zeichen für Unendlichkeit; Orin ist nicht einmal in der Lage die massive Erscheinung der Helen Steeply als einen transvestierten Mann, Hugh Steeply, zu identifizieren. Helen, der permanent die Brüste verrutschen, die offenbar nichts Feminines an sich hat und deren einziges weibliches Accessoire ihre Handtasche ist. Und zwar das Innere der Handtasche (!), welches von Spezialisten des Agentenwerkes „zur Herstellung des Weiblichkeitseffekts“ (S. 621) hergerichtet wurde. Weiblichkeit wäre dementsprechend nichts Äußerliches, sondern etwas Inneres, etwas Inwendiges und Verborgenes. Liegt der Reiz der Joelle vielleicht gerade darin, dass sie gar keine Frau ist?
Eine andere Möglichkeit zur Interpretation zeigt sich, als die angebliche Helen Steeply in der E.T.A. zu Besuch ist und für ein Interview recherchiert. Sie fragt nach dem Akademiegründer und seiner Tätigkeit als Filmemacher. Poutrincourt antwortet darauf, dass Incandenza die Arten des Sehens analysierte: „Die Analyse galt weniger der Frage, wie man etwas sieht, als der Beziehung zwischen Seher und Gesehenem. Das setzte er auf die vielfältige Weise auf den verschiedensten Gebieten um.“ (S. 979) Möglicherweise, damit sind dann auch die Grenzen der Interpretation erreicht und die Strapazierbarkeit des Motivs der Gegensätzlichkeit ebenso, hatte man als Betrachter dieses Films nicht nur das Gefühl etwas zu sehen, sondern auch das, gesehen zu werden.
Was sehen wir denn, wenn wir einander ansehen und wenn kein Schleier uns hindert? Unser Äußeres ist das Äußere unseres Inneren. Und nicht irgendein anderes Äußeres, ein arbiträres, willkürliches, zufälliges. Wir sind daran gewöhnt, als unser Ich oder unser Selbst zu empfinden, was wir sehen. Vielmehr, und das macht die Sache etwas kompliziert, das als unser Selbst zu empfinden, was wir nicht sehen; unser Selbst ist das, was die anderen sehen. Was wir sehen, ist das Selbst der anderen. Dieses Selbst ist keines, das von allen anderen separiert ist. Es ist keine solipsistische Konstruktion. Das eine Selbst entsteht vielmehr an den Grenzen zu den anderen: durch deren Zuschreibungen und Spiegelungen. Wir bekommen unser Selbst – vor dem Spiegel oder in irgendeiner anderen reflexiven Verfahrensweise – nicht so zu greifen, wie andere es uns begreifen lassen. Strenger formuliert könnte man sagen, dass ein Selbst nur dort das eigene Selbst ist, wo wir es durch einen anderen begreifen.
Gately fragt nach einer binären und abstrakten Opposition (Ja – Nein, Entweder – Oder) und kann die binäre konkrete Antwort (Sowohl – Als auch) erstaunlicherweise nicht deuten. Dass Gately ganz direkt fragt „darf ich fragen, wie du entstellt bist?“, ist, so empfinde ich das, keine unstatthafte Neugier. Er will sich ein Bild machen, nichts weiter. Ich lese dieses Gespräch der beiden als eine, allerdings ziemlich ungewöhnliche Liebesszene. Joelle reagiert darauf, indem sie sagt, dass sie sich vorstellen könne den Schleier abzulegen. Das verleitet mich zu der Annahme, dass sie zu derselben Interpretation dieses Gesprächs kommt wie ich auch. Wie Gately darauf reagiert, weiß ich noch nicht. Das ist der Preis des chaotischen, mobilierten Erzählens: die einzelnen Mobileteile und Bilder sind schnell mal wieder viele hundert Seiten lang weg; Gately ist, nachdem er angeschossen wurde, nicht wieder in den Vordergrund getreten. Möglicherweise wird er auf das von Joelle formulierte Paradoxon, den Zusammenfall der Gegensätze, reagieren. Diese Reaktion wäre möglicherweise die erste Wahl, wenn es um die weitere Einordnung des Begriffes Unendlichkeit im Zusammenhang mit der Schönheit Joelles geht. Schönheit ist – Urmeter hin oder her – immer auch eine Erfahrung der Maßlosigkeit. Und, mit meinem oben dargelegten Ansatz, auch eine Grenzerfahrung des Ich. Weil wir in der Schönheit, zumindest in der optizentristischen Variante, auf den Blick des anderen angewiesen sind. Um uns selbst und um den anderen zu erfahren. Selbst in der O.N.A.N.ie ist der andere absolut irreduzibel für die Selbst-Erfahrung.
Um mit den Worten DFWs zu enden, natürlich im Rahmen meines Themas, Gegensätzlichkeit als Möglichkeiten das Unendlichkeit zu fassen: „Je näher die Konkretisierung rückt, desto abstrakter wird sie.“ (S. 344) Das ist mehr als bloß witzig. Kurz vor einer Prüfung oder einem wichtigen Termin kann man sich das Bevorstehende kaum noch vorstellen. Vielleicht, weil da keine Vorstellung mehr vonnöten ist? Ganz nah am Gesicht eines anderen, verschmilzt dieses andere mit dem eigenen Gesicht und das andere Selbst mit dem eigenen. Vielleicht, weil da keine Vorstellung mehr vonnöten ist? „Vielleicht“ ist eine komfortable Mitte zwischen Ja und Nein. Aber letztlich unbefriedigend.
Wenn auch nicht jede Zeile gleich erhellt:
geschehn aus unablässigem Bestreben.
Aléa hat’s hierher gestellt,
und zwar soeben.
Geschrieben: Januar 12th, 2011 unter - Wallace, D.F. : Unendlicher Spaß, desaströs, Lessons & Lectures










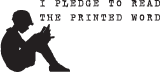


Kommentar von avenarius
Datum/Uhrzeit 13. Januar 2011 um 00:36
Liebe Alea,
ich bin noch viel fauler als Sie; aber gleichzeitig im Verschenken unschlagbar.
Wovon ging der Mönch nun hauptsächlich noch aus: dass Gott nur redet, wenn die Kreatur schweigt!
Puritanisch, calvinistisch wie er war, mürrisch und der endlichen Gnade harrend, entwickelte sich ihm unter den Hand und in einem Husch – der gefühlvolle Lebensschwung weltlichen Treibens. Wie konnte dies geschehen?
Die Zeilen über `Penthesilea` finde ich mehr als intelligent.
Sie stellen sehr klar heraus, dass bei Kleist der große Gedanke identisch ist mit der Erhabenheit des Tragischen.
“…je konkreter desto abstrakter…”
Dann müßten wir ja schon recht nah drann sein.
Diese Auffassung teile ich.
Aristotelische Internationale.-
Je mehr wir uns dem In-Möglichkeit-Sein nähern, desto weniger halten wir Abweichungen vom Nach-Möglichkeit-Sein für möglich.
D. h. wir verblöden.
Grüße aus einem jetzt neuzeitlich-finstern Rhein-Main