08 Dezember 2011
„Dies ist die Schichte von Moo Pak“
Ich da Schmerz
„Moo Pak“ von Gabriel Josipovici
Ich bin enttäuscht und gleichermaßen begeistert. Mit Enttäuschung fing es an und mit Begeisterung endete es. Das Buch, zurecht nicht als Roman betitelt, beginnt mit einem Lamento, überwindet das jedoch und entwickelt sich zu etwas anderem: zu einer Überwindung des Lamentos.
Zuerst fällt die eigenwillige Form auf: auf gut zweihundert Seiten findet sich nicht ein Absatz. Es ist ein durchfließender Text, der sich nicht darum schert, ob Thema, Sujet oder Akteure wechseln. Das ist in den ersten Zeilen bereits angelegt, tritt aber erst auf den letzten Seiten, die das Buch im wahrsten Sinne des Wortes krönen, in aller Deutlichkeit hervor: Thema, Sujet oder Akteure wechseln nicht. Es gehen nur zwei Männer durch die Parks der britischen Hauptstadt spazieren. Jack Toledano ist der Sprecher, berichtet wird aus der Perspektive des Zuhörers Damien Anderson, über den der Leser so gut wie nichts erfährt. Dann gibt es noch eine dritte Person, ein rätselhaftes Ich, das nur zweimal erwähnt wird, auf der ersten und der letzten Seite: „Am Dienstag erhielt ich ein Briefchen von Jack Toledano, in dem er mich bat, ihn am selben Tag zur üblichen Zeit im Star and Gartner in Putney zu treffen, schrieb Damien Anderson. Diese Briefchen kenne ich gut.“
Jack Toledano, ein sephardischer Jude aus Ägypten, ist als Jugendlicher nach England gekommen, unterrichtet Literatur an einer Universität und schreibt selbst Bücher. Er liebt die Literatur – Proust, Beckett, Bernhard, Pascal, Kleist, Goethe, Rabelais, Mann, Shakespeare, Eliot, Dante, Milton, Kafka, und vor allem sein Vorbild, nahezu eine Obsession, Jonathan Swift, ein Autor, den wir heute, ich jedenfalls, beinahe nur noch als Verfasser von „Gullivers Reisen“ kennen und da auch nicht einmal in der richtigen Fassung, sondern ad usum Delphini, also in einer gereinigten Version für kindliche oder anderweitig gefährdete Gemüter -; auch Vertreter der Kunstgeschichte werden genannt – Meyer Schapiro, Panofsky und Gombrich – ebenso Philosophen – Wittgenstein, Adorno, Chromsky -, Musiker – Strawinsky, Mozart, Beethoven, Stockhausen – Maler außerdem. Im Grunde wird der gesamte klassische Kanon der westlichen Welt bemüht. Daran wird dann die reale Welt gemessen; dass diese mickerige kleine eindimensionale Welt der Übermacht ihrer Interpreten schlechterdings nicht standzuhalten vermag, muss ich nicht weiter ausführen.
Was Jack Toledano von der wirklichen Welt kennt, ist erlesen und alles anderes ist es nicht. Alles andere ist schlecht. Gute Bücher und ihre Autoren, das sind für ihn „wahre Freunde“. Die wirkliche Welt hingegen hört falsche Musik, liest falsche Literatur und schaut sich die falschen Bilder an. Ich weiß, was er mit seinem Lamento meint. Dennoch ist mir das zu schematisch. Ich bin ebenfalls eine Anhängerin der Literatur, ich lese, ich schreibe, ich promoviere: in über unter durch aus und von Literatur. Dennoch kann und will ich dem nicht folgen. Ich liebe die Literatur nicht! Ich liebe auch ihre Verfasser nicht. Wenn man das, wie dieser Protagonist, tut, darf man sich nicht wundern, wenn einem keiner mehr folgen kann und will. Wovon Toledano spricht, ist kein Zustand der Weltfremdheit oder Weltabgewandtheit, der Zurückgezogenheit oder Einsamkeit, die zum Schreiben und auch zum Lesen notwendig sind, sondern schlicht eine Verwechslung von Leben und Literatur.
Ich halte die Klage weder für eine ernstzunehmende literarische Gattung, noch für eine entsprechende Lebenseinstellung, da sie nur den Verlust des Alten beweinen und die Mangelhaftigkeit des Neuen beklagen kann. Und in diesem Buch wird zu viel geklagt, über die Jugend, über die Verfallenheit der westlichen Zivilisation ans Geld, über die Destruktivität von Radio und Fernsehen, die Angst vor der Stille, die Anonymität in den Städten. Das alles auf intellektuellen Niveau, da sind richtig schöne und kluge Bemerkungen dabei (von denen ich einige noch gesondert zitiere): Zivilisationskritik mit Tradition, aber ohne Innovation. Das sind Einsichten, die nicht wirklich faszinierend sind und die, selbst wenn sie neu sein sollten, klingen, als hätte man sie schon einmal gehört. Da steckt zu viel Bücherwissen ohne echtes Leben dahinter.
Langsam aber löst sich das vom Lob der Literatur, das in Wahrheit ein Lamento über die Welt ist. Langsam wird das Buch besser: in dem Maße wie Jack Toledano auf seine Obsession zu sprechen kommt. Und indem er das tut, kommt er zum eigenen Schreiben. Er hat einige Bücher geschrieben, denen er inzwischen eher verhalten gegenübersteht. Jetzt träumt von einem großen Wurf, einem komplexen Werk, mit einer vielschichtigen Konstruktion. „Moor Park“ soll sein neues Buch heißen, nach dem Anwesen von Sir William Temple, bei dem Jonathan Swift Sekretär war. Ein Jahrhundert danach wird das Anwesen als Irrenanstalt genutzt. Während des Zweiten Weltkriegs sitzen Dechiffrierspezialisten in diesen Räumen, nach dem Krieg werden dort Sprachforschungen an Primaten betrieben und dann dient es als eine Sommerschule, wo Ausländer Englisch lernen. Was alle diese Elemente, diese historischen Sedimente miteinander verbindet, ist die Sprache: Swift als der große Schriftsteller; Irre, die sich kaum noch artikulieren können; die Ver- und Entschlüsselung von Sprache durch Codes; Tiere, die die Menschensprache lernen und schließlich Menschen, die eine Fremdsprache lernen sollen. Langsam findet das Buch zu seinem Thema!
Das ist die Geschichte einer Faszination durch den Schriftsteller Jonathan Swift, seiner Tätigkeit als Sekretär, seine Karriere als Politiker, der anschließenden Verbannung und seines lebenslangen Verhältnisses zu Stella, über das man nichts Genaues erfährt. War sie mehr als nur seine damals gerade achtjährige Schülerin? War sie seine Halbschwester, seine Geliebte, seine Frau? All seinen Briefen an sie ist das nicht zu entnehmen und als sie schließlich stirbt, bezeichnet er das als das wichtigste Ereignis seines Lebens. Verboten es die damaligen Konventionen, dass die beiden auf irgendeine Weise ihr Verhältnis, ihre Emotionen zueinander in Worte fassten? Am Ende seines Lebens erkrankt Swift, wie man das heute formulieren würde, an Demenz. Er findet keine Reime, keine Worte mehr und wiederholt nur noch: „Ich bin, was ich bin, ich bin, was ich bin.“ Der vielleicht beste englische Schriftsteller ist nicht mehr in der Lage, einen vernünftigen Satz zu formulieren.
Ludwig und Bertrand wollte man in Moor Park die menschliche Sprache anerziehen, was schließlich in einer Äußerung Bertrands gipfelte, also in Zeichen, die man in Sprache übersetzte: „Ich da Schmerz“. Das wurde von den englischen Forschern als Ausdruck der Individualität und des Menschseins verstanden. Nachdem sie allerdings erkennen mussten, dass die beiden kaum je über eine minimale Artikulation hinauskämen, wurde das Forschungszentrum aufgelöst und Ludwig und Bertrand an einen Zoo verschickt. Unterwegs fielen ihnen die Namensschilder ab und als man sie am Ankunftsort identifizieren wollte, antworteten beide bei beiden Namen mit „Ja“. Nicht einmal ihren eigenen Namen hatten sie in all den Jahren gelernt und fielen so wieder in die alte Situation zurück, vor jeder Individualität, namenlos waren sie einfach wieder nur das, was sie in Wahrheit immer gewesen sind: zwei Schimpansen, die irgendwelche Knöpfe drückten. Aber ohne die Forscher, die dem einen Sinn zuwiesen, waren das einfach nur Knöpfe.
Die aufrechte Haltung ist nicht nur die Ursache für den Hexenschuss, sondern auch die Bedingung der Sprache. Tiere können nicht sprechen, weil ihr Kehlkopf nicht in der entsprechenden Lage ist. „Nur ein aufrecht stehendes Wesen ist in der Lage, seine Vokale so zu bilden, daß er (sic!) die ganze Vielfalt der Töne hervorbringen kann, die die menschliche Sprache ausmachen. Tiere können auch nicht sprechen, weil ihr hirnphysiologischer Apparat es nicht hergibt: Sprechen bedeutet, den Wunsch nach sofortiger Befriedigung zugunsten der langfristigen aufzugeben. Sprechen bedeutet einen zweiten Vokal – also den geöffneten Mund, der einfache Laut – zugunsten eines Konsonanten – dem erneuten Schließen des Mundes – zurückzustellen. Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen „Maaa“ und „Mama“. Es ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier!
Mit Ende dieses Textes kommt der Redner auch zum Ende seines eigenen Textes. Nicht mehr lange und er kann seinen Roman abschließen. Es fehlt nur noch der Schluss. Aber gerade das, so wendet er sich eindringlich an sein Gegenüber, sei wichtig als alles andere, wie ein Schlussstein, der alles Vorhergehende zusammen hält: “Ein Buch ist wie ein Leben, sagt er. Wenn wir beginnen, unserer selbst bewußt zu werden, glauben die meisten von uns, daß wie viele verschiedene Wege einschlagen können und daß sie alle den gleichen Wert haben. Zugleich sind wir davon überzeugt, daß wir viel Zeit haben und nach ein paar Jahren, wenn wir meinen, den falschen Weg gegangen zu sein, noch einmal von vorn anfangen können. In der Mitte unseres Lebens, sagte er, wissen wir sehr wohl, daß wir einen falschen Abzweig oder sogar mehrere davon genommen haben, aber wir sind nur schon zu weit, und uns bleibt nur, einfach weiterzumachen. Doch wenn wir uns dem Ende unseres Lebens nähern und spüren, sagt er, daß nicht mehr viel Zeit bleibt, erkennen wir, daß jetzt jeder Schritt richtig gesetzt werden muss, weil es wirklich keine zweite Chance mehr gibt.“ [der Wechsel zwischen Präsens und Präteritum scheint keinerlei Ursache zu haben, sondern ist wohl eher der Nachlässigkeit geschuldet, und ein wenig schludrig bin ich ja selbst auch: Also Schwamm drüber!]
Alle zuvor angesprochenen Sedimente sind abgesunken, die Zeiten sind untergegangen, die Menschen in Moor Park sind verbannt worden, die Dechiffrierung von Nachrichten war nicht mehr zeitgemäß, die Affen landeten wieder im Zoo und die englische Sprache, dieses wunderschöne, überkandidelte Idiom aus dem Mund des peniblen, womöglich inzestuösen englischen Adeligen, klingt bei einem Asiaten, der einen Schulaufsatz über die Geschichte dieses Anwesens schreiben muss, dann so: „Dies ist die Schichte von Moo Pak. Dies ist die Schichte Sift’n Stella. Dies ist die Schichte Ludy’n Bertram. Die ist die Schichte ein Irra ein Irra in Kella’n Irra schraibd vergangen Jahunnt um Jahunnt ein Fluß ein Wald, Pak’n Moo ‘n Schrai‚ ‘n Grins am selm Ort viele Jahr“.
„Dies ist die Schichte von Moo Pak“: Dies ist die Geschichte eines misanthropischen englischen Gelehrten, der an seinen eigenen hohen Werten scheitert, an der Liebe zur Literatur, der einen Roman schreiben will und der, der Leser ahnt es bereits, scheitert. Das Schicksal aller vorhergegangenen Stadien ist auch das eigene und man muss nicht viel vom Schreiben verstehen, um zu erkennen, dass das Ganze ein Schuss in den Ofen ist: „Ich habe eine Variante der Fibonacci-Zahlen benutzt, um die Anzahl der Teile im Buch und die Anzahl der Abschnitte in jedem einzelnen Teil zu bestimmen, sagte er, und ich habe Palindrome benutzt, die ich allerdings manchmal nach weiteren Egeln verändert habe, um die relative Länge eines jeden Abschnitts festzulegen. Die sechs Themen – Swift, Codes, Affen, Gärten, Wahnsinn und Sprache – werden nach den Regeln einer Sestine entfaltet, die von einer anderen Sestine mit sechs Unterthemen, Liebe, Masken, Dummheit, Alter, Grenzen und Nahrung überlagert werden.“
„Dies ist die Schichte von Moo Pak“: Eine Geschichte, deren letzten zehn Seiten dann nachgerade großartig sind. Seiten, die man nicht zu schätzen weiß, wenn man die vorhergehenden nicht gelesen und wiederholt gedacht hat, dass das alles miteinander nicht wirklich genial ist. Auf den letzen Seiten begreift man, warum das so ist und so sein muss. Weil genau das die Geschichte ist, die hier erzählt wird. Die Geschichte des Anwesens von William Temple, die seines Sekretärs Jonathan Swift, die Geschichte Stellas, der Irrenanstalt, der Dechiffriereinheit, des Forschungszentrums für Primaten und der Schule. Das ist die Geschichte der Grenzen der Sprache. Und das wiederum ist die Geschichte der Sprache selbst.
„Dies ist die Schichte von Moo Pak“: Ein kluger, belesener Mensch, ein Gelehrter, ein Dozent für Literatur, der zehn Jahre seines Lebens an einen Roman setzt, der Frau und Kinder gehen lässt, der mit einem Freund Spaziergang um Spaziergang macht, immer wieder von seinem Roman erzählt, manisch und obsessiv, und der sich am Ende eingestehen muss, dass er es nicht schafft und mit leeren Händen dasteht. Das ist eine ganz bittere Geschichte, der sehr viel mehr als nur zwei Konsonanten fehlen. Und dann kommt das Großartige. Die letzten Seiten, die hier schon erzählt sind. Denn er schafft es doch! Er schafft es, obwohl und weil und indem er es nicht schafft. Nicht er selbst ist es, der diesen Roman schreibt. Es ist Damien Anderson, der das tut, indem er von den gemeinsamen Spaziergängen berichtet, und diese Aufzeichnungen dann als seine Gespräche mit Toledano bezeichnet. Das ist der Witz dieses Buches: es gibt natürlich keinen Damien Anderson. Es ist Jack Toledano, der das schreibt. Und es gibt auch keinen Jack Toledano. Natürlich nicht!
„Dies ist die Schichte von Moo Pak“: Ganz am Ende taucht zum zweiten Mal dieses ominöse „Ich“ auf. Die einzige Person, die es wirklich gibt, die Verschmelzung von Damien Anderson als Toldeanos gefälligem und selbstlosem Zuhörer und Toledano selbst. Dieses lyrische Ich, der Vertreter des Autors im Text, der Vertreter Josipovicis, ein sephardischer Jude aus Ägypten der in London Literatur unterrichtet und eine Leidenschaft für Swift hegt, der vielleicht misanthropisch auf die nächste Generation schaut und dem England in all den Jahren ein wenig fremd geblieben oder erst geworden ist: Das ist ein „Ich“, das sich selbst zum „Du“ macht.
„Dies ist die Schichte von Moo Pak“: Das ist eine scheinbar banale und gerade deswegen ganz große Konstruktion, die hinter dem schmalen Band steckt.
„Dies ist die Schichte von Moo Pak“: das ist die Kunst aus einem gescheiterten Roman ein großes Buch zu machen.
„Dies ist die Schichte von Moo Pak. Dies ist die Schichte Sift’n Stella. Dies ist die Schichte Ludy’n Bertram“.
Gabiel Josipovici
Bibliothek Suhrkamp 1457,
Pappband, 217 Seiten, 13,90 €
ISBN: 978-3-518-22457-1
Bei Kommentaren bitte beide Worte eingeben, auch wenn das Captcha sie zu etwas anderem auffordert. Hören Sie nicht darauf, hören Sie auf Ihre innere Stimme, die Ihnen einflüstert, dass Sie mit zwei Worten überallhin kommen.
Wenn auch nicht jede Zeile gleich erhellt:
geschehn aus unablässigem Bestreben.
Aléa hat’s hierher gestellt,
und zwar soeben.
Geschrieben: Dezember 8th, 2011 unter - Josipovici, Gabriel : Moo Pak, schikanös










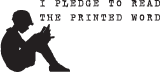


Kommentar von Der Buecherblogger
Datum/Uhrzeit 10. Dezember 2011 um 12:45
Liebe Aléa,
in Ihre Lektürefußstapfen zu treten ist allemal bereichernd. Nicht einmal das Buch muss man kennen, um mit Ihren klugen Bemerkungen auf Entdeckungsreise zu gehen. So las ich heute vormittag noch die Kurzgeschichte “A glass of water” mit den Chardinstillleben auf der Seite des Autors:
http://www.gabrieljosipovici.org/glasswater.shtml
Auch dort ein scheinbarer Dialog mit sich selbst, der in einer Art Schlusspointe kulminiert. Dialoge mit sich selbst, führen das nicht alle Schriftsteller(innen)? In der Kurzgeschichte wird das erzählende Ich sogar zu einem scheinbar längst verstorbenen Gespenst.
Nur bei Ihren Einlassungen über die menschliche Sprache und das Unvermögen der Schimpansen reizt es mich zu widersprechen. Da Sprache ein Zeichensystem ist und nicht unbedingt eines mit Lauten, behaupte ich, dass gerade Literaten und Sprachwissenschaftler eine eingeschränkte Sichtweise auf ihr Forschungsgebiet haben. Tiere (ich bin mir sicher, dass der Labrador und der “Kleine Onkel” mit Ihnen gesprochen haben) benötigen weder den aufrechten Gang noch die Aneinanderreihung von Vokalen und Konsonanten, um sich auf eine Weise verständlich zu machen, die weit über die menschliche Sprache hinausgeht. Wenn man genug Empathie hat, kann man Ihnen sogar beim Schweigen zuhören.
Herzlichen Gruß
Dietmar