22 Reiseerzählungen aus dreißig Jahren sind hier versammelt. So unterschiedlich sie sind – ihre Klammer ist die Suche, die sich im Titel manifestiert: Die Suche nach dem/den Ende/n der Welt; einem Platz, der dann vielleicht der Ort zum Wirklich-Werden ist. Manchmal fragt sich der Leser: Hat er es nicht diesmal gefunden? In Patagonien, Isafjördur oder Timbuktu? In der Klaustrophobie der Weite auf Tonga? Oder vielleicht am Nordpol oder auf Kamtschatka? Wobei die Nordpolreise durch einen Freitod überschattet wird und auf Kamtschatka eine Russin mit dem Erzähler anbandeln möchte (Willemsen erzählt die ihm entgegengebrachte schüchterne Zuneigung wie ein Koch, der sein Soufflé vor der kalten Luft beschützt). Oder vielleicht auf dem Weg nach Mandalay/Myanmar im Gespräch mit dem Paar mit dem Truthahn in der Holzklasse des Zuges, der dort für den Erzähler enden muss, weil es die Dokumente so vorschreiben? Kinshasa wirkt wie ein apokalyptisch-anarchischer Endzeitort, auf der Reise nach Gibraltar hadert der Erzähler mit fortschreitender Dauer mit seiner immer mürrischer werdenden Partnerin und in Hongkong schleppt er sich mit Knieschmerzen zum Postamt auf einen Brief wartend und ansonsten tagelang das Hotelzimmer hütend. Während einer Busfahrt in Indonesien wird fröhlich gekotzt, im Allerweltsland vor Kapstadt scheint die Sonne, damit man eine Brillenmode gegen sie entwerfen kann und in Nepal ist die Schuldfrage bei einem Verkehrsunfall wichtiger als die Versorgung eines Verletzten – der dann notfalls noch einmal überfahren wird, damit klar ist, wer nun schuld ist.
Gemäß einem Diktum von Peter Handke über das Hineingehen in die Natur nimmt Willemsen die Probleme mit auf seine Reise und flüchtet nicht vor sondern höchstens mit ihnen. Das ist die Gegenversion des touristischen »Abschaltens«, eine Sesshaftigkeit im Aufbruch, die in anderer, neuer Umgebung vielleicht andere, neue Erkenntnisse liefert. Manchmal wird Willemsen, der als Ich-Erzähler genommen werden muss, in den Texten ein bisschen arg privat. Dann wird aus der Reiseerzählung eine Erzählung, die an einem fremden Ort spielt, der dann nur Kulisse ist. Das Ende der Welt ist dann zumeist das Ende eines Zusammenseins.
Glücklicherweise ist dies selten der Fall. Es wird auch kein »Selbstfindungsbuch«. Willemsen ist erstaunt, befremdet, belustigt, selten einmal traurig. Er assoziiert, plaudert, schwadroniert, belehrt, mutmaßt – und dies in dichten, komischen, skurrilen oder einfach nur wunderbar leicht erzählten Impressionen. Etwa, wenn er in Marokko die Ghettoisierung der Provinz bestaunt. Bemerkungen, die im übrigen auch aus der Eifel stammen könnten: Da schlossen sich die Wagenburgen des sozialen Wohnungsbaus, der Fremdarbeiter-Siedlungen, in denen man von den Schaufenstern ferner Fußgängerzonen träumte, mit ihren Export-Import-Läden, den Gemüsegroßhändlern und Baustoffmärkten. Dazwischen tauchten sie auf und ab wie in einem Mobile, die Gesichter der verzweifelten, der Schwervermittelbaren, der Bratwurstwender. Ihre Gesichter sahen aus wie leere Kinderwagen, und manchmal erschien dazwischen jemand, der sich durch den Anschluss an die internationale Sonnenbrillenmode Individualität zu geben versuchte. Oder in einem Lokal stand ein Mann an seinem persönlichen Glücksspielautomaten und schaute den blinkenden Kasten an, als erwarte er einen Liebesbeweis.
Das Buch ist gespickt mit solchen ornamentalen Ausschmückungen, die nur ganz selten ein bisschen absichtsvoll originell wirken. Nie stürzt Willemsen in Spott oder Narzissmus ab. Immer wieder reflektiert er auch über das Reisen selber, wobei so manch Neues und durchaus Selbstkritisches gelingt. So heißt es einmal: Der Reisende muss neben allen anderen Gefahren auch die Skepsis gegenüber der Anhäufung des Nutzlosen überwinden. Die Neugier findet ja immer auch dies. Vom eigenen Ich muss sie sich ab-, der Welt muss sie sich zuwenden und weiß nicht einmal, was sie finden wird. Trotzdem kann es geschehen, dass sie schließlich den Horizont erweitert… Reisende, so heideggert Willemsen dann, sind Auf-dem-Weg-Seiende und ihre Bewegung verwandelt Orte in Schauplätze. Sie kommen an, sehen sich um, beobachten Menschen dabei, wie sie in fremden Räumen sich und andere bewegen, und schon dieser Blick verfremdet die Fremde. Alle hier Lebenden sind Geschichte und schleppen ihre Geschichte durch den Raum. Nur der Reisende ist reine Gegenwart, nur er sieht die Stadt in ihrem Jetzt.
Insofern kann es sein, dass der Reisende mehr und genauer schaut als der Einheimische. Aber Skepsis bricht sich immer wieder Bahn. In Hongkong, im Hotelzimmer kommt ihm der Gedanke, dass das Reisen wie eine Projektion auf die fremde Tapete sei. Dort findet man das Haus, das man verlässt und auslöscht, fühlt die Verankerung, die man vergessen wollte. Und das Ende der Welt…das ist auch das eigene Zuhause, von einem bestimmten Standpunkt der Fremde aus betrachtet, und weil es so ist, sind diese entlegenen Stätten, die Ende keine Tore, durch die man aus der Welt hinausgelangt.
So schließt sich fast der Kreis zur Situation zu Beginn dieses Buches, als eine Bekannte einem achtjährigen Jungen erzählen muss, dass dieser einen bösartigen Hirntumor hat und nur noch wenige Monate zu leben hat. Nur wenig später nach dieser niederschmetternden Nachricht kam der Junge zu den beiden und bekannte in vorwurfsvoll[em] Ton: »Mir ist langweilig.« Und Willemsen reiste nun mit dem Jungen in Gedanken, indem er erzählte, zum Beispiel von den Spuren im Schnee, der Stelle, wo alle Schritte innehalten und ging für sich die Welt durch, die dieser Junge nie mehr sehen würde.
Diese Geschichte bildete die Initiation für die dann folgenden Reisen. Und wenn man einen derart sprachmächtigen Schauer hat wie Roger Willemsen, erübrigt sich fast die eigene Reise und man wird – für ein paar Sekunden – selber der Junge, der diese Orte (vermutlich) nie besuchen wird – und dies auch nicht mehr zu brauchen scheint. Das Schöne daran ist, dass man dabei nie zum Touristen wird. Wenn Willemsen dennoch einmal in die Touristenfalle tappt, folgt umgehend die entsprechende Katharsis. Etwa, als er in Gorée/Senegal weilt, der »Sklaveninsel«, von der Jahrhunderte lang in großer Zahl Sklaven in alle Kontinente »verschickt« wurden und dort diese Museumsinsel besucht und – entsprechend europäisch – »betroffen« ist: Es gibt Orte, die den Flaneur zwingen, es nicht mehr zu sein. Orte, in denen das Schweifen zum Stillstand kommt. Es gibt Orte der Zwangsvorstellung, die Bühnen der Manie. Es gibt schließlich Orte, die Erinnerung herstellen durch eine Sequenz von unausweichlichen, aufdringlichen, sich eigenmächtig vom Boden des Bewusstseins lösenden Bildern, und es gibt Nicht-Orte, die nichts als das Vergessen produzieren. Nicht-Orte, die wenig mehr sind als Aufbewahrungsorte für Menschen. Am Ende wird dieser Nicht-Ort Gorée zu einem Ort der Inszenierung, als ihm ein Hotelbesitzer erklärt, dass die wahre Hauptstadt der Sklavenverschiffung nicht der allgemein dafür gehaltene Ort ist, sondern die ehemalige senegalesische Hauptstadt Saint-Louis gewesen ist, die er eher lustlos und nur kurz besuchte. Da er dort jedoch nicht auf den entsprechenden Betrieb traf, assoziierte er dessen historische Dimension nicht. Die Idylle des Weltkulturerbes »verkitschte« seine Wahrnehmung und manipulierte sie.
Aber dies sind sinnesschärfende Erlebnisse, was sich beispielsweise zeigt, wenn er in ‚Birma‘ im Gespräch mit einer von der Armut »betroffenen« englischen Touristin befindet so mancher Reisende wäre wohl enttäuscht, wenn er an seinem Reiseziel ohne Bilder der Armut auskommen müsste. Willemsen glaubt – vermutlich nicht zu Unrecht -, dass diese Bilder, die das Gefühl der Überlegenheit aufkommen lassen, das Wohlbefinden des Westlers steigern. Eine Feststellung, die ihm prompt den Vorwurf des Zynismus einbringt. Dazu passt auch die Bemerkung zu einem Dorffriedhof auf Tonga, den hohen Grabhügeln der Reichen und, in scharfem Kontrast dazu, die Gräber der Armen, auf denen oft nur ein paar Kunstblumen abgelegt sind. Doch gehört nicht den Armen das Himmelreich fragt Willemsen, um dann hinzuzufügen: Könnte man ihnen nicht die Freiheit gönnen, arm zu sein und es sogar sein zu wollen?
Willemsen schreibt zuweilen durchaus shakespearehaft. Zwar liegt Böhmen nicht am Meer und das Paar im Zug nach Mandalay durfte das Meer nicht sehen, weil die Regierung es nicht wollte. Aber Mumbai heißt Bombay (vielleicht hieß es ja damals wirklich noch so), Myanmar Birma (und Rangun ist die Hauptstadt) und Island hat kaum eine Million Einwohner (tatsächlich sind es etwas über 300.000). Angaben, wann die jeweilige Reise stattgefunden hat, unterbleiben (man begibt sich – selten erfolgreich – auf die Suche nach Indizien). Aber irgendwann ist das nicht mehr wichtig und der Leser lässt sich das Buch ein, erfreut sich an den Bildern, die Willemsen da mit einem Notizbuch für immer und ewig festgehalten hat: Die Wäsche, die auf der Leine Schatten wirft (in Nepal). Der Flughafen Minsk, der wie aus einem Haufen von Dunstabzugshauben zusammengeschweißt aussieht und die jungen Mädchen dort, die unter grobmaschigen Wollpullovern ihre Brüste balancieren. Die südafrikanische Fernsehansagerin, die für die Dauer ihrer Erscheinung auf dem Schirm in ihrem Nicht-Sein, sogar Nichts-Meinen gefällt. Der klebrige Fliegenfänger, der von einem indonesischen Hausmädchen zunächst für ein christliches Requisit verehrt wurde, weil die drei Missionarsschwestern dieses Fliegenleimband immer über dem Küchentisch hängen hatten. Oder die spezifisch afrikanische Arroganz im Kongo dem Weißen gegenüber, einer späten Revanche und langsame[n] Umkehr des Rassismus, die aber irgendwann nur noch nervig ist.
Ergreifend, als der Erzähler Willemsen mit seiner Übersetzerin Lili ein Gefängnis in Cochrane/Chile mit dreizehn Insassen besucht. Sie sitzen unter anderem wegen Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung; in jedem Fall Vergehen ohne Todesfolge. Der Kommandeur ist ein 24jähriger, bulliger Mann in Uniform mit einem Stern auf der Schulterklappe. Was zunächst wie ein Horrortrip zu werden scheint, entpuppt sich als moderner Strafvollzug im besten Sinne: Die Gefangenen betreiben eine Schreinerei und nehmen Aufträge von der örtlichen Bevölkerung entgegen. Das Wachpersonal ist nur locker bewaffnet und trinkt manchmal mit den Gefangenen Mate oder diskutiert Fußballergebnisse. Und manchmal fällt ihnen oder sogar dem Kommandanten einer der Gefangenen ins Wort. Die chilenische Begleiterin ist überwältigt: »Es gibt es eben doch, das gute Chile…Hast du gesehen: Sie fallen ihm ins Wort. Sie widersprechen ihm sogar. Ein guter Mann ist das.« Da hat jemand unwissentlich ein Leben gewendet. Chile ist damit zum ersten Mal »ihr Land« geworden.
Das kann kein Dia- oder Fotoabend zeigen. Jeder Videofilm muss davor kapitulieren. So etwas schafft nur – das Wort. Wie in einem Dorf in Indonesien: Dort sitzt der Geschichtenerzähler neben dem Kino. Und raten Sie mal, wo Roger Willemsen Platz genommen hat.
Die kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
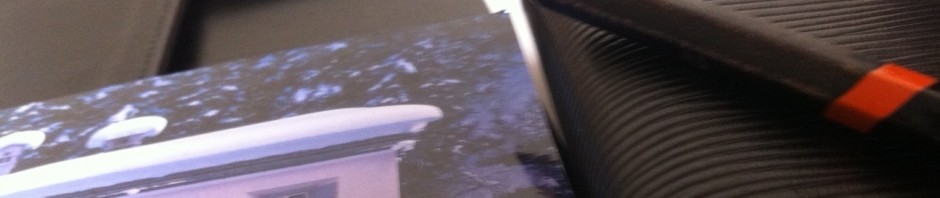



















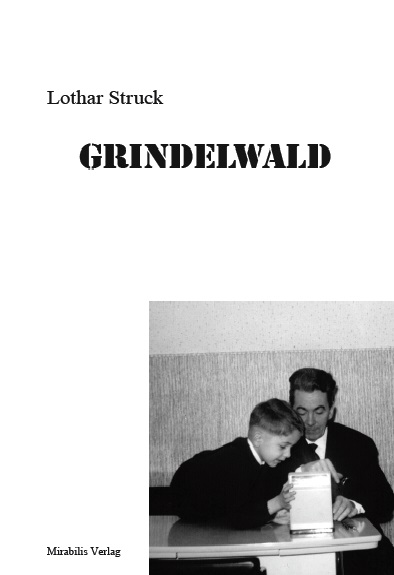
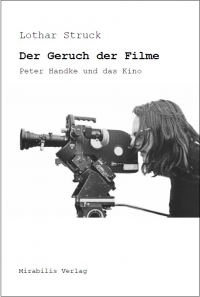
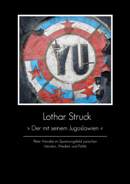
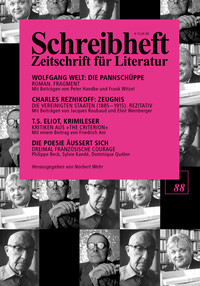
Als Berufs-Willemsen ein Reisebuch zu schreiben, zeugt bei bekannter Fallhöhe nicht von wenig Mut. Die initiierende Geschichte mit dem todkranken Jungen, der noch das Ende der Welt sehen möchte, kam dann auch direkt als Drahtseilakt daher, bei dem der Autor nicht nur einmal wankte. Ich denke aber auch, dass ihm der Versuch nach diesem Ende zu suchen, glänzend gelungen ist.
Was ich noch hinzufügen würde, ist der manchmal arg barocke Stil, die schiere Übermacht der endlosen Aufzählungen und teils überfrachteten oder konstruierten Bilder. Man kann eine Plastiktüte am Wegesrand auch einfach mal übersehen, ohne daran eine Ethno-Schnurre aufzuziehen. Das hat der Mann gar nicht nötig, der den Leser mit wenigen Sätzen anzuzünden vermag. Wie z.B. mit der Antwort des Weißrussen, der Paris Hilton, auf einer Prosecco-Reklame betrachtend, eine aufregende Frau nannte. Der Kulturchauvinist in uns wird in seiner Erwartung beschämt:
»Und wissen Sie, was das Aufregende an ihr ist?«
»Der Prosecco?«
»Ihr Phlegma.«
#1
Ja, Sie haben vielleicht Recht. Aber ich mag ab und ab barocke Schilderungen ganz gerne und auch Plastiktüten haben durchaus ihren Reiz. Man kann nur erahnen, wieviel er davon dann doch noch gnädig übersehen hat.
»Berufs-Willemsen«: Naja. Er ist Publizist, selbständig und wie soll er anders seine Brötchen verdienen?
#2
Berufs-Willemsen
Das war nicht pejorativ gemeint. Aber was soll der Mann sonst sagen, welcher Tätigkeit er nach geht? Ich mag auch seinen Stil, habe aber trotzdem häufig das Gefühl, dass er in der nächsten Kurve umkippt. Der Versuch durch innere Lastverlagerung zu kompensieren ist manchmal schon anstrengend.
#3
Dann hatte ich Sie falsch verstanden. Und schönes Bild: habe aber trotzdem häufig das Gefühl, dass er in der nächsten Kurve umkippt.
Ich habe seine Interviewsendungen auf Premiere (die gab es kostenlos) verehrt und »Willemsens Woche« geliebt. Den »Literaturclub« hat er totgequatscht (und schnell aufgegeben).
#4