Dexter Filkins, 1961 geboren, kam zum ersten Mal als Korrespondent der Los Angeles Times im April 1998 nach Afghanistan und berichtete von dort regelmäßig bis zum Sommer 2000. Kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001, die er in New York erlebte, ging er nach Afghanistan zurück und blieb dort bis Ende 2002. Von März 2003 bis August 2006 lebte Filkins im Irak und berichtete von dort für die New York Times aus deren Bagdader Büro. »Der ewige Krieg«, ein in den USA vielfach prämiertes Buch, verspricht, so der Untertitel, »Innenansichten aus dem ‚Kampf gegen den Terror'«.
Wieder einmal ein irreführender und effekthascherischer Untertitel. Er ist in doppelter Hinsicht irreführend. Zunächst existiert er im US-amerikanischen Original gar nicht – das Buch heißt dort einfach nur »The Forever War«. Zum anderen suggeriert man durch den Gebrauch der Vokabel »Kampf gegen den Terror« (der zudem noch eine falsche, verharmlosende Übertragung des »War on [against] terror[ism]« darstellt) eine mindestens teilweise introspektive Analyse über eine reine Schilderung des eigentlichen Krieges hinaus. Dies wird jedoch durch Filkins nicht geleistet (was in anderer Hinsicht im Laufe des Buches zum Problem wird). (Interessant ist, dass »The Forever War« auf Platz 2 der »New York Times«-Liste der besten »Non-fiction«-Bücher des Jahres 2008 steht, während auf Platz 1 Jane Mayers »Inside Story« über die Intentionen der Bush-Regierung mit dem Titel »The Dark Side« steht.)
Von diesem Ballast erst einmal befreit, kann das Buch als das gelesen werden, was es sein soll: Reportage, Reise- bzw. Erlebnisbericht, gelegentlich auch selbstreferenzielle Darstellung des Alltags eines amerikanischen Journalisten in einem kulturell vollkommen fremden (und fremdbleibenden) Gebiet. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert – nach einem Epilog gibt es rd. 70 Seiten Schilderungen aus Afghanistan. Der deutlich umfangreichere Teil umfasst dann fast 300 Seiten über den Irak.
Streunende Hunde und Wodka in Strömen
Filkins arbeitet durchaus mit Schockelementen in seinen Reportagen, die den Leser bannen sollen, was man gleich zu Beginn des Afghanistan-Kapitels feststellt. So ist er Ehrengast einer Art »Gerichtstag« im Fußballstadion zu Kabul im Jahr 1998. Zunächst wird einem vermeintlichen Dieb die Hand abgehackt. Und danach wird ausführlich über die Exekution eines Mörders berichtet. Gemäß der Scharia, so weiß Filkins, kann die Familie des Ermordeten den Täter durch Verzeihen begnadigen. Die Familie macht jedoch in diesem Fall keinen Gebrauch davon; ein Familienmitglied exekutiert den Delinquenten. Filkins schildert jedoch nicht nur diesen barbarischen Akt als solches. Für ihn steht dies repräsentativ für ein von ihm zutiefst verabscheutes System. Hier prallten, so die Stereotype, zwei Jahrhunderte aufeinander. Aber wieso vergisst er die Hinrichtungsprozeduren in den USA, die zwar nach außen »zivilisierter« verlaufen – de facto jedoch mit dem gleichen Resultat? Das Prinzip der Rache, welches er tief in der afghanischen (muslimischen?) Gesellschaft verankert sieht (im Irak-Teil erzählt ihm jemand, wie aus Rache das Blut des Mörders tatsächlich getrunken wurde), setzt er nicht im Kontext zum vermeintlich aufgeklärten Westen.
Wenn man eine Reportage als bloßes Abbild des Geschehenen versteht, erscheint dieser Einwand vielleicht als Beleg übermäßiger politischer Korrektheit. Aber Filkins belässt es eben nicht bei der bloßen Schilderung der Ereignisse. Seine Sprache ist immer auch schon implizit Urteil. Harmlos noch, wenn die Straßenkinder von Afghanistan angelaufen kommen wie eine Herde Wildpferde. Aber wenn er die Hand hebt, laufen sie weg wie streunende Hunde. Auf dem Hinrichtungsplatz gibt es ein Gerangel wie bei einem Rugbyspiel (die Vergleiche mit amerikanischen Symbolen ist natürlich für sein Publikum gedacht). Die »Taliban« (er definiert diesen Begriff nicht) sind grundsätzlich niederträchtig und finster (oder sind die finster Dreinschauenden immer gleich »Taliban«?), strohdumm oder schlichtweg Mistkerle.
Er berichtet von Hotel-Angestellten, die sich wehmütig an die goldene Zeit Ende der 1960er Jahre erinnern (und man sieht den Reporter nickend). Die Frauen trugen Miniröcke, in den zahlreichen Bars des Hotels flossen Gin und Wodka in Strömen und der Champagner wurde aus Frankreich eingeflogen. Dies ist offensichtlich (s)ein Ideal für eine einstmals funktionierende Gesellschaft. Dann seien die Dinge aus dem Ruder gelaufen zitiert er seinen Gesprächspartner und es folgt eine äußerst knappe und naturgemäß unvollständige Schilderung der historischen Ereignisse. Dem Leser, der nur Filkins als Augen- und Ohrenzeugen hat, bleiben beispielsweise Grund und Ausmaß der Unterstützung der USA und des Westens für die Mudschaheddin im Kampf gegen die Sowjetunion verborgen. Immerhin erwähnt er, dass die Taliban-Regierung zunächst durchaus beliebt war in der Bevölkerung, da sie den Bürgerkrieg beendete und Ordnung schuf (freilich eine diktatorische).
Die verräterische Sprache
Bei der Schilderung der Warlords, die Teile Afghanistans während der Zeit des Bürgerkriegs abwechselnd beherrschten bzw. bekriegten, kann man an den Attributen ablesen, wer ihm (und somit »den« Amerikanern) genehm ist und wer nicht. Der im September 2001 ermordete Massoud sah mit seiner Wollmütze wie ein Künstler aus und wird neutral als tadschikische[r] Kommandant bezeichnet. Dostum dagegen ist ein usbekische[r] Schlächter (als er später Kontakt mit Amerikanern aufnimmt, fällt das Urteil dann milder aus; eine gelungene Reportage gelingt ihm von den inoffiziellen Kontakten der USA zu Dostum) und Hekmatyar ein islamistische[r] Fanatiker. Es gehört zu den Merkwürdigkeiten dieses Buches, wie Filkins die Saga von Mullah Omar wiedergibt ohne auf dessen spätere Funktion als Oberhaupt der Taliban-Regierung hinzuweisen (er bleibt der einäugige Omar).
Immer weiß der Reporter, wer gut und böse ist. In den Berichten aus dem Irak wird dies noch offensichtlicher. Hier zeigt sich das Elend des »embedded« Journalismus. So wird im Epilog die Schlacht um Falludscha im November 2004 beschrieben: AC/DC-Musik gegen Muezzin-Gesänge. Ein gelungenes Bild, aber Filkins belässt es dabei nicht, sondern verfällt dem Schlachtengetümmel. Da werden die Flüche amerikanischer Soldaten zitiert, die aus Dschihadisten »verkackte Turbanträger« und »Wichser« machen und ganz schnell gerät der Reporter in diesen Platoon-Sog, denen fast alle erliegen, auch diejenigen, die vorgeben »Anti-Kriegs«-Bücher oder –Filme machen zu wollen oder gemacht zu haben, weil sie vergessen, dass mit Schilderungen aus einer Perspektive genau das erzeugt wird, was man zu verhindern sucht: ein archaisches Mitgefühl, ein Mit-Fiebern; Parteilichkeit.
Filkins‘ Sprache ist entlarvend: Die amerikanischen Soldaten sind stets jung, sehen meist noch aus wie Kinder, die es in eine Horrorwelt verschlagen hat. Einer hat eine Stimme wir ein Junge vor dem Stimmbruch. Die Jungs sind dennoch hart und findig, manchmal auch entschlossen. Sie sind großgewachsen, gutaussehend und gesellig. Einer hat ein kantiges Kinn wie Johnny Cash.
Dagegen stehen die Iraker. Ein Mann hat da nicht einfach nur einen Bart, sondern es wird erwähnt, dass ihm dieser von einem Ohr bis zum anderen reicht (Filkins ist aufgrund der Ereignisse in Afghanistan und der Bartpflicht unter den Taliban sensibilisiert). Einer hat einen runde[n] Kopf, ein anderer einen dicke[n] Hals. Manche sind rundlich; meist werden ihnen eher langsame Bewegungsabläufe attestiert. Den irakischen Patrouillen hing der Bauch über dem Gürtel. Grundsätzlich scheinen sie auch dort finsterblickend. Für Physiognomien von »Einheimischen« werden ohne Ausnahme negative Formulierungen verwendet. Nie ist ein Iraker schlank oder gutaussehend, es sei denn er ist im Filkins-Tross, also Übersetzer, Fahrer (die sehen dann schon mal aus wie »Dirty Harry«) oder Hilfesuchender (denen er Stipendien oder Arbeitsmöglichkeiten in den USA verschafft, wenn es möglich ist). Ausführlich geht er auf die arabische Mentalität ein (bzw. das, was er dafür hält) aber auch hier gilt, dass diejenigen, die in seiner unmittelbaren Umgebung agieren von den sonst üblichen Dysphemismen »befreit« sind.
Pietà versus Computerspiel
Äußerst suggestiv werden Ursache und Wirkung aufgehoben und immer mehr umgekehrt: Die Invasoren werden zu Kinder[n] (Kinder wecken in uns fast instinktiv Schutzgefühle), die fast wie tragische Helden agieren und von den undankbaren, finsteren Einheimischen (die gar nicht gefragt wurden, ob sie diese Form der Demokratie haben wollten) in einen Krieg verstrickt werden. Man kann dies leicht an den den Metaphern illustrieren. So stirbt ein amerikanischer Soldat in den Armen eines Kameraden (ein Pietà-Bild), aber die Turbanträger werden in die Luft gesprengt (wie in einem Computerspiel; entsprechend schildert er auch die Einzelheiten wie austretende Gehirnmasse). Und wenn ihm, wie in Afghanistan, tatsächlich Kindersoldaten begegnen, beschreibt er diese mit seltsam anerkennendem Gestus. Er bittet sie, sich von ihm fotografieren zu lassen (also sich für ihn noch in Pose werfen) und lässt den Leser wissen, der habe dieses Bild im Regal bei sich zu Hause stehen.
Filkins‘ Verständnis für die amerikanischen Soldaten ist schier grenzenlos; seine Bewunderung gipfelt fast in Heldenverehrung. Er wird zum Sprachrohr derjenigen, die – wie er sich ausdrücken würde – ihren Arsch auch für ihn hinhalten, verliert dabei jegliche Distanz und macht sich gemein mit einer Sache. Verständlich vielleicht, wenn einem die Kugeln um die Ohren pfeifen, aber wo bleibt da die Professionalität, wenn man so etwas schreibt: Trotz der überwältigenden Hitze gingen die Marines fast täglich raus, beladen mit Ausrüstung und Waffen. Hinaus in die Nacht, hinaus in die Trümmer. Darauf aus, Menschen zu töten. Manchmal rannten sie los und warfen dabei einen Kanister, der grünen Rauch verströmte. Kein Wort, wer ihnen den Befehl für solche Aktionen gab und worin ihr Sinn besteht.
Nur einmal (in der Mitte des Buches) verlässt er den selbstgebastelten metaphorischen Schützengraben und dies kommt dann fast einem Befreiungsschlag gleich: Es hatte keinen Zweck, die Jungs zu sentimentalisieren schreibt er plötzlich von »seinen« Soldaten. [S]chließlich waren sie ausgebildete Killer. Sie konnten einen Menschen zielsicher aus 500 m Entfernung erschießen oder ihm die Kehle durchschneiden, von einem Ohr bis zum anderen (das gleiche Bild wie beim ungeliebten Bartträger). Und sie stellten nicht viele Fragen. Sie glaubten an das, was sie taten; sie taten, was ihnen gesagt wurde, und sie töteten Menschen. Manchmal frustrierten sie mich; manchmal wünschte ich, sie würden mehr Fragen stellen.
»Riesige Scheißhaufen« beim Abzug
Genau diesen Wunsch hat der Leser auch an den Autor. Bestimmte Fragen stellt Filkins nämlich gar nicht. Etwa wenn ein Marine ein Musikvideo schaut, in dem Parolen gegen Bush und den Irakkrieg skandiert werden, dann hätte man es gerne gehabt, wenn der Reporter den Soldaten nach dessen Meinung dazu befragt hätte. Die Hintergründe, die zu diesem Krieg führten, thematisiert er nie. Die Rechtmässigkeit des Einsatzes wird nicht angesprochen. Seine eigentlich gut gelungene Reportage über Ahmad Chalibi vermittelt unterschwellig den Eindruck, die Bush-Regierung sei auf diesen Mann hereingefallen, als er ihnen von Arsenalen von Chemie- oder Nuklearwaffen erzählte.
Einmal schreibt Filkins, die Marines redeten nie davon, dass man Herz und Verstand der Menschen gewinnen müsse. Aber erstens ist dies primär keine Aufgabe der Marines (sondern derer, die sie befehligen) und zweitens: Wie soll dies in Anbetracht der Ereignisse geschehen? Er beschreibt die für die Bevölkerung äußerst erniedrigende Vorgehensweise der amerikanischen Soldaten bei den nächtlichen Hausdurchsuchungen, bei der Waffen oder Aufständische aufgespürt werden sollen. Er spricht von der Strategie der eisernen Hand und unterschlägt die Wankelmütigkeit der Besatzer, die mal eisern durchgreifen und dann wieder den Dingen wochenlang ihren Lauf lassen.
Er berichtet über den Einmarsch von 6000 Marines in Falludscha. Da gab es unter anderem ein Problem mit den Toiletten: Man konnte nicht einfach irgendwo im Freien die Hose herunterlassen, auch nachts nicht, denn die Aufständischen hatten extrem gute Scharfschützen. Die Toiletten funktionierten nicht, weil es kein Wasser gab. (Warum brach eigentlich die Infrastruktur nach Einmarsch der Amerikaner zusammen?) In der Großen Moschee, einem der Orte, wo wir einen Tag blieben, benutzten die Marines den Raum für die Aufbewahrung der Koranexemplare als Toilette – nicht aus Respektlosigkeit gegenüber dem Koran, sondern weil man dort ungestört war. (Wurde die Moschee ansonsten von Gläubigen noch benutzt?) Ein paar Pappkartons dienten als Toilettenschüsseln, und wenn sie voll waren, wurden sie rausgetragen. Riesige, tropfende Pappkartons, gefüllt mit Menschenscheiße. (Wohin wurden sie verbracht?) Doch auf unserem Vormarsch benutzten wir hauptsächlich die Toiletten in den Privathäusern. Wir brachen in die Häuser ein und kackten in die Toiletten, und wenn die voll waren, machten wir auf den Boden. Bei unserem Abzug hinterließen wir riesige Scheißhaufen. Fast entschuldigend dann: Im Irak gab es tagtäglich sehr viel Schlimmeres als im Haus wildfremder (sic!) Leute Fäkalien zu hinterlassen. (Als sei es besser, im Haus von Bekannten eine kollektive Notdurft zu verrichten.) Pflichtschuldig folgt dann noch der Satz: Trotzdem (sic!) hatte ich kein gutes Gefühl dabei.
Gibt es keine Einzelanschauung wird grobschlächtig pauschalisiert: Der Irak sei ein Irrenhaus, weiß er. Oder von Anfang an ein großes Täuschungsmanöver gewesen (er meint ausdrücklich n i c h t das Täuschungsmanöver der Bush-Regierung, um den Einmarsch zu legitimieren, sondern die Angewohnheit der Aufständischen, sich zu ergeben, wenn sie ihre ausweglose Lage erkennen, aber bei nächstbester Gelegenheit wieder angreifen). Zu Beginn erscheint ihm der ganze Irak traumatisiert und voller Verschwörungstheorien, was die Amerikaner angeht (von den amerikanischen Verschwörungstheorien abermals kein Wort). Und konzediert er im Gespräch mit Chalibi, dass der Irak ein säkulare[s], fortschrittliche[s] Rechtssystem gehabt habe (er kann damit nur die Saddam-Zeit gemeint haben), so ist für ihn 2006 Bagdad in vorzivilisatorischem Zustand, beherrscht von einem Ökosystem des Schreckens. Warum dies so ist – der Leser muss die Antwort anderswo suchen, im vorliegenden Buch gibt es nicht einmal ein Bemühen darum, diesen Punkt zu klären.
Befehl und Gehorsam
Dexter Filkins ist natürlich kein Bushist. Und man ist zunächst durchaus dankbar, kein wohlfeiles Bush-Bashing serviert zu bekommen. Aber die Ausklammerung jeglicher politischer Implikationen folgt zu sehr dem Prinzip der »Neutralität« des Militärs. Ein wesentlicher Faktor von Demokratien ist das Primat der Politik, welches auch vom Militär nicht angetastet wird. Insofern ist die Armee eines Landes ausführendes Organ eines demokratisch legitimierten politischen Willens, was in diesem Fall ein Dilemma darstellt (aber auch das ist nicht das Thema).
Es ist das Prinzip von Befehl und Gehorsam, und zwar sowohl im Verhältnis zwischen Politik und Armee als auch innerhalb der Armee. Der Armee steht es demzufolge weder zu die politischen Entscheidungen (demokratischer Regierungen) zu kritisieren, geschweige denn sich diesen zu verweigern. Filkins übernimmt die Rolle dieses Mikrokosmos der Armee, die losgelöst vom Rest der Welt auf ihre Hierarchiestruktur baut und die Handlungsanweisungen umsetzt, als gegeben und unabänderlich an (vielleicht auch, weil seine eigene physische Existenz direkt davon abhängt). Damit einher geht jedoch – ob er will oder nicht – die implizite Billigung genau der politischen Entscheidung(en), die ein Soldat als Soldat nicht zu kritisieren hat. Ist die Befehlmaschinerie dem Soldaten eingedrillt worden, so ist sie beim Reporter keineswegs von Beginn an präsent. Durch den Umstand, in die Truppe »eingebettet« zu sein mutiert Filkins (mindestens zeitweise) zum Soldaten, der wie ein Soldat sieht, handelt und spricht (die moral-ethischen Verwicklungen dieser Struktur streift Filkins natürlich überhaupt nicht).
In dem Maße, wie die Annäherung zwischen Amerikanern und der einheimischen Bevölkerung sichtbar scheitert, nimmt diese unreflektierende Position noch zu. Damit wird aber auch die notwendige oder mindestens erstrebenswerte Objektivität des Reporters immer brüchiger. Auch in den Begegnungen mit den »einfachen« Menschen schwingt neben Unverständnis auch jene neokoloniale Attitüde mit, die niemals einen Zweifel über die Richtigkeit des eigenen Standpunkts aufkommen lässt. Die sprachlichen und kulturellen Barrieren werden zementiert; es entsteht ein Gruppenverhalten zwischen »uns« und »denen«, welches irgendwann schon bei der flüchtigen Betrachtung eines Irakers auf der Straße antizipiert wird. Eine objektive Berichterstattung ist kaum noch möglich und wird später auch gar nicht mehr angestrebt, da sie die eigenen Urteile befragen müsste und sich herausstellen könnte, dass sie bestenfalls nur einen Teilausschnitt eines Ganzen sind. Der eingebettete Journalist ist emotional in seiner »Gruppe« verstrickt.
Es bleibt nicht aus, dass Filkins im Laufe des Buches über seine Empfindungen, seinen Alltag und die Schwierigkeiten des Reporter-Daseins berichtet. Wir erfahren wann, wo und wieviel er joggte, was er dabei trug und wie die irakischen Posten seine Kleidung (Shorts) indirekt missbilligten (als man ihm ein irakisches Fußballnationalmannschaftstrikot schenkt ist er zwar gerührt – er weiß natürlich über die Fußballbegeisterung großer Teile der Bevölkerung – aber die knielange Nylonhose [ein Wink mit dem Zaunpfahl, den er natürlich verstand] ignoriert er). Wir lesen von der Hitze, den Problemen mit dem Satellitentelefon, der rationierten Stromversorgung, die den Betrieb des Laptop erschwert. In den besseren Momenten lesen wir von einer Art Gewöhnung an die irgendwann alltäglichen (Selbstmord-)Anschläge und Filkins‘ kruden Theorien (bei Selbstmordattentaten bildete sich immer weißer Rauch – bei Bombenanschlägen schwarzer; den entstehenden Rauch vergleicht er mit der Hiroshima-Bombe und ist vermutlich noch stolz auf diesen Vergleich). Und natürlich lesen wir ausführlich von den Gefahren, die Filkins und die Crew (Übersetzer, Fahrer, Fotografen – die Beschreibungen über »sein« Team ist stets sehr respekt-, ja liebevoll) ausgesetzt waren und auf diese subtile Art soll natürlich eine Art »Wir«-Gefühl auch beim Leser erzeugt werden.
Da kann jemand irgendwann nicht mehr aus seiner übergestreiften Haut. Nie überlegt er, ob eine Wahl nach westlichen Kriterien für den Vielvölkerstaat und dessen Proporz überhaupt sinnvoll ist. Nie überlegt er, warum die Iraker einerseits amerikanische Hilfsgelder annehmen, andererseits jedoch keinerlei »Liebe« zu den USA entwickeln (eher im Gegenteil). Dies mit einem Hinweis auf die Mentalität abzutun, ist oberflächlich und niveaulos.
Durchaus gute Seiten
Aber dieses Buch ist nicht ausschließlich schlecht. Es gibt sehr gute Berichte und Portraits. Etwa wenn er die Pressekonferenz des »Tugendministers« der Taliban beschreibt und dessen Kriterienkatalog nüchtern ausbreitet. Oder die kleine Geschichte, als er beim Joggen in Bagdad einen Jungen trifft, dieser auf Saddam Husseins Republikanischen Palast zeigt und dieser Junge dann sagt »Haus von Saddam« […] »Jetzt Haus von Bush«. Die Geschichte des Arztes in der Kinderklinik, die ohne kontinuierliche Stromversorgung ist – dessen Rede rüttelt auf. Auch die Schilderung, wie mit einem unglaublichen Material- und Soldatenaufwand ein Heckenschütze in einem verlassenen Gebäude gejagt wird (er flieht nachher mit Fahrrad) ist äußerst gelungen und zeigt in diesem Moment überdeutlich den Wahnsinn dieses Krieges. Und immer wenn Filkins in den USA Ehemalige trifft (die scheinbar alle nach Rückkehr ihren Dienst quittiert haben), gelingen atmosphärisch-dichte Schilderungen.
Und zu Recht sieht Filkins den Irak längst im Bürgerkrieg. Die beteiligten Parteien beschreibt er durchaus; fast gebetsmühlenartig erklärt er den Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten, erklärt, warum die Schiiten von Anfang an skeptisch gegenüber den Amerikanern waren (sie wurden im Golfkrieg 1991 von den Amerikanern zum Aufstand ermuntert, dann jedoch alleine gelassen), erläutert die Zersplitterungen der einzelnen Gruppen eindringlich und zeigt in einem sehr die Orientierungslosigkeit der amerikanischen Politik auf (insbesondere Paul Bremer erscheint nicht in gutem Licht). Dennoch: Als sich vieles bequemerweise auch auf al-Qaida zurückführen lässt, übernimmt er dies gerne, vielleicht weil er dem Leser zu Hause irgendwann nicht mehr alle Einzelheiten zumuten wollte.
Aber in dem er die amerikanische Seite immer wieder heroisiert bzw. als Opfer darstellt, ist seine Sicht parteiisch. Auch (oder gerade weil) er zugibt, dass der Irak seit 2004 verloren sei (was ihn prompt von sogenannten Patrioten Beschimpfungen einbrachte), erstaunt die vollkommen fehlende Empathie für die, die er so pauschal die Iraker oder, mehr Differenzierung ist aber nicht drin, die Aufständischen nennt (in einer Fußnote auf Seite 379 erläutert Filkins immerhin, wie er den Begriff des »Aufständischen« definiert und das diese Pauschalisierung unumgänglich sei – warum es überhaupt Aufständische gibt, versucht er erst gar nicht herauszufinden)
Unverständlich, warum die einzelnen Reportagen derart unstrukturiert abgedruckt werden. Zwar gibt es Aufteilungen in Kapitel, aber die thematische Anordnung überzeugt nicht. Übersichtlicher wäre es gewesen, die Texte chronologisch zu ordnen, schon um Entwicklungen besser sichtbar zu machen. So ist der Leser mal im Jahr 2003, dann 2006 und irgendwann wieder 2004.
Fazit
Es gibt sehr viele überflüssige Wiederholungen, Skandalisierungen und auch Widersprüche. Wobei niemand einen Vorwurf erhebt, wenn man die Lage im Irak 2004 anders eingeschätzt hatte als 2006. Aber wenn von Falludscha als der feindseligste[n] Stadt und wenige Seiten später von Samarra als der gefährlichsten Stadt des Irak die Rede ist, so sind diese Attribute ob ihrer Subjektivität schlichtweg überflüssig. Und einerseits wird die Brutalität im afghanischen Bürgerkrieg hervorgehoben und einige Seiten später heisst es dann, Krieg in Afghanistan war eine ernste Sache aber so ernst auch wieder nicht (darauf anspielend, dass die Kriegsparteien zu bestimmten Jahreszeiten einen stillschweigenden, partiellen Waffenstillstand einhielt). Schließlich: Was soll man eigentlich von einem Journalisten halten, der Iraker bei der Betrachtung des Fußball-WM-Spiels 2006 Portugal gegen Niederlande beobachtet und bemerkt, das Spiel würde aus einem Stadion in Luxemburg übertragen (gemeint ist übrigens Nürnberg)? Und richtig peinlich wird es, wenn sich Filkins am Ende als Hündin »Laika« in einem Sputnik im Weltall sieht.
Wer etwas über Terrorismus, deren Ursachen und Möglichkeiten der wirklichen Bekämpfung erfahren möchte lese Louise Richardson »Was Terroristen wollen«. Über die neuen Kriegsformen Ende des 20./Anfang des 21. Jahrhunderts erfährt man sehr Interessantes in Martin van Crevelds »Gesichter des Krieges«. Und wer zeitgenössische Landser-Romantik des 21. Jahrhundert bevorzugt, ist bei Dexter Filkins ziemlich gut aufgehoben.
Die kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
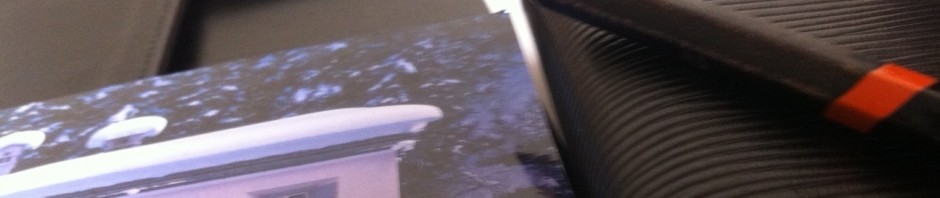
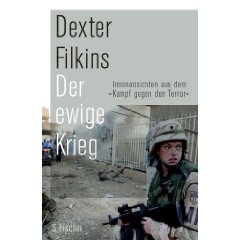


















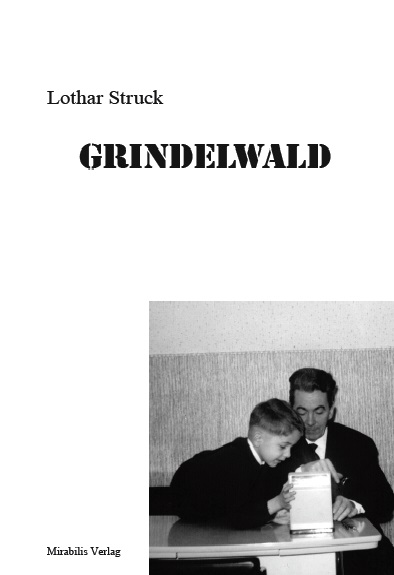
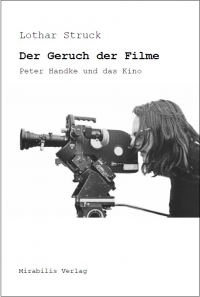
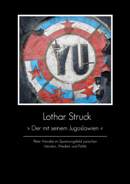

Reportage, Reise-bzw. Erlebnisbericht
Nach der Lektüre Ihrer Rezension kann es nur ein Erlebnisbericht eines traumatisierten Menschen sein, der die schlimmsten Seiten eines Krieges miterlebt hat. Kann man dann noch objektiv berichten? Ich glaube fast nicht ( um ein klein wenig Fürsprache für den Autor übrig zu haben).
Wenn ich Ihrer Beschreibung richtig folgen konnte, scheint Dexter Filkins schon vor seinem Auslandseinsatz ein ausgesprochener Nationalist zu sein, der, aus welchen Gründen auch immer, es nicht schafft, über Amerikas Grenzen hinaus, die Welt differenziert zu betrachten. Sie schreiben: „ Seine Sprache ist immer auch schon impilizit Urteil“, ist er „Richter“? „Gehört er einem „besonderen“ Menschenvolk an? Ist er Missionar?“ Zutiefst beunruhigend und unsympathisch sind mir solche Menschen. Und dann schreiben diese Personen ein Buch, das um die Welt gehen könnte, Menschen erreichen wird, die nicht über ihren Tellerrand hinausschauen wollen, können, werden und ihr Weltbild bestätigt finden.
In unserer neuen Zeit der Effekthascherei werden Erlebnisse wie diese gezielt zur Meinungsmache ( ich sage bewusst nicht Meinungsbildung) eingesetzt und es bringt auch noch viel Geld ein.
Ich bin sehr froh, dieses Buch nicht im Original gelesen zu haben, jedoch Ihren Blogeintrag habe ich ausgesprochen gerne konsumiert.
#1
Ob Filkins Nationalist ist, weiss ich nicht. Ich weiss nicht einmal, was das genau ist. In Deutschland ist in einigen Kreisen jeder Nationalist, der die deutsche Nationalhymne kennt. In den USA ist Nation anders definiert.
Missionar ist Filkins m. E. nicht. Er denkt einfach ausschliesslich in den Kategorien, die er kennt und hält diese für die besten. War Rot-Grün missionarisch tätig, als sie den Afghanistan-Einsatz beschlossen? Teilweise ja, weil sie einer Bevölkerung, die sie weder kannten noch vorher gefragt haben, unser System aufdrängten. Dies war jedoch nur ein Nebenaspekt.
#2
Über die Amerikaner
Meines Erachtens ist sogar schon der Begriff »Kampf gegen den Terror« wertend. Es liegt immer im Auge des Betrachters, wer der »böse« Terrorist ist. Ich möchte damit nicht die Taliban in Schutz nehmen, sondern ich möchte dringenst einmal sagen, dass der Westen, insbesondere die USA, sich oftmals vollkommen unberechtigt auf die gute Seite stellen.
Die ganze Show um den American Dream ist doch im Grunde eine Verunglimpfung sämtlicher Fehlschläge, die sich die Amerikaner auf dem Weg zum »mächtigsten Land der Welt« erlaubt haben – und das sind ganz und gar nicht wenige. Ich möchte hierbei einen Buch nennen, in welchem »Uncle Sam« im Hinblick auf die »Indianer-Vernichtungskriege« (sind keine Zitate, aber ich denke, diese Begriffe passen trotzdem ganz gut) etwas kritischer charakterisiert wird: »Der Westen war ihr Schicksal – Christopher S. Hagen«.
»Und sie stellten nicht viele Fragen. Sie glaubten an das, was sie taten; sie taten, was ihnen gesagt wurde,…«:
Ist das nicht mit dem fast gesamten amerikanischen Volk so? Es mag zwar ein falsches Klischee sein, dass jeder Amerikaner ein übergewichtiger, einfältiger Nationalist ist, der häufiger bei Fast-Food-Ketten einkauft als im Supermarkt, aber wenn El Presidente erzählt, die »bösen, bösen« Irakis lagern ABC-Waffen in ihren Hinterhöfen, dann glaubt das der Durchschnittsbürger. Hierbei möchte ich anmerken, dass das wahrscheinlich an der sehr pflicht- und vaterlandsgebundenen Erziehung liegt; wir Europäer entwickeln unser Weltbild etwas politikliberaler. An sich ist das keine Eigenschaft, aus der man gleich Vorwürfe spannen muss. Denn Nicht-Denken und im Rudel heulen macht stark. Noch nie war Deutschland so mächtig wie 1933-45 (Vorsicht, Ironie!).
Dass Amerika dem in gewisser Weise nahe kommt (ich kenne auch einen Künstler, der George W. Bush mit Hitler verglichen hat), bzw. kam, merkte fast niemand. Ich bin ganz und gar froh, dass Obama jetzt die Politik Bushs in Ansätzen umkehrt. Wenn gleich Obama sicherlich oftmals überschätzt worden ist.
Ich denke, da haben wir in Filkins jemanden, der sich so sehr hat manipulieren lassen – durch Soldaten (vor allem sicherlich den Offizieren, Presse und der Regierung – dass er den ganzen Krieg nur aus EINER einzigen Sichtweise betrachten kann. Ich schließe mich lou-salome an, ich bin auch froh, mich dieser Engstirnigkeit nur über einen dritten konfrontieren zu müssen.
#3
Vorsicht ist geboten
Ich warne vor Stereotypen – auch was »die Amerikaner« angeht. (Das Bush-Bashing kann ich nicht mehr hören; die Bush/Hitler-Vergleiche sind derart mutwillig dumm, dass man sie mit Missachtung belegen sollte). Die Medienmanipulationen zum Irakkrieg waren holzschnittartig – das stimmt. In verfeinerter Form hätten sie aber überall zum (kurzfristigen) »Erfolg«, d. h. zur Zustimmung in der Bevölkerung, geführt. Hierzu gibt es reichlich Beispiele, auch in der jüngeren Geschichte Europas (Jugoslawienkrieg 1999 – um nur eines zu nennen).
Ich glaube nicht, dass sich Filkins hat manipulieren lassen. Das ist zudem schwierig nachzuweisen, weil man von ihm ansonsten nichts klingt. Ich habe nur versucht herauszuarbeiten, dass, wenn einem die Kugeln um die Ohren fliegen, eine Solidarität mit denjenigen, mit denen man dies erlebt, zwangsläufig die Folge ist. Man sieht dann die Angelegenheit gezweungenermassen aus diesem Blickwinkel. Was man ihm vorwerfen kann, ist dies sozusagen unreflektiert eingebracht zu haben – daher attestiere ich ihm Landser-Romantik.
Filkins Buch ein Beispiel dafür, wie man Texte auf deren verborgene Botschaft analysieren kann, da hier die impliziten urteile sehr offensichtlich sind. Bei anderen, scheinbar neutralen Medien wäre dies interessanter festzustellen (aber auch schwieriger).
#4
Interessant
»Ich glaube nicht, dass sich Filkins hat manipulieren lassen. […] Ich habe nur versucht herauszuarbeiten, dass, wenn einem die Kugeln um die Ohren fliegen, eine Solidarität mit denjenigen, mit denen man dies erlebt, zwangsläufig die Folge ist.«:
Ist das nicht eine Art Manipulation?
Bezüglich des typischen Amerikaner-Stereotypen haben Sie mich etwas missverstanden. Ich meinte, dass Amerikaner ganz gerne mal die Fehler in ihrer Geschichte auswischen, als ob nie welche geschehen wären, weil ihnen ihr Vaterland im Durchschnitt wichtiger ist, als uns Europäern. Mag sein, dass ich aufgrund von Wertungen wieder zu sehr in Klischees abgedriftet bin.
Mich widert es jedenfalls an, wenn man vom »großen patriotischen Entdeckergeist« spricht, der den Wilden die Zivilisation gelehrt hat. Da kommt mir Washington doch sehr als administrative Primat(en)stadt vor.
Und Bushs Politik hatte auch solche Grundzüge (Wobei ich anmerken muss, dass dieser Mann wohl eher nur dem Öl hinterher war).
#5
Ist das nicht eine Art Manipulation?
Höchstens auf einer zweiten Ebene. Wenn Sie schreiben, dass sich Filkins hat manipulieren lassen, so interpretiere ich dies als eine Art willfähriges Gewährenlassen; vielleicht sogar mit Vorteilsnahme. Dies interpretiere ich als einen vorsätzlichen Akt. Filkins schreibt in seinem Sinne durchaus nicht manipulativ, sondern eben als Reporter: Ich habe grundsätzlichen keinen Zweifel, an dem was er e r l e b t hat. Er verquickt diese Erlebnisse nur mit seinen Urteilen, die sich ihm über das Ausgeliefertsein in der »eingebetteten« Armeegesellschaft erschliessen und die er nicht mehr befragt bzw. reflektiert. Er manipuliert in diesem Sinne nicht vorsätzlich, sonst wäre zum Beispiel sein Schreiben sehr viel ausgefeilter. Eine Manipulation, die man ejdoch so leicht als solche entdlarven ist, ist einfach nur töpelhaft.
Die Geschichte der USA, die (das schreibt übrigens auch Avraham Burg in seinem Buch am Rande) auf einen Völkermord grossen Ausmasses beruht, ist ein weites Feld. Sie in diesem Augenblick anzusprechen ist etwas unfair, weil sie nicht primär zur Causa des Irak etwas beiträgt. Dennoch ist der Einwand natürlich richtig.
—
Ehrlich gesagt halte ich den Allgemeinplatz Bush sei es nur um das Öl gegangen für reichlich eindimensional. Ich glaube schlichtweg nicht, dass er stimmt. Er unterschätzt den Missionierungsdrang der Neokonservativen und auch Bushs persönliche Motive im Zusammenhang mit der »Bewältigung« seines Vater-Traumas. Natürlich ist das Öl so etwas wie ein »angenehmer Nebeneffekt«. Ich glaube aber nicht, dass es der alleinige Grund war. Die Leute waren Überzeugungstäter was die Zwangsdemokratisierungsmassnahmen angeht. Man kann das unter anderem bei Francis Fukuyama, einem seit einigen Jahren zweifelnden Neokonservativen nachlesen.
#6
Über Manipulation, USA und Bush
Meinten Sie jetzt, ich habe ausdrücken wollen, Filkins versuche mit seinem Buch zu manipulieren? Das meinte ich wiederum nicht (Es kann auch sein, dass ich Sie hier missverstanden habe.).
Ich habe das Gefühl, dass Filkins jemand ist, der durch das gesamte Militärwesen der USA, seien es die Äußerungen der Regierung, das Erlebte in Irak oder Afghanistan oder Veteranenberichte, seinen klaren Blick auf dieses Thema verloren hat. Er hat nur die eine Seite der Medaille kennengelernt. Deswegen wurde sein Blick gewissermaßen quasi-manipulativ getrübt.
Ich weiß, dass ich oftmals zu hart mit der USA richte. Sicherlich bin ich dabei auch zu seh urteilend, weil ich die USA einfach als etwas Schlechtes kennengelernt habe.
Und zum Thema Bush kann ich nur sagen: Ich weiß nicht, was in dessen Kopf vorgegangen ist. Aber komischerweise interessierte er sich für diejenigen Mächte, die Öl zu bieten haben (Irak in etwa). Er hätte doch auch in Nordkorea eingefallen gekonnt (bitte korrigieren Sie mich, falls das falsch konjugiert sein sollte). Warum hat er das aber nicht, obwohl es viel nötiger gewesen wäre?
Anmerkung: Leider habe ich die damaligen Zustände in Nordkorea nicht mehr im Kopf. Vielleicht war es da auch noch gar nicht so gravierend wie heute.
Aber das mit den Zwangsdemokratisierungsmaßnahmen (ein schönes Wort, nicht wahr? Vor allem auch sehr BEschönigend.) könnte gut sein, das lehne ich nicht ab.
#7
Filkins
Wenn Sie sagen, dass er den »klaren Blick« verloren hat – dann stimme ich Ihnen zu. Aber er hat nicht seinen klaren Blick verloren – es ist schlichtweg seiner.
Bush
Der amerikanische Neokonservatismus ist eine Ideologie; deren Geschichte zu verfolgen, ist nicht ganz uninteressant. Nordkorea hat Bush nicht angegriffen, weil das Land (1.) in der Lage war, Vergeltung Richtung Südkorea zu verüben (u. U. sogar nuklear; ein grund mehr für Schwellenstaaten, sich diese Waffen zu besorgen) und damit die ganze Region destabilisiert hätte, (2.) weil der Irak einfach besser in die neokonservative Ideologie passte: Es sollte ein demokratisches, arabisches Land als Pfahl im Fleisch implementiert werden (auch gegen den Iran). Natürlich spielt dann das Öl auch eine Rolle (obwohl der Krieg mehr gekostet hat, als die amerikanische Wirtschaft von ihm profitiert hat; sieht man von der Rüstungsindustrie einmal ab). Über die persönlichen Beweggründe von Bush gibt ja sehr interessante Theorien (sein Vater hatte 1991 gezögert, gen Bagdad zu ziehen, weil er das UN-Mandat respektierte). (3.) Weil es einen Konflikt mit China bedeutet hätte, den Bushs Berater in keinem Fall riskieren wollte und (4.) weil der Irak durch ein jahreslanges Embargo militärisch am Ende war und leichtes Spiel schien.
#8