Wer kennt sie nicht, diese Zeiten der Leseunlust, einer Mischung aus Überdruß, Melancholie und Trägheit. Eine Art Mikro-Burn-Out (um im Duktus der Zeit zu reden). Wie schön ist es dann, für eine kurze Zeit in Abschweifungen und Verzettelungen zu fallen, die nicht mit dem Anschauen der Übertragung des Fußballspiels zwischen dem VfL Bochum und Energie Cottbus oder dem Verfolgen einer Doku-Soap auf RTL totgeschlagen wird. Wie reinigend diese Leere, dieser Moment, in dem plötzlich alles verblasst und das vormals Wichtige nach hinten geschoben wird. Dieses Phänomen wird in der aktuellen Diskussion um die Gefahren, die das Internet mit sich bringt (bzw. mit sich zu bringen scheint) zumeist als Ablenkung und Unkonzentriertheit beschrieben. Kulturkritische Betrachtungen brandmarken dieses »Herumsurfen« im Netz, dieses von einem Link zum anderen Link herumklicken. Dabei gibt es einen sehr schönen Ausdruck hierfür, der fest in der analogen Zeit verhaftet scheint: Man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Die Lustlosigkeit, einer Sache – warum auch immer – stringent zu folgen ist positiv ausgedrückt die Lust, sich einfach einmal wieder neu überraschen zu lassen. Hierfür brauche ich nicht unbedingt das Internet (eher im Gegenteil: zu oft landet man doch wieder auf das Altbekannte oder im Feuilleton der FAZ) oder diverse Apparate mit oder ohne angebissenes Obst. Es gibt ein Buch, in das ich mich manchmal sehr gerne fallenlasse. Ein Buch, das man zunächst beiläufig zur Hand nimmt um etwas nachzuschlagen – und sich dann in ihm lustvoll verliert. Ich rede vom Etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache, dem »Kluge«.
Und jetzt liegt die 25. Auflage des »Kluge« vor. Die Unterschiede zu meiner Paperback-Ausgabe der 23. Auflage (von 1999; unveränderter Nachdruck von 1995) sind neben der neuen Rechtschreibung vor allem die Quer- bzw. Kreuzverweise im Text mit dem leicht nach rechts kippenden Pfeil ↗. Ein Segen. Keine Ahnung, ob das weitgehende Fehlen dieses Pfeils nur eine Eigenart der »Zweitausendeins«-Billigausgabe war. Es wurde lediglich bei einer anderen Schreibweise eines Wortes ein Hinweis gesetzt. Was manchmal zu amüsanten Zirkelschlüssen führte. Wer Cervelatwurst nachschlug, wurde auf Servelatwurst verwiesen – und umgekehrt. Um den Begriff zu finden, musste man wissen, dass er unter Zervelatwurst stand.
Ansonsten halten sich die Änderungen in Grenzen. Es gibt im Vergleich zur 24. Ausgabe 49 neue Artikel – von Browser bis Reißverschluss über Bäuerchen, Cent, Dildo, Euro, Elchtest, Handy, Kugelschreiber und Missionarsstellung (»heute ein Internationalismus«). Viel Zeitgenössisches, wobei »googlen« (oder »googeln«) entbehrlich erscheint, weil »Google« als Herkunftgeber (noch) omnipräsent ist. Aber auch Engländer (ein »verstellbarer Schraubenschlüssel«), Harmschar und Mahlzeit. 90 Artikel wurden neu bearbeitet (beispielsweise Affe, Lob, Ossi, Parlament und Wismut) und es gab 34 größere Zusätze (Frau, Gründonnerstag, Virus, aber auch der Zigeuner [»semantisch ansprechend, formal problematisch«; ein Hinweis, der bei Neger fehlt]).
Wie schön dieses Buchsurfen ist (kein Cookie speichert irgendetwas!) zeigt sich beim zufälligen Entdecken von Begriffen wie stiekum, dibbern, Ganerbe und Julklapp. Man kann den Kluge auch als Partyspiel verwenden, in dem man möglichst lange (oder abstruse) Verweisketten bilden muss (zum Beispiel ziehen, ↗Zeug, ↗Zeughaus, ↗Arsenal). Falls man nicht zwischendurch bei Arschkarte (wobei man feststellt, dass der »schwarze Peter« fehlt), Farin oder Spiegelei landet und ins Lesen kommt. (Die Faszination wird nur leicht getrübt, wenn es gelegentlich heißt, die Herkunft sei »unbekannt«.)
Zugegeben, man muss im Abkürzungsverzeichnis zunächst nachschlagen, was »ne« bedeutet (»neuenglisch«). Und auch »russ.-kslav.« (russisch-kirchenslavisch) erschließt sich vielleicht nicht sofort. Aufpassen muss man, dass man nordfriesisch nicht mit nordfranzösisch verwechselt (»nordfr« gegen »nordfrz«). Aber ich lerne Sprach(variant)en kennen, die ich noch nicht einmal erahnte wie beispielsweise nassauisch, kothansakisch, tocharisch oder westoberdeutsch.
Der Kluge zeigt: Es gibt noch eine Chance für das konzentrierte Wissen in einem Buch. Und wer bei »Wer wird Millionär« bis zur Millionenfrage kommen will, muss neben den letzten beiden Jahrgängen von »Spex« und »Gala« auch den Kluge mindestens einmal gelesen haben. Noch ein Grund mehr.
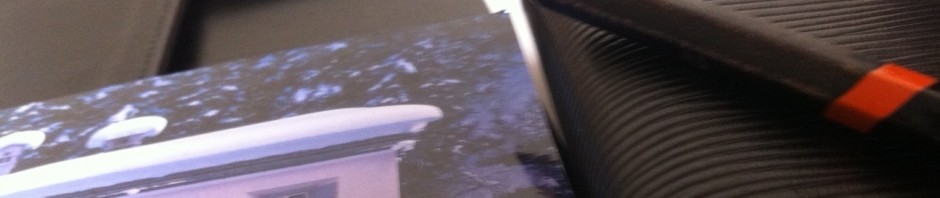



















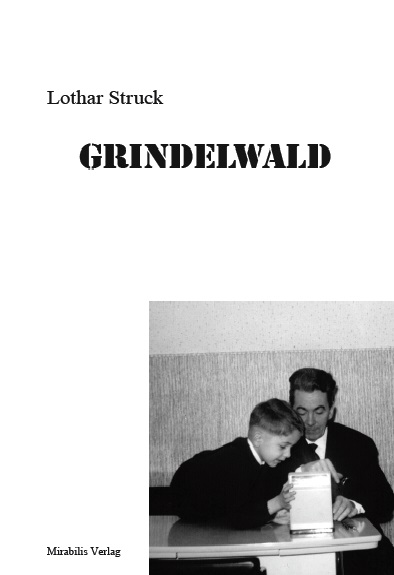
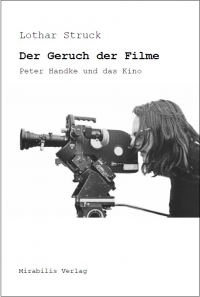
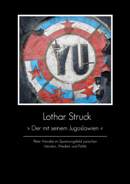

Harmschar, Ganerbe, dibbern, Julklapp – dahinter steckt doch allein die Absicht, zum Hölzchen auf’s Stöckchen zu verführen, denn ich habe keinen „Kluge“, kannte den bisher nicht einmal. Was also bleibt, wenn man solch locker hingetippte Unbekannte liest und es draußen regnet (endlich mal wieder!)? Wie schon angedeutet: vom Hölzchen auf’s Stöckchen und Wikipedia hilft da weitgehend zuverlässig. Stiekum, dies Wort kenne ich noch aus Kindertagen, habe ich seit damals nie mehr verwendet – auch nicht heimlich. Deinen Spaß am Festlesen in einem Nachschlagewerk kann ich sehr gut nachvollziehen.
#1
Ein Wikipedia-Hopping geht ja auch. Aber mit einem Buch ist das ein bisschen haptischer. (Alleine die Ungeduld beim Blättern…)
#2
Ich sag’s ganz stiekum: Jetzt musste ich auch noch »haptisch« googlen.
#3
Um es mal abgewandelt mit Loriot zu sagen: Ein Leben ohne Bücher (nein, elektronische sind hier nicht gemeint) ist möglich, aber sinnlos.
#4
Sehr schön. Ja.
#5
Ein Leben mit Büchern (auch elektronischen) ist möglich und sinnvoll.
#6
Ach was ;)
#7
Wenn man sich’s leisten kann. Dann hat man was Eigenes! ;-)
#8
Hehe … Millionenfrage bei Jauch … jetzt weiß ich, warum ich die nicht beantworten könnte. Bei »Gala« wusste ich wenigstens noch, dass das wohl eine Zeitschrift ist. Aber »Spex«? Da blieb es in meinem Oberstübchen ganz dunkel.
#9