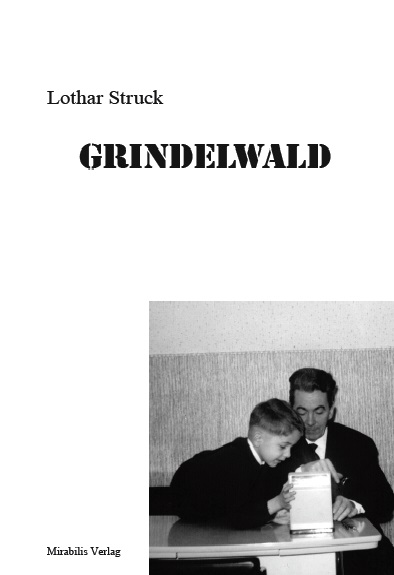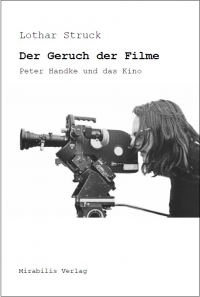»Visionen einer neuen Welt« in der Staatsgalerie Stuttgart
Ein Nachklapp
Oskar Schlemmer ist ein beliebter Maler: An einem Freitag Nachmittag sind die Ausstellungsräume der Staatsgalerie Stuttgart gut gefüllt. Das typische Publikum für einen Museumswochentag: Rentner-Gruppen, Schülerinnen und Studentinnen sowie Kinder. Während die jungen Besucherinnen und Besucher meist unangeleitet, aber mit Block und Stiften in der Hand, durch die Säle gehen, tappt die Mehrzahl der Senioren mit Kopfhörern auf den Ohren und einem vor der Brust baumelnden Audio-Guide von Bild zu Bild, Raum zu Raum. Die Betrachter geraten dabei in seltsame, mitunter komische Korrespondenzen zu den auf den Bildern rastlos hin und her, auf und ab schreitenden Gestalten: Irgendwie fremdgesteuert beide, streben die Schlemmer-Wesen gemessenen Schrittes und meist ätherisch strahlend rank und schlank zu Höherem, während sich die Irdischen in ihren von Zeit, Schwerkraft und Erfahrung individuelle geformten Leibern durch die Ausstellung schieben.
Die Beliebtheit Schlemmers beim Publikum erschließt sich sofort: Seine Bilder bieten eine aufgeräumte, geradezu cleane Ästhetik in zurückhaltender, harmonischer, freundlicher Farbigkeit. Eigentlich immer sind menschliche Gestalten zu erkennen, meist in angedeutete architektonische Zusammenhänge eingefügt, in suggestiven Posen und Konstellationen. Eine klassische Moderne, deren Irritationsvermögen fast gänzlich verschwunden ist, die uns aber noch einmal das große Versprechen auf eine bessere, effizientere, schwerelose Welt spürbar macht, das die Moderne auch einmal war.
Oskar Schlemmers Gemälde müssten eigentlich die Wände der Smart Homes von Silicon Valley-Tycoonen schmücken, finanziert vom Gewinn aus Google- und Apple-Aktien.
Dass sie das bisher nicht tun, liegt nicht an den Internet-Unternehmern, sondern an den Schlemmer-Erben. Nach dem Tot von Tut Schlemmer, der Witwe Schlemmers, verhinderten deren Erben nicht nur den Verkauf seiner Werke fast vollständig, sondern auch viele Ausstellungen sowie Publikationen. Der Ruf von Oskar Schlemmer als einer zentralen Figur der klassischen Moderne, – wie ihn auch die Stuttgarter Ausstellung feierte –, ist deswegen eher mythischer Natur. Aufgrund der Machenschaften seiner Erben und der Ängstlichkeit vieler Museen ist seine kunsthistorische Einordnung heute ungenau, mehr Behauptung als Anschauung. Aber nun, 70 Jahre nach seinem Tod, ist die Diskussion wieder eröffnet, denn nun sind die Rechte an den Bildern frei.
Stuttgart und Schlemmer
Die Staatsgalerie Stuttgart nutzte als erstes großes Museum diese Chance. Das Museum hatte 1977 eine der letzten großen monographischen Ausstellungen zu Schlemmer ausgerichtet, unterstützt von Tut Schlemmer. Sie überließ dem Museum auch große Teile von Schlemmers schriftlichem Nachlass. Im Gedächtnis der Stuttgarter hat diese Ausstellung mythische Dimensionen angenommen – unter anderem weil hier erstmals wieder Figurinen des Triadischen Balletts gezeigt wurden. Und natürlich weil Schlemmer Stuttgarts Anspruch auf kunsthistorischen Weltruhm begründet – neben der Weißenhof-Siedlung, für die sich aber deutlich weniger Stuttgarter erwärmen können als für den plakattauglichen Schlemmer. Schlemmer wurde am 4. September 1888 in Stuttgart geboren und besuchte auch hier die Kunstakademie. Dass Stuttgart nun auch die erste Ausstellung nach der langen Abwesenheit des Werkes verwirklicht hat, war man sich quasi schuldig.
Der Mensch: seriell ideal
Die ersten zu sein, darauf beschränkte sich dann leider auch das kuratorische Konzept der Ausstellung »Oskar Schlemmer – Visionen einer neuen Welt«, falls man überhaupt von einem Konzept reden kann. Man feierte Schlemmer im Titel zwar als Visionär einer neuen Welt, eine adäquate Form, den allumfassenden gestalterischen Willen Schlemmers anschaulich zu machen, fanden die Kuratorinnen aber nicht. Stattdessen zerlegte man Schlemmer inspirationslos in den Maler, den Grafiker, den Szenographen und Theatermann sowie den Wandmaler. Schon allein durch die starke räumliche Trennung distanzierte man den Maler und Grafiker deutlich von dem tänzerisch, szenographisch und architektonisch arbeitenden Schlemmer. Der Schwerpunkt lag allein durch die Fülle der präsentierten Arbeiten eindeutig auf dem Maler. Wie Maler, Szenograph und Performance-Künstler zueinander gehören und was das eine mit dem anderen zu tun hat, hat sich visuell so leider gar nicht erschlossen. Ob die Kuratorin Ina Conzen die These vertritt, das hätte tatsächlich auch nicht so viel miteinander zu tun, erschloss sich aus der Hängung aber leider auch nicht. Die Distanzierung schien eher der inszenatorischen Ideenlosigkeit des Ausstellungsteams geschuldet zu sein.
Den malerische Werdegang Schlemmers konnte man also recht genau verfolgen – und auch die Schlemmer-Ikone schlechthin fehlte nicht, die Bauhaus-Treppe aus dem Museum of Modern Art. 1932 gemalt aus Anlass der Schließung des Bauhauses in Dessau durch den von der NSDAP-dominierten Gemeinderat der Stadt, formuliert Schlemmer hier seine Interpretation dessen, was das Bauhaus war – und dass nicht nur gegen die Nazi-Spießer, sondern auch gegen die unter dem Direktor Hannes Meyer forcierte Ausrichtung des Bauhauses an der industriellen Gestaltung und der Fokussierung der technischen Ausbildung unter dem Slogan »Volksbedarf statt Luxusbedarf!«. Schlemmer selbst hatte das Bauhaus wegen Meyers Ausbildungskonzept und der studentischen Kritik an seiner eigenen »bürgerlich-formalistischen« Kunstpraxis schon 1929 verlassen und einen Ruf an die Kunsthochschule Breslau angenommen. 1920 war Schlemmer von Gropius ans damals noch in Weimar angesiedelte Bauhaus berufen worden – als Lehrer für Metallplastik und Wandmalerei. Sein Thema hatte der da bereits gefunden: die menschliche Figur als Konstruktion und als Konstruktionsprinzip des Raums, oder wie Schlemmer selbst formuliert: »Der Mensch als Maß«. Was für uns nach Humanisierung der Arbeitswelt, einer Orientierung der Gesellschaft an den individuellen Bedürfnissen und der Abkehr von Rationalisierung und Effizienzdruck, von den Vorgaben der Industrialisierung und Mechanisierung aussieht, meint tatsächlich so ziemlich genau das Gegenteil: Noch als Meisterschüler in Stuttgart beginnt Schlemmer mit der konsequenten Zerlegung des menschlichen Körpers in seine Einzelteile, standardisiert ihn und konfiguriert ihn neu. Gleichzeitig tritt er schon als triadischer Ballett-Performer auf. Maschine und Puppe / Marionette faszinieren ihn, genauso wie die Ästhetik von Konstruktionszeichnungen und Architekturmodellen – wie man an den Exponaten der Ausstellung gut sehen kann. Er kritzelt Entwürfe von Wohnmaschinen, praktisch zeitgleich mit Le Corbusier, und transformiert den Körper in einen mechanischen Komplex aus definierten Formen, die man auch anders zusammensetzen könnte. Oder Schlemmer setzt sie anders zusammen, um erstmals zu testen, wie die Glieder überhaupt zusammenhängen.
In dieser frühen Phase arbeitet Schlemmer auch noch stark plastisch: Die Ausstellung zeigt zwei abstrakte Köpfe, einmal rundplastisch in farbig gefasstem Holz, einmal linear als eine Art Drahtskulptur. Beide Arbeiten zeigen einen gewissen Art-Nouveau-Chic und spielerische Eleganz. Man ist ein bisschen enttäuscht, wenn man feststellt, dass sich die mobilwirkenden Elemente der Plastiken leider doch nicht bewegen lassen – auch dann nicht, wenn die Aufsicht mal wegschaut. Das Spielerische, Mobilé-artige, auch Humorvoll-witzige dieser Arbeiten findet sich in den späteren Gemälden kaum noch, bestimmt dafür aber die szenographisch-performative Arbeit Schlemmers.
In den Gemälden etabliert sich dagegen Anfang der 20er Jahre der für Schlemmer typische flache Bildraum mit dem gemessen herumstehenden oder schreitenden Personal. Seine Ursprünge liegen in Schlemmers Auseinandersetzung mit Cezanne und dem frühen Kubismus, für das die Ausstellung mehrere Beispiele präsentierte – darunter ein sehr großes Bild einer Stadtlandschaft (Stuttgart I, 1912), das eine erstaunliche frühe, sehr originelle Auseinandersetzung mit dem und Aneignung des kubistischen Bildraums darstellt. Zusammen mit einigen kleinformatigen Stadtlandschaften und konstruktivistischen Reliefs erzeugt es in der Betrachterin einiges Bedauern, dass Schlemmer sich dann doch auf die menschliche Figur im Raum konzentriert hat.
Déjà-vu und Stil-Brüche
Leider führte die Menge an Bildern schnell zum Déjà-vu: Nachdem Schlemmer »Figur im Raum« als sein Thema definiert hat, variiert er es im Prinzip 15 Jahre durch. Er gruppiert 3er, 5er, 7er Gruppen im Raum, der immer wie ein flacher Kasten wirkt, ein Guckkasten in eine schöne, bessere Welt, alles wohlgeordnet, gleichmäßig ausgeleuchtet, wohlproportionierte Körper, gemessene Gesten. Mit ein paar Requisiten, manchmal auch nur über die Bildtitel, deutet Schlemmer räumliche Situationen an. Treppen und Geländer sind dabei wichtige Elemente, aber auch konkretere Situationen wie Krankensäle, Schulen, Sportplätze und Bühnensituationen werden angedeutet. Im Grunde wirken fast alle Bilder bühnenhaft und theatral, aber nie dramatisch. Alles sieht irgendwie gleich aus. Selbst »Die Bauhaustreppe« büßt in der Menge an schreitenden und aufsteigenden paradigmatisch modernen Menschen ihre Ikonizität ein. Aber dann ändert sich doch was an der Wand: Da wären die Bilder aus der Phase, von der sich Schlemmer später selbst durch die Bezeichnung »barocke« distanziert, so um 1930 – also nach seinem Wechsel nach Breslau. Und die Bilder, die er nach der Entlassung als Kunstprofessor und des De-facto-Berufsverbots durch die Nazi-Kulturbürokratie malte. (Ob tatsächlich ein Berufsverbot ausgesprochen wurde, bleibt in der Ausstellung unklar. Mit Flechtheim hatte Schlemmer zumindest seinen wichtigsten Galeristen verloren, privat konnte er aber wohl noch Werke verkaufen.)
Mit »barock« benennt Schlemmer das, was in Bildern wie »Der blaue Ekstatiker« passiert, sehr präzise: Aus den flächigen, Körperlichkeit transzendierenden Menschenfiguren werden quasi rundplastische Schwellkörper, die den Bildraum komplett ausfüllen. Aus den klassizistischen Bildaufbau Schlemmers wird ein pulsierender, blasenbildender Materialklumpen aus Leibern, fast selbst ein Leib. Auch die Farbgebung ändert sich: keine vornehmen blassen Pastelltöne, sondern dunkle, tiefe Blau-, Ocker- und Rottöne, auf denen sich das Licht spiegelt. Schlemmer schafft es, dass die Oberflächen tatsächlich metallisch glänzen – als hätte man es mit Vorfahren von Jeff Koons Balloon Dogs zu tun. Nur mit viel, viel mehr gerade noch so gebändigter Energie. Nach nur wenigen Bildern bricht Schlemmer dieses Experiment ab, – anscheinend sind ihm die Bilder selbst nicht geheuer –, und kehrt zu schönen neuen Welt, geregelt von Maß und Mitte, zurück. Nur in den Athletenbildern der 30er Jahre sieht man noch Spuren dieser schwellenden Körper, diesmal aber durch Training und Disziplin gebändigt und ordentlich in den Bildrahmen eingefügt. Von der leicht bedrohlichen sinnlich-erotischen Ausstrahlung ist nichts mehr übrig, alles ist sauber und anständig.
Das Ende des neuen Menschen
Genützt hat ihm das nicht viel: Obwohl sich Schlemmer emphatisch als deutscher Künstler empfand und davon überzeugt war, deutsche Kunst zu machen, verlor er nach der Übergabe des Staatsapparates an die Nazis Amt und Würden. In zahlreichen Eingaben bis hin zu einem Brief an Goebbels suchte er der Kulturbürokratie klar zu machen, dass seine Ästhetik und Philosophie sehr wohl zur großen neuen Zeit passe und er zum Aufbau des neuen Deutschlands einen wesentlichen Beitrag leisten könne. Er scheiterte letztendlich am bigotten Kunstverständnis Hitlers, das – im Gegensatz zur Filmpolitik, wo ästhetisch avancierte Positionen möglich blieben, wenn man den Arier-Nachweis in der Tasche hatte – die Kunstpolitik bestimmte. So werden fünf Arbeiten Schlemmers in der Ausstellung »Entartete Kunst« gezeigt (1937), womit seine Karriere ruiniert ist. (Die Ausstellung wurde übrigens von denselben Leuten kuratiert, die Schlemmer wenige Jahre vorher mit der Wandgestaltung der Folkwang-Schule in Essen beauftragt hatten und mit seiner Arbeit sehr zufrieden waren. Der Zyklus selbst ist in der Stuttgarter Ausstellung zu sehen.)
Schlemmers wirtschaftliche und künstlerische Lebensumstände verschlechtern sich drastisch. Er zieht mit seiner Familie in ein abgelegenes Dorf auf der schwäbischen Alb. Die äußerst prekäre Situation verbessert sich etwas, als Schlemmer in der kriegswichtigen Lackfabrikation von Kurt Herberts in Wuppertal, zusammen mit anderen als entartet diffamierten Künstlern, als eine Art Farbgestalter und -entwickler arbeiten kann und außerdem Tarnanstriche für kriegswichtige Infrastruktur entwirft . Auch wenn ihm Ausstellungs- und Verkaufsmöglichkeiten fehlen und seine Arbeit als Szenograph definitiv beendet ist, malt Schlemmer weiter: in kleineren Formaten, oft auf billigem Ölpapier – und je länger die Katastrophe andauerte, desto stärker wandelten sich sein Stil und seine Themen.
1936, – also während der Olympischen Spiele in Berlin, in denen sich das neue deutsche Volk begeistert selbst feierte, zu dem Schlemmer zumindest als »entarteter Künstler« nicht mehr gehörte –, nimmt er sich einige seine Athleten-Bilder von 1930/31 noch einmal vor und fügt ihnen eine Schicht grau-brauner Farbe hinzu. Es entsteht ein faszinierend befremdlicher Effekt: Einerseits hat man den Eindruck, durch eine Art Nebelwand das »eigentliche« Bild doch noch erspähen zu können; andrerseits erhöhen die dunklen Flächen auch die plastische Wirkung der Athletenkörper. Sie erhaltene eine bronzene Oberfläche, als würden sie sich gerade in eine Statuen verwandeln. (In der Eingangssequenz von Riefenstahls Olympia-Film wird die umgekehrte Transformation inszeniert, antike Statuen verlebendigen sich zu den modernen arischen Modellathleten der Olympischen Spiele.) Eine Zeitlang malt Schlemmer zwar auch noch seine typischen Figur-Raum-Konstellationen, aber die Zahl der Figuren beschränkt sich auf immer intimere Gruppen, die Farben werden dunkler und trüb, die Bildräume enger. Diese Veränderungen als quasi direkte, unvermittelte Reaktion auf die bedrängten Lebensumstände Schlemmers zu interpretieren, legt sich sehr nahe und wird auch von Schlemmers Äußerungen in Briefen gestützt. Ob man diese Arbeiten Schlemmers auch als Auseinandersetzung mit den totalitären Aspekten der eigenen visionären Ästhetik einer schönen neuen Welt interpretieren kann, bleibt eine von der Ausstellung ungestellte Frage.
Irgendwann Ende der 30er Jahre beginnen Schlemmers Figuren ihr abstrakt-modernes Gepräge zu verlieren und nehmen konkretere Gestalt an: deutlich differenzierte Geschlechter, deutlich differenzierte Altersstufen, relativ klar erkennbare aktuelle Mode und Frisuren. Ein Höhepunkt dieses »Spätwerks« (Schlemmer ist da knapp 50) ist das Familien-Triptychon: ein trautes Idyll mit blondbezopften Mädchen und Mutter, um einen Tisch versammelt, jede Figur im eigenen Bildraum, in hellen, wie gekalkt wirkenden Farben. Zum Idyll gehört aber auch, dass den Dargestellten die Grenzen ihrer Welt ganz eng auf den Leib rücken. Die hellen Bewegungsräume der früheren Bilder sind verschwunden, was bleibt sind Sicherheit und Geborgenheit vertrauter Nah-Verhältnisse – und deren erstickende Enge. Hier tanzt und schreitet niemand mehr. Der Visionär hat abgedankt – und entdeckt die Stadtlandschaft als Bildthema wieder. Ob angeregt durch seine Tätigkeit als Camouflage-Designer oder weil es sich dabei um ein ästhetisch und thematisch relativ unverdächtiges Sujet handelt, bleibt eine spannende Frage. Zumindest scheinen auch hier gestaffelte, kulissenartige Bildräume eine zentrale Rolle zu spielen – wenn man von den zwei Bildern ausgeht, die in der Staatsgalerie zu sehen sind.
Völlig aus dem Rahmen von Schlemmers bisherigen ästhetischen Interessen fallen aber die Lackbilder, die er während seiner Tätigkeit (vielleicht müsste man besser sagen: als Ergebnis seiner Tätigkeit) bei Herberts in Wuppertal produzierte: komplett ungegenständlich, vollflächig das Trägermedium bedeckend, zum Teil schlierig oder in wilden Farbverläufen. Die Kuratorinnen bezeichnen die drei kleinformatigen Tafeln als prä-tachistisch und stellen sie so in einen Zusammenhang mit einer Form der Abstraktion, die Maler wie Wols und Hans Hartung im französischen Exil entwickelten. Mit den menschheitskonstruktivistischen Träumen des Bauhauses verbindet den Tachismus nichts, außer vielleicht die existenzialistisch geprägte Opposition dazu. Vergleicht man Schlemmers eindeutig als Kunstwerke autorisierte Arbeiten derselben Zeit, erscheint die Einordnung der Lackarbeiten als »Kunst« sehr gewagt: sehr klar strukturierte Stadtlandschaften, Hauswände, Dächer, Gerüste, Balkone, Schornsteine, deskriptive eingesetzte, wenn auch tonal aufeinander abgestimmte Farben – man kann kaum glauben, dass es sich um denselben Künstler handelt. Keine Spur von Experiment, Zufall oder Interesse an der Materialität von Farben. Am plausibelsten erscheint noch, die Lackarbeiten als Wiederaufnahme einer Faszination mit Oberflächen zu interpretieren, die Schlemmer in seinen frühen plastischen Arbeiten von 1920 noch zeigt. Immerhin war Schlemmer auch gelernter Furnier- und Intarsienschreiner. Aber auch hier: kein Interesse an Zufall und unwillkürlichen Abläufen. Da Schlemmer bereits 1943 starb, bleibt aber alles Spekulation.
Zu modern fürs Malen: Schlemmer als Theatermacher
»Und wo bleibt das Triadische Ballett?« fragt sich die ungeduldige Leserin wahrscheinlich schon. Dafür musste man erst mal aus der Gemäldeausstellung hinaus, die Treppe hoch und in einen anderen Gebäudeflügel wechseln. Denn wie gesagt: Der Maler Schlemmer und der Theatermann Schlemmer wurden in der Stuttgarter Ausstellung strikt getrennt gehalten. Von wegen Gesamtkunstwerk. Die gegenläufig geführten Raumfluchten der Neuen Staatsgalerie machen eine zusammenhängende Präsentation einer großen Ausstellung tatsächlich nicht ganz einfach – aber vor den Präsentationsproblemen so die Waffen zu strecken wie die Kuratorinnen in Stuttgart ist dann doch sehr enttäuschend. Zumal man auch in den Räumen, die dem Theater Schlemmers gewidmet sind, keine überzeugende Lösung für die Präsentation so unterschiedlicher Materialien wie Skizzen, Fotos, Plakate, Programme, Zeitungsausschnitte, Videos und Figurinen gefunden hatte. So konnte man auf den postkartengroß reproduzierten Fotos, die Schlemmers Praxis dokumentieren, nur dann irgendwas erkennen, wenn man sich beherzt den Besuchern in den Weg stellte, die eigentlich die direkt auf die Wände projizierten Videos mit Tanz-Rekonstruktionen sehen wollte. Pech gehabt.
Ein Höhepunkt der Ausstellung waren die Kostüm- und Bühnenentwürfe, die Schlemmer seit den frühen 20er Jahren bis in die Mitte der 30er anfertigte – also auch nach seiner Bauhaus-Zeit, wo er seit 1923 für das Theater verantwortlich war. Schlemmer war an zahlreichen Avantgarde-Inszenierungen beteiligt, von seinem eigenen Triadischen Ballett über Strawinsky-Aufführungen bis hin zu Hindemith-Opern. Seine Theaterarbeit muss schon rein zeitlich zumindest zwischen 1923 und 1932 einen enorm großen Raum in seiner Arbeit eingenommen haben. 1925, als er das Bauhaus-Theater zum Mittelpunkt seiner künstlerischen Arbeit machte, schrieb er: « Ich bin jetzt zu modern um Bilder zu malen!« In den Theaterarbeiten findet sich auch der Sinn fürs Spielerische, Komische und Slapstick-artige wieder, der in den Gemälden völlig fehlt. Klassische Körper sucht man hier vergebens, stattdessen macht es Schlemmer seinen Protagonisten so schwer wie möglich, sich »natürlich« zu bewegen. Er steckt sie, nicht nur in seinem Triadischen Ballett, in Kostüme, die aus Körpern groteske mechanische Figuren machen. Manche können sich nicht mehr geradeaus bewegen, manche sehen kaum etwas, beugen kann sich kaum einer – und bei fast allen ragt irgendein Stück des Kostüms soweit hervor, dass die Figuren auch keinen Körperkontakt aufnehmen können. Schlemmers Ballett hat weder mit klassischem Ballett – außer vielleicht im Sinn für Stereotypien und Klischees – noch mit dem damals neuen Ausdruckstanz à la Palucca und Laban zu tun. Am ehesten erinnern die Kostüme und Figurinen an Commedia dell’Arte-Figuren, an den bunten Stereotypismus von Varieté und Musicals und die wilde Welt des frühen Kinos – nur nie erotisch-sinnlich aufgeladen, sondern auf eine fröhliche Art de-anthropomorph, maschinen- oder marionettenhaft. Vom beherrschten Aufstieg des modernen Parademenschen in die geistigen Höhen einer besseren Welt ist hier fast nichts zu bemerken. Was die beiden Schlemmer verbindet, ist das Interesse am Körper als konstruktivem-funktionalem Zusammenhang – aber in seinen Theaterarbeiten scheint Schlemmer tatsächlich schon viel moderner als in der Malerei zu sein.
Auch wenn die Schlemmer-Ausstellung ein großer Besuchermagnet gewesen ist, konzeptionell und kunstwissenschaftlich war sie enttäuschend. Die intellektuelle Behäbigkeit und Genügsamkeit der Kuratorinnen verwandelt mit sicherer Hand die multimedialen, medienpraktisch wie -theoretisch spannenden Werke Schlemmers in museale Objekte ohne zeitgenössische Relevanz außerhalb der Eventisierung als Blockbuster-Ausstellung. Man verlässt sich reflektionslos auf die Tragfähigkeit des Formats »Einzelausstellung / Retrospektive« und reproduziert so schlicht dessen Tücken: Geniekult, kultur- und kunsthistorische De-Kontextualisierung, Biographismus – und natürlich die Kulinarisierung für die Verwertung im Museumstourismus. Aus der Situation, dass Schlemmer jahrzehntelang fast komplett unsichtbar gewesen ist und sich währenddessen in der Forschung zur Bauhaus-Moderne einiges geändert hat, macht man gar nix. Im Gegenteil: Offensichtlich hat man das in der Staatsgalerie noch überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ob Oskar Schlemmer jenseits von Tourismusförderung und Museums-Shop-Rennern noch für uns heute brauchbar ist – dass das die wirklich relevante Frage ist, das fällt den Ausstellungsmacherinnen der Staatsgalerie noch nicht mal im Traum ein. Warum auch, denn die Besuchszahlen geben ihnen ja recht.