Was sind eigentlich Weblogs? Welche Erwartungen sind mit ihnen verknüpft? Wird mit Weblogs wirklich die Öffentlichkeit demokratisiert? Oder sind diese hohen Erwartungen bereits Makulatur, in dem die Masse der »persönlichen Tagebücher« eher banales, peinliches oder schlichtweg belangloses aufzeigen?
Der Essay von Geert Lovink mit dem Titel Blogging, the nihilist impulse (in deutsch unter dem Titel Digitale Nihilisten bei »Lettre International«, Heft 73, erschienen; Auszüge hier) versucht, diese Fragen zu beantworten. Das Verdienst dieser Untersuchung liegt u. a. darin, dass der Autor um Objektivität bemüht ist; Kassandrarufe über die verlorene Kraft des »Web 2.0« sind ihm ebenso fremd wie die emphatische Ausrufung einer neuen basisdemokratischen Gesellschaftsordnung. Neben Zitate von Experten für digitale Medien gibt es Rekurse u. a. auf Heidegger, Canetti, Baudrillard und (natürlich) Sloterdijk.
Lovink versucht nichts weniger als die Quadratur des Kreises: Den Begriff des Weblogs aus einem Definitions- und Erkennungsgespinst zu entwirren und dann die Zukunft dieses ’neuen Mediums‘ vorherzusagen. Dabei ist es ganz klar, dass es durch die Heterogenität des Gegenstandes grobe Verallgemeinerungen gibt und das der Aufsatz gelegentlich ins Schwimmen kommt (in der englischen Sprache scheint sich der Autor besser ausdrücken zu können als im Deutschen). Insofern sollen diese gelegentlich groben Vereinfachungen nicht kritisiert und thematisiert werden; auch diese Betrachtung hier wird aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht alle Verästelungen gleichermassen berücksichtigen können.
Das Weblog als Marke – entstanden aus einem Überdruss vor der Einwegkommunikation klassischer Medien.
Caravaggio: Der Narziss
Weblogs sind – kurzgefasst – meinungsstarke, subjektive Texte eines meist unter Pseudonym schreibenden Weblog-Inhabers (des sogenannten Bloggers [der Einfachheit halber wird dieser Terminus übernommen, obwohl er ästhetisch nicht immer befriedigt]) über alle möglichen Themen (privates, politisches, soziales; Hinweise auf andere Medienprodukte nebst kurzer Bewertung, usw). Im Idealfall sind Blogger untereinander möglichst zahlreich verbunden (Syndikatsbildung), so dass die Illusion eines grosses Diskursraumes entsteht (der allerdings auch die Gefahr übertriebener Selbstreferentialität beinhaltet). Die Software, mit der Blogger arbeiten, ist frei verfügbar (in der Regel bei einem Hoster), einfach zu bedienen und fast unendlich variabel (wichtig für das individuelle und »einzigartige« Erscheinungsbild; ein Weblog ist auch immer eine »Marke«). Die Texte sind in der Regel kurz (genannt werden einmal 250 Wörter – also es wäre hier schon lange Schluss), mit prägnanten Überschriften, leicht zitierbar und mit Leidenschaft geschrieben.
Im Laufe des Aufsatzes wird der wichtigste Impetus benannt: Blogger sind der einseitigen Kommunikation von oben nach unten durch die gängigen, klassischen Medien (Zeitung, Radio, Fernsehen) überdrüssig. Sie sehen sich und ihre Meinung nicht mehr repräsentiert und verwenden hierfür das Blog, in dem sie die normale, statischen Rezeption von Information aufbrechen (präziser formuliert: umkehren).
In der deutschen Fassung des Aufsatzes wird übrigens die Bezeichnung Mainstream-Medien verwendet, was ungenau ist, da man diesen Begriff doppeldeutig verstehen kann: Sind damit die Mediengruppen gemeint, die gängig sind (also Printmedien, Radio, Fernsehen) oder diejenigen, die den Mainstream bestimmen? Die Schnittmenge zwischen beiden mag zwar sehr gross sein – es muss aber unbedingt herausgestellt werden, dass insbesondere bei den Printmedien noch zahlreiche Erzeugnisse existieren, die abseits gängigen Meinungs-Mainstreams publizistisch tätig sind. Ich verwende daher eher die Bezeichnung »klassische Medien« für die gängigen Gattungsmedien.
Zwar wird oftmals noch Referenz auf ein klassisches Medium genommen – der Blogger benutzt dies jedoch nur als Einstieg für einen eigenen Beitrag, der dann lobend, kritisch, ablehnend oder gar feindselig sein kann; manchmal auch nur hinweisend. Insofern fungiert das Weblog häufig als ein Ventil des sich zu kurz gekommen fühlenden Meinungsjunkies.
Welche Auswirkungen so etwas haben kann, erkennt man beispielsweise an Blogs, die in grosser Frequenz auf Agenturmeldungen rekurrieren, um sich mit recht einfach strukturierten Meinungsbildern derer anzunehmen. An solchen Blogs liessen sich sehr schön die Grenzen aufzeigen: Niemand kann über den Nahostkonflikt, die aktuellen Unruhen im Kongo, das Elend der Flüchtlinge in Darfur, die Gentechnik, die politische Lage in fast jedem europäischen Land, den Microsoft-Konzern, Hartz IV, alle möglichen lebenden und toten Schriftsteller und Essayisten – kurz: niemand vermag über alle Themen in gleicher Kompetenz eine sachgerechte Äusserung zu tun, die etwas anderes als eine ungefähre Meinung darstellt. Wenn dann in Kommentaren auf dem Blog beispielsweise Widersprüchlichkeiten im Meinungsbild oder ergänzende Fakten benannt werden, diese differenziertere (und oft auch unter Umständen kompetente) andere Sicht jedoch mit Löschen der jeweiligen Kommentare beantwortet wird, dann zeigt sich das, was Lovink in seinem Aufsatz thematisiert: Die Ambivalenz des Phänomens des Bloggens. In der englischen Version des Aufsatzes heisst es sehr schön The pushy tone is what makes blogs so rhetorically poor. (Der anmaßende Ton macht die rhetorische Armut der Blogs aus. – eigene Übersetzung.) Wir kommen hierauf noch zurück.
Wer braucht diese ungefragt abgegebenen Meinungen? Und – nicht unwichtig -: Wo sind diese Beiträge irgendwann? Ein Experte wird zitiert: In vierzig Jahren wird das Internet in einer gigantischen Implosion der Dummheit kollabieren. Bleibt die Frage, wieso eigentlich erst in vierzig Jahren.
Blogger sind Narzissten.
Lovinks These (grob vereinfacht): Blogger sind Medienzyniker, die sich mit der Vergeblichkeit der Objektivität in den Medien abgefunden haben und aus der »privilegierten« Blog-Perspektive (= mehr oder weniger unbeteiligte Aussenperspektive) eine Art aussermediale (Fundamental-)Opposition betreiben. Diese These ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber warum dies dann irgendwann mit Nihilismus verquirlt und unterfüttert werden soll, erschliesst sich mir ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube, dass das Phänomen eine andere Ursache hat: Blogger sind Narzissten, die ihre persönlichen Ereignisse und Bewertungen ohne besondere Nachfrage (diese ergibt sich [im Idealfall] erst später durch das Publikum) publizieren. Dabei gilt, dass jeder Text den Anspruch der Wahrheit impliziert; etliche Blogger glauben scheinbar, ihre Sicht sei ein Objektivitätsmonopol. Siehe oben: pushy…. Dann wird es problematisch – wenn das anfangs als erfrischend empfundene Quäntchen Vermessenheit ins Verbissene, Querulantische und Besserwisserische abgleitet (l’art pour l’art), welches sich der argumentativen Auseinandersetzung widersetzt.
Eine weitere Gefahr des Phänomens Weblog: Die »Sturzflut der Banalitäten« (Neil Postman) könnte dazu beitragen, dass ziemlich schnell ein Überdruss am Konsum von Weblogs entsteht. Dies gilt vor allem für die persönlichen Blogs, die sich mehr oder weniger mit den intimen Einzelheiten (beispielsweise aus Beruf-, Privat- und Sexualleben) beschäftigen, ihren Exhibitionismus genüsslich verbalisieren und – vor allem – die nicht unerheblichen »Appetitanreger«-Blogs, die als »Einstieg« für zahlreiche kommerzielle Angebote fungieren (meist ins Online-Glücksspiel oder für pornografische Inhalte). Rein praktischer Natur sind dagegen beispielsweise Sport- und Vereinsblogs, die entweder als Ersatz für ein wesentlich teureres Printerzeugnis betrieben werden oder bestimmte Fans (virtuell) verbinden sollen.
Lovinks Essay ist hier (und nicht nur hier) übrigens widersprüchlich. Einerseits finden Verfechter dieser Banalisierungsthese bei ihm Raum – andererseits rudert er wieder zurück, in dem er Verallgemeinerungen das Wort redet.
Wie ist es aber mit den ambitionierten bzw. sich ambitioniert gebenden Weblogs bestellt? Jene, die sich mit Kultur, Kunst, Politik, Naturwissenschaft, Philosophie und/oder Gesellschaftsphänomenen beschäftigen? Welcher Mehrwert liegt beispielsweise beim Leser eines Buches, die Rezension eines ihm meist vollkommen unbekannten Bloggers zu lesen bzw. diese gleichrangig zu den Rezensionen zu gewichten, die von professionellen Literaturkritikern verfasst werden? Ist es im »Wikipedia«-Zeitalter überhaupt noch relevant, welche Formalqualifikation ein Autor hat? Falls diese Beobachtung stimmt – welche »Qualifikation« gilt denn dann?
Diese Fragen sind nicht unmittelbar Gegenstand von Lovinks Betrachtung. Es ist dort vielmehr von einer Art Interdependenz der klassischen Medien mit den Weblogs die Rede. Ja, es wird gar der Blog als Konkurrenz zur oben beschriebenen Einwegkommunikation benannt (ähnlich dem euphorisch formulierten Wikipedia-Beitrag über Weblogs). Begründet wird das u. a. mit der Partizipationsmöglichkeit bei Weblogs. Im Gegensatz zur Zeitung oder dem Fernsehen ist es häufig möglich, einen Kommentar zum Beitrag unmittelbar anschliessen und somit eine Diskussion aufkommen zu lassen (und damit komplett anders als die Möglichkeit, sich in Leserbriefen auszudrücken). Diese Partizipationsmöglichkeit gilt (oder galt?) als revolutionär.
Bloggen ist die Behauptung der territorialen Diskurshoheit.
Meine Erfahrungen mit Weblogs dieser Art sind da ambivalenter. Und damit kommen wir wieder auf die These von den narzisstischen Bloggern. In Wahrheit ist die Bereitschaft, eine kontroverse Diskussion zur eigenen These einzugehen, bei vielen Blogbetreibern nur marginal ausgeprägt. Der Blogger sucht primär Zustimmung; Applaus. Er gruppiert mit Vorliebe Gleichgesinnte um sich. Man widerspricht sich maximal nuanciert. Die Abgrenzung erfolgt bereits auf der sprachlichen Ebene; jede Blog-Community hat ihre eigenen sprachlichen Codes mit entsprechenden »Korrektheiten« und »Unkorrektheiten«. Der Blogger ist Herrscher mit der ihm zur Verfügung gestellten Software; das Weblog ist sein Territorium. Die Löschtaste ist seine schärfste Waffe; sie substituiert in der grössten Not das fehlende Argument.
Spätestens dann bricht sich der narzisstischen Eskapismus, der nur noch die eigene Weltsicht gelten lässt, Bahn; ein im Zeitalter der globalen Kommunikation eigentlich tragikomisches Phänomen. Er ist ein entscheidender Grund dafür, dass Weblogs – entgegen der Behauptungen enthusiasmierter Medientheoretiker – kaum Einfluss auf die Meinungsbildung in klassischen, seriösen Medien finden.
Wer hat je ernsthaft versucht, eine Diskussion auf einem extremistischen oder rassistischen Weblog zu führen? Wenn es dort möglich ist, zu kommentieren, dann ist die Software oft genug so programmiert, dass vor Veröffentlichung des Kommentars gefiltert wird (mit dem Ergebnis, dass der Kommentar meist nicht erscheint). Die ursprüngliche Intention eines freien, partizipatorischen Mediums ist längst perdu. Die Verknüpfungen der gleichgesinnten Blogs untereinander führen unter Umständen zu Blog-Kriegen, in denen unliebsame Blogger ad hominem denunziert und sogar bedroht werden. Das ursprüngliche rebellische Element gegen eine wie auch immer empfundene Meinungsmacht anzuschreiben, produziert irgendwann selber aggressive Abgrenzungsaffekte und münden im oben beschriebenen Eskapismus. Der Darwinismus im Netz nimmt zu und wird künstlich vermehrt: Viele Blogger haben mehrere Weblogs mit unterschiedlichen Pseudonymen; das Phänomen des multiplen Bloggers.
Die Schlacht um die Diskurshoheit ist auch in der deutschsprachigen ‚Blogosphäre‘ längst entbrannt. Der einst hehre Anspruch einer gesellschaftlichen Demokratisierung durch das Netz (und Weblogs) ist durch den Pöbel längst desavouiert bzw. nivelliert worden. Bestimmte Bloghoster sind inzwischen derart von einer bestimmten antiaufklärerischen Meinungsklientel usurpiert, dass es bei den Andersdenkenden zum guten Ton gehört, dort keinen Blog zu besitzen. Aber warum sollten virtuelle Communities auch anderen Gesetzen unterworfen sein als in der »realen« Gesellschaft? Welcher Linkspartei-Anhänger hat schon einmal in einer NPD-Veranstaltung kritische Fragen gestellt? (Nebenbei: Warum sollte man seine Perlen…?)
Schleichende Trivialisierung auch in den klassischen Medien.
Wie bereits oben erwähnt, haben Weblogs keinesfalls einen (grösseren) Einfluss auf die traditionellen Medien (wenigstens was Deutschland angeht). Warum auch? Die Masse der Weblogs – das schimmert bei Lovink durch (den ich jetzt immer mehr verlasse) – sind im beschriebenen Spektrum eindimensional, sprachlich kümmerlich, banal oder einfach nur narzisstische Meinungsprosa ohne Relevanz und Informationswert. Nach der Lektüre einiger Blogs könnte man Franz-Josef Wagner glatt für den Pulitzer-Preis vorschlagen und hält den Stammtisch eines beliebigen oberbayerischen Bierlokals schnell für das philosophische Quartett. In Wirklichkeit ist »Volkes Stimme« also weniger Verheissung als Drohung; eigentlich eine Binsenweisheit, die man auch ohne Blogs schon mindestens ahnte. Und auch die enthusiastischsten Verfechter herrschaftsfreier Diskurse kämen da gelegentlich ins Grübeln – würden sie doch nur auch einmal den Müll aus ihrem (porösen) Elfenbeinturm runterbringen.
Das klingt jetzt schlimmer, als es gemeint ist. Es gibt sehr viele nicht nur witzige, unterhaltsame, sondern anspruchs- und niveauvolle deutschsprachige Weblogs. Und so ist auch bei mir jetzt ein Phänomen aufgetreten, welches beim Bloggen oft die Hand des Schreibers führt: Der Versuch, mit hysterisierender Übertreibungsrhetorik und/oder Effekthascherei verzweifelt Publikum an sich zu binden (was bei entsprechender Schreibtechnik auch gelingt); oft gepaart mit den Mitteln der Polarisierung oder gar Provokation. Hierdurch wollen sie sich (gelegentlich allzu krampfhaft) von den traditionellen Medienmachern unterscheiden. Diese sägen längst selber am Ast, auf dem sie lange so behaglich Platz genommen haben und greifen selber immer häufiger zu alarmistischer Sprache und hysterisch anmutenden Drohszenarien – man muss als Blogger eben nur noch »einen draufsetzen« können, um im kakophonen Medienkaraoke doch noch irgendwie wahrgenommen zu werden. Was zählt, ist die Aufmerksamkeit; so rasch sie sich auch verflüchtigt. Da wirkt ein eher differenzierter, um Ausgewogenheit bemühter Diskursstil, oft genug zu langweilig.
Aber auch die sich so in den Vordergrund stellenden, sich seriös gebenden Journalisten (oder auch beispielsweise Literaturkritiker – um das Beispiel von oben wieder aufzunehmen) unterscheiden sich immer weniger von dilettierenden Bloggern, die sich in einigen Bereichen ja durchaus ein Spezialwissen angeeignet haben, welches der zum Generalistentum verdammte Journalist im Einzelfall gar nicht zur Verfügung hat bzw. haben kann (niemand ist Experte von allem). Also kein Grund zur Abgehobenheit oder Arroganz.
Was der kritische Beobachter leider mehr als oft bemerken muss: Der sich der Recherche verpflichtende und investigative Journalist mit unbestechlichem Blick und vorurteilsfreiem Arbeiten ist inzwischen weitenteils nur noch eine hübsch konservierte Mumie, die in den Chefredaktionen zu bestimmten Festangelegenheiten immer wieder gerne hervorgeholt wird – man ist erinnert an Bates‘ Mutter in »Psycho«. Die Medienmacher sind bedauerlicherweise fast vollständig ihrem selbstverfassten Diktum erlegen, nur die schnelle Nachricht sei eine gute Nachricht. Statt der schleichenden Vereinfachungstendenzen durch Qualität entgegenzutreten, passen sie sich mal mehr, mal weniger zähneknirschend dem gnadenlos vereinfachenden Hype der gängigen Trivialorgane an. Man fühlt sich in Westernfilme hineinversetzt, in denen zunächst geschossen und erst danach die Delinquenz überprüft wurde.
Haben mir nicht beispielsweise israelische, libanesische oder iranische Blogs mehr mitzuteilen, wie jene Korrespondenten von Radio und Fernsehen, die ihre Informationen unter Umständen durch viele Filter erhalten? Liegt hier nicht überhaupt noch eine Existenzberechtigung von so etwas wie Weblogs? Sie bringen uns das Fremde, Unbekannte nahe, auf das wir so niemals stossen würden. Aber auch hier muss die Frage nach der Authentizität und Wahrhaftigkeit gestellt werden. Nicht wenige dieser Weblogs haben sich in nachhinein als geschickt getarnte Propagandainstrumente herausgestellt. Aber: Auch Journalisten sind oft unfreiwillig in die entsprechenden Fallen getappt. (In den USA ist das »unfreiwillig« seit der »Embedded«-Kampagne bei einigen Medien inzwischen zu streichen.)
Aber längst sind Weblogs auch dem veloziferischen Nachrichtenhype ausgeliefert. Über Webseiten wie Technorati beispielsweise werden die rhizomatischen Verlinkungen von Blogs gelistet (und zum Bewertungsmassstab erhoben) und wer dort ein neues Thema entsprechend prominent (also zeitlich schnell) vertritt, wird von den nachfolgenden Bloggern entsprechend oft verlinkt, was wiederum mehr Aufmerksamkeit bringt, usw. Blogger beziehen nämlich sowohl aus den klassischen Medien als auch von Blogs selber ihre Informationen. Auch hier ist der recherchierende Bearbeiter der Nachricht, des Themas, eher selten. Dies natürlich auch deswegen, weil Bloggen normalerweise ein Freizeitphänomen ist. Hier kommt man dann zu den Definitionen vom Anfang wieder zurück.
Bloggen in Deutschland.
Noch einmal kurz zurück zu Geert Lovink: Es ist zu vermuten, dass er weitgehend die Bloggerszene in den USA beschreibt. In Deutschland ist dies alles noch ein bisschen beschaulicher: Hoster, die Blogs vom Netz nehmen, weil man dort drei Monate keinen Beitrag gepostet hat, kenne ich nicht. Andererseits spricht der Aufsatz ein wichtiges Thema an: Die Vergänglichkeit all dieses Schrifttums. Es ist nämlich tatsächlich so, dass das Gedächtnis des Internet durchaus begrenzt ist; Google Cache wird Texte nicht ewig behalten.
Hierin könnte ein mentalitätsbedingter Grund liegen, dass sich das Bloggen in Deutschland verhältnismässig schwer tut: Warum soll ich viel Arbeit in Beiträge oder Kommentare stecken, wenn der Blog vielleicht schon bald offline ist? Dies gilt insbesondere für (dezidierte und sorgfältige) Kommentare – hier begebe ich mich in die Abhängigkeit des jeweiligen Blogbesitzers, der diesen entfernen kann oder einfach nächste Woche seinen gesamten Blog löscht.
Ein anderer Grund, der bei Lovink gar keine Rolle zu spielen scheint, liegt in der zunehmenden Praxis in Deutschland, Blogger aufgrund von Nichtigkeiten abzumahnen, die als »Verstösse gegen das Markenrecht« oder »Angriff auf die Persönlichkeitsrechte« aufgeblasen werden und damit unliebsame Stimmen zum Schweigen zu bringen. Es geht wohlgemerkt nicht um Beleidigungen, die merkwürdigerweise oft genug ungeahndet bleiben – es geht um die in Mode gekommenen Abmahnwellen bestimmter rückgratloser Winkeladvokaten. Gelegentlich geht (glücklicherweise) der Schuss nach hinten los. Aber wenn ein Blogger einmal eine Rechnung über mehrere hundert Euro erhält oder plötzlich eine Unterlassungserklärung mit mehreren –zigtausend Euro Wert vorliegen hat – dann vergeht ganz schnell die Leidenschaft; Einschüchterung als Prinzip.
Bestürzend ist in diesem Zusammenhang, dass die »Kollegen« aus den traditionellen Medien hier meistens unbeteiligt zusehen; ja gelegentlich sogar mitmachen (man denke an die prozessuale Auseinandersetzung der »FAZ« mit »Perlentaucher«; eigentlich kein Weblog, aber der Prozessgegenstand betrifft Blogger durchaus).
Private, ambitionierte Weblogs sind – unabhängig von ihrer aktuellen Bedeutung – nichtsdestotrotz für die klassischen Medien ein Dorn im Auge; sie stellen mindestens theoretisch langfristig eine potentielle Gefahr dar. Dass viele jetzt in ihrem virtuellen Angebot Blogs servieren, widerspricht dem nicht. Journalisten, die auf der Webseite ihrer Zeitung bloggen, sollen die entsprechende Blogger-Klientel an die traditionellen Medien binden. Vereinnahmung durch Umarmung. Dabei ist der wesentliche Unterschied zwischen Journalist und Blogger eigentlich nicht aufzuheben: Ein Blogger hat eben nicht die Möglichkeit, wie ein Journalist in einem Medium zu berichten – das ist ja gerade der Grund für seinen Weblog. Hieraus kann sich – im Idealfall – eine Unabhängigkeit in der Bewertung eines Sachverhaltes zeigen, die dem Journalisten, der unter Umständen an bestimmte Vorgaben der Redaktion gebunden ist oder ökonomische Rücksichten auf Werbekunden zu nehmen hat, so nicht immer möglich ist. »Blogjournalist« ist in diesem Sinne ein Oxymoron, wenn er den Redaktionsjournalisten meint, der sich virtuell zusätzlich auf der Webseite seiner eigenen Redaktion äussert.
Der Trend ist schon vorbei, bevor er angefangen hat?
Die Spekulation über die Zukunft von Weblogs – gerade auch im deutschsprachigen Raum – ist müssig. Sicherlich werden in den nächsten Jahren einige Blogger übrigbleiben, während die grosse Masse verschwinden wird. Die durchschnittliche Zeit, die ein Weblog heute online ist, liegt bei sechs Monaten. Schnell sind andere Freizeitangebote attraktiver. Wer bleibt, hat es entweder »geschafft« (und gilt als arriviert) oder hat eine kleine, ihm aber genügende Schar Gleichgesinnter um sich.
‚Arrivierter Blogger‘ ist allerdings das zweite Oxymoron in diesem Aufsatz: Ähnlich einer »ausserparlamentarischen Opposition«, die dann im Parlament und Jahre später auf den Regierungsbänken Platz nimmt, läuft der Blogger, der sich neben den grossen, klassischen Medien behaupten kann, Gefahr, irgendwann in einer »sanften Umarmung« grosse Teile seines unabhängigen Geistes durch Einbindung in vorher nicht gekannte Zwänge opfern zu müssen. Das beginnt noch harmlos bei dem täglichen Abruf der Besucherquote und endet unter Umständen in Phänomenen wie Schreibblockaden. Weblogs als Sprungbrett für eine wie immer geartete journalistische Karriere dürfte bei vielen Bloggern ein Grund (gewesen) sein, damit zu beginnen. Und in der Ernüchterung, dass niemand an die Türe klopft, wird die Wohnung schnell wieder geräumt.
Rettungsversuch. Warum nicht Kräfte in einem Forum bündeln?
Die Vereinzelung der Blogger ist einerseits gewollt (Narzissmus), andererseits verlinken sich Gleichgesinnte, um im Blogroll (der Liste, der von ihnen »abonnierten Weblogs«) eine Art Dokumentation über ihre Gesinnungsfreunde aufzuzeigen. Der argumentative Austausch ist bei vielen nicht unbedingt erwünscht – das hatten wir bereits. Dennoch gibt es Weblogs, auf denen nicht nur der Alleinherrscher dominiert und seine Claqueure um sich versammelt, sondern die einen Pluralismus pflegen.
Statt nun durch das »Trackbacken« (die Verlinkung eines Beitrages auf den eigenen Weblog) eine interessante und anspruchsvolle Diskussion in einem kontroversen Bereich zu zersplittern (»Ich habe hier [es folgt der Link zum eigenen Weblog] was dazu gesagt und nehme auch noch auf diesen Kommentar [Link eines dritten Weblogs] Stellung…«) und für den unbeteiligten aber interessierten Leser transparent und fruchtbar zu machen, könnte man die Kräfte der einzelnen Blogs auf einem Forum zusammenfügen. Dieses Forum sollte einen gewissen Anspruch formulieren, interdisziplinär sein und – vor allem! – moderiert werden. (Hier scheiden sich allerdings bereits zum ersten Mal die Geister: die Verfechter des selbstorganisierten, gruppendynamischen und antiautoritären Stils sehen das ganz anders und wittern in jeder Moderation einen Akt des Zensurteufels.) Es sollte alle Vorteile eines Weblogs haben und seinen Mehrwert durch die Bündelung der pluralistischen Diskurse generieren.
Die Versuche im deutschsprachigen Raum, so etwas auf die Beine zu stellen, sind nicht allzu zahlreich. Aber es gibt sie. Neben Giga ist da vor allem natürlich Nensch zu nennen. Vor neun Monaten beschäftigte ich mich bereits hier mit der Zukunft dieses Onlineforums. In der Zwischenzeit hat sich nichts getan; seit kurzer Zeit wird nun wieder einmal ein Relaunch in Aussicht gestellt.
Die Gründe für das derzeit rachitische Erscheinungsbild von Nensch sind vielfältig und würden den Gegenstand dieses Aufsatzes sprengen. Sie sind vielschichtiger Natur und nicht zuletzt in persönlichen Eitelkeiten der »Community« zu suchen. Die entscheidende und viel interessantere Frage ist, warum es Nensch nie gelang – auch in den Spitzenzeiten – eine konstant grosse Zahl von Benutzern anzusprechen und zur Teilnahme zu motivieren, während parallel dazu das eher an jugendliche orientierte Forum Giga auf mehrere -zigtausend User kam.
Es gibt rd. 100 Millionen deutsche Muttersprachler. Zu den angesprochenen Spitzenzeiten versammelten sich bei Nensch rd. 50 User pro Woche, die regelmässig mit Beiträgen und/oder Kommentaren aktiv teilnahmen. Mehr als 1600 Menschen sind bei Nensch derzeit (rd. vier Jahre nach der Gründung) nicht angemeldet. Die Frage ist: Warum hat ein niveau- und anspruchsvolles Forum kein Wachstum schaffen können? Wird der Markt überschätzt?
Andererseits: Das m. E. derzeit aktivste und interessanteste Forum ist das der Tagesschau. Hier werden zwar die Themen vorgegeben, aber jeder User kann innerhalb des Themas selbst wieder Unterthemen formulieren (was gelegentlich zu unnötigen Zersplitterungen führt). Derzeit sind dort rd. 16.000 User angemeldet; die Zahl der regelmässigen Kommentierer erscheint jedoch auch übersichtlich. Das Forum wird ziemlich streng moderiert; die zur Verfügung gestellten Tools sind eingeschränkt (beispielsweise keine Bilder).
Die Entwicklung des Weblogs steckte im Jahr 2003, also bei Gründung von Nensch, noch in den Kinderschuhen. Hätte ein solches Forum heute mit anderer Software und aggressiver Werbung trotzdem eine Chance? Anders gefragt: Würden die Blogger ihre sicheren und komfortablen Herrschersessel ihrer Weblogs zu Gunsten der harten Bänke eines Forums aufgeben, nur um einen (nicht in jedem Fall sicheren) Mehrwert in einer nicht zersplitterten Diskussion willen? Wäre eine solche Fusion von »Qualitätsblogs« überhaupt wünschenswert? Oder wäre sie gar notwendig, um durch diese Bündelung eine Diskurshoheit zu generieren, die eben nicht nur eine kritische Masse erreicht, sondern eine grössere Verbreitung hätte? Wie schafft man es, ein möglichst breit gefächertes Meinungsspektrum anzusprechen, ohne aber sofort den Pöbel dominierend zu haben? Wer organisiert die sozialen Differenzen, die sicherlich schnell entstehen dürften? Oder sind die gängigen Vernetzungsmöglichkeiten über die Weblogs ausreichend, um den klassischen Medien damit (einmal) paroli bieten zu können?
Oder ist das Eintauchen in die virtuelle Welt der Blogosphäre oder der Foren nur ein emphemeres Verlangen? Die Beantwortung dieser Frage dürfte sich ein Stück weit von den Möglichkeiten her klären, die dem Benutzer geboten werden und die er zulässt. Auf Dauer dürfte selbst dem eitelsten Narzissten der Applaus der Claqueure zu langweilig werden. Dürfte? Müsste!
Dank für den Link zu Lovinks Essay an Michael Roloff
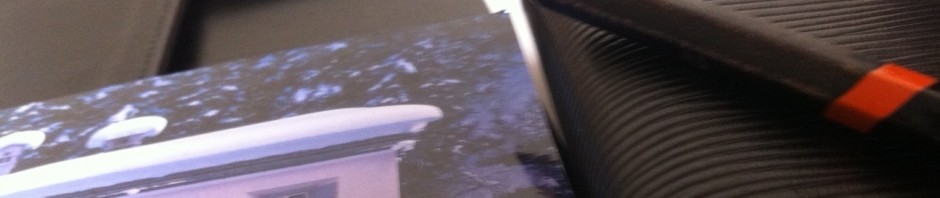



















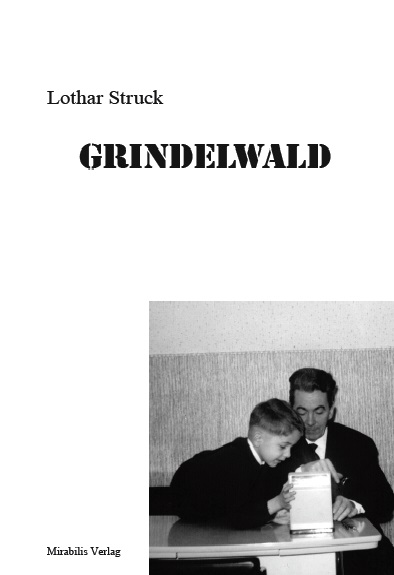
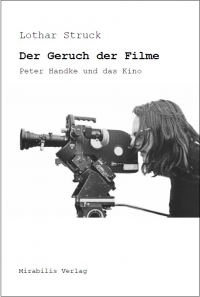
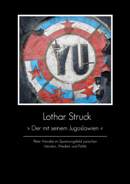

Sie machen es einem nicht leicht, ist ja wohl auch nicht Ihre Absicht, zu so einem allumfassenden Aufsatz einen Kommentar zu schreiben. Ihre Beobachtungen und Anmerkungen zur Blogphäre insgesamt, kann ich weitgehend nachvollziehen, aber es fällt mir schwer, mit gleicher Ernsthaftigkeit über die Zukunft dieses momentan so modischen Mediums nachzusinnen.
Irgendwann habe ich mal kurz beschrieben warum ich blogge und das ist für mich auch das einzige Kriterium: Ich schreibe halt gerne kleine Geschichten und hoffe, dass sie auch für andere, vor allem für unsere Verwandten, Freunde und Bekannten , denn die stellen den Hauptteil der Leser, interessant sind. Wenn sich noch jemand dafür interessiert, ist’s mir natürlich recht. Beiträge mit oftmals holzschnittartiger Meinungsäußerung verfasse ich mit der Illusion, die Veröffentlichung im Netz würde meine Sicht der Dinge weltweit hinausposaunen und auch provozieren, was natürlich eine völlig naive Selbsttäuschung ist, die mir aber gefällt.
Wenn ich jemanden zielgerichtet erreichen will, schicke ihm den Beitrag per mail. Da bekommt man manchmal lustige Reaktionen.
Ziemlich egal ist mir, was auf manchen Primitivseiten abgesondert wird und wenn sich bestimmten Gruppen in ihrem Dünnpfiff suhlen – von mir aus, sollen sie doch. Es ist genauso irrelevant wie meine Ergüsse.
Irgendwann, da stimme ich mit Ihnen wiedereinmal überein, wird sich auch das Bloggen überlebt haben, wo doch sowieso schon alles gesagt ist, nur noch nicht von jedem ( Carl Valentin).
Nicht überleben wird sich, bei Ihnen wie bei mir, die Lust daran, Dinge aufzuschreiben und um das einer kleinen, aber interessierten Leserschaft zuzuführen, werden wir immer einen Weg finden, auch ohne Blog.
Ein Letztes noch: Sie fragen rhetorisch, welchen Mehrwert es dem Leser eines Buches bringe, eine Rezension eines ihm völlig unbekannten Bloggers zu lesen …Nun, Ihre Rezensionen lese ich mit Genuss, die mancher professioneller Rezensenten oftmals nur gelangweilt. Auch wenn sich das jetzt sehr nach Claque anhört, ich hoffe, es freut Sie dennoch.
#1
Den Spruch von Valentin…
kannte ich noch nicht – er trifft aber den Nagel auf den Kopf. Ich hab in der Zitatendanbank auf der offiziellen Homepage noch ein anderes, markantes Zitat gefunden: Ich bin auf Sie angewiesen, aber Sie nicht auf mich! Merken Sie sich das!
Sehr interessant finde ich Ihre Feststellung: »Nicht überleben wird sich, bei Ihnen wie bei mir, die Lust daran, Dinge aufzuschreiben und um das einer kleinen, aber interessierten Leserschaft zuzuführen, werden wir immer einen Weg finden, auch ohne Blog.« Sie haben zwar dahingehend recht, dass ich immer schon Texte verfasst habe, allerdings selten bis nie daran dachte, diese zu publizieren. Das war erst durch das Internet möglich; als Dilettant hat man in professionellen Redaktionen keine Chance.
Der Grund für mein Schreiben lag / liegt jedoch nicht im Wunsch der Weiterverbreitung. Ich habe festgestellt, dass ich mir das Gelesene besser merken, es auch besser im Kontext mit anderen Texten rubrizieren kann, wenn ich hierüber schreibe. Es ist also letztlich eine Art, mir die Bücher besser einzuprägen (Notizen verfassen reicht bei mir übrigens nicht). Die Veröffentlichung ist sekundär; sie diszipliniert allerdings (was ich merke, wenn ich alte Besprechungen hervorhole und sie – selten – für diesen Blog »aufbereite«).
Was die Blogosphäre angeht, haben Sie natürlich auch Recht: Was interessieren mich die Auswüchse, der »Dünnpfiff«? Naja, irgendwie interessiert es mich fast zwangsläufig. Sie kommen nicht umhin, dass grobe Verallgemeinerungen in der Öffentlichkeit (»die Blogger«; »die Journalisten«) immer von dem Bild geprägt werden, was vorherrscht. Und wenn es inzwischen Weblogs gibt, die eindeutig rassistisches Gedankengut äussern, so ist das schon wichtig. Es wäre für mich beispielsweise unmöglich, bei einem Hoster einen Weblog zu haben, der gegen diese Weblogs nichts unternimmt.
Das Lob für die Rezensionen nehme ich gerne auf und danke dafür.
[EDIT: 2007-03-14 08:12]
#2
Ephemeres Verlangen & der relevant-set
Hallo Gregor Keuschnig,
ich hatte meine Notizen noch mal kurz überarbeiten wollen – sie waren mir viel zu lang geraten, zumindest für einen Kommentar zu lang -, und auf einmal merkte ich, dass dem Lovink’schen Ansatz von den Narzissten / Nihilisten vielleicht doch mehr abzugewinnen ist. Fazit: Mein Material wäre im Moment einfach zu umfangreich, und ich würde es selber gerne noch einmal strukturieren.
(Da ich sonst eher vom literarischen Schreiben komme, lege ich Wert eher auf einzelne versuchsweise Gedankenführung, nicht so sehr auf Strenge oder gar Systematiken; das Verwürfelte an Gedanken kann so oft anderswie zu Treffern führen. Ich merke aber außerdem, dass ich – mit teils anderen Akzentuierungen – teilweise zu ähnlichen Schlussfolgerungen, wie Sie komme, so dass ich es nicht nur spiegeln möchte.)
Um es einmal – kurz – von hinten anzugehen: ephemeres Verlangen. Ich vermute, damit treffen Sie etwas. Warum wollten / sollten sich selbstbewusste Beiträger im Spannungsfeld zwischen Konsensdruck und „anything goes – laissez faire“ (oder eben alle anderen, die es nicht einmal ernst meinen) einer Forumsdisziplin unterwerfen? Ist nicht gerade das Dasein als „Elementarteilchen“ der neue Horizont, wie sonst auch (gesellschaftliche Atomisierung, Bindungslosigkeit, Mobilität)? Ja, Applaus ist sicher langweilig. („Wer applaudiert, erklärt sich einverstanden… wie kann er gemeint sein?“) Ich denke, nur eine Minderheit sucht den tatsächlichen Austausch dezidierter Haltungen als einen Weg zum Weiterkommen, sei es im Streit. Spielregeln bedeuteten ja wieder Verbindlichkeit.
Kann es aber sein, dass da – neben Trägheit, Desinteresse usw. – auch ein Moment an Vergeblichkeit mitspielt? Man müsste seine Motive, d.h. letztlich seine Illusionen offenlegen. Ich selber sehe mich nicht als Pessimist, aber bezweifle nach meinen Erfahrungen vieles, ob es der Anstrengung (noch / noch einmal) wert wäre.
Ich sehe nur: Für mich ist das Bloggen etwas anderes, als für die meisten anderen. Das kann ich auch „ephemeres Verlangen“ nennen. Meine ernsthaften Anstrengungen gehen ganz anderswohin, bzw., ich entnehme dann dem nebei geführten „Versuchsraum Blog“ dann nachträglich für mich, was ich dort spielerisch gewinnen kann. Mir reicht das.
Mit dem „streng moderierten Forum“ haben Sie sicher recht. (So etwas gibt es aber doch in den USA, professionalisiert dann um Redaktionen… sowie um nur etwas anders definierte Regeln dann wieder im üblichen Medien-Raum.) Aber darin sehe ich nur EINE Möglichkeit von besseren Blogs. Relevanzen, auf die Minderheiten hoffen, kann auch anderswie entstehen. Die, auf die ich setzen würde (mit X Ressourcen für Informationen, mit denen ich mich gut bedient fühle) von mir aus auch im Narzissmus Einzelner für Einzelne. Ehrlich gesagt hätte ich für erschöpfende Beschäftigung damit gar keine Zeit.
Das Gefüjl der Vergeblichkeit aber rührt ja eben auch um die Schwierigkeit der Erklärbarkeit der Welt. (Etwa der von Ihnen aufgezählten Phänomene. Und jetzt kommt auch noch der vielleicht nicht einmal mehr aufzuhaltende Klimawandel. Immer öfter meine ich, die Leute schauten zwar mit weit offenen Augen, ja, auch staunend fast, was da passiert… aber dann widmen sie sich doch ihrem Eis inmitten des „schönen Wetters“. Die Antiquiertheit des Menschen. Baudrillard’sche Fatalität: Es ist nicht zu ändern.)
Was wäre denn IHR persönliches Verlangen? Wäre es nicht als eben Ihres ebenso „ephemer“? Erhoffen Sie für sich eine Bedeutung in diesem riesigen Chor der disparaten Stimmen? Was wollen Sie der Welt denn sagen? Was wäre Ihre Ambition? (Ich meine das nicht polemisch.)
Wenn Sie sich den Printmarkt ansehen – wer heute noch qualitative Analyse sucht, der liest dort -, so ist der ebenso atomisiert… kannibalisiert kann man schon sagen. Alles gibt es längst für alle Zielgruppen in x-fachen Variationen. Und was reüssiert? People-Quatsch wie „Vanity Fair“. Oder siehe überhaupt die Eventisierung des Journalismus auch in der marginalen Meldung, in der zunehmenden Verquickung mit PR und Sponsorentum. Da lobe ich mir meine – ja nur weltabgewandt scheinenden – Feuilletons. Womöglich sind Relevanzen längst nur mehr dort, wo bis zum Überdruss angediente Mehrheiten es gar nicht mehr hinschaffen?
Wohl gemerkt: Ich sehe mich dennoch nicht als Zyniker – und schon gar nicht als Nihilist (obwohl es im Lovink’schen Sinne nicht ganz von der Hand zu weisen wäre). Der Narzissmus erklärt es aber auch (hätte ich keinen einzigen Leser, machte ich trotzdem weiter). Ich denke, mit der Formel vom „ephemeren Verlangen“ liegen Sie insgesamt nicht so falsch.
P.S.
(Sie haben, glaube ich, einen pay-account bei twoday, oder? Wenn Sie das hier als Task weiterführen, werde ich demnächst punktuell immer mal wieder drauf eingehen, und vielleicht kommt man im Einzelnen der Aspekte etwas weiter?
[Ich hatte es mir in Stichworte zerlegt: Form, Hype, Marketing, Wahrheit, Sendungsbewusstsein, Diversität… etc. ]
Dieser Wunsch, etwas systematisch zu fassen, führt oft zum Wegfall von Disparatem, aber erklärt dessen Prominenz doch nicht.)
#3
Vielen Dank für diesen Kommentar. Wir hatten ja ansatzweise schon hier die Diskussion begonnen. Ich möchte auf einige Punkte kurz eingehen (eher ungeordnete Gedanken).
Forum und Forumsdisziplin
Meine Erfahrungen mit Foren sind ambivalenter Natur – wie mit Weblogs auch. Ein sich selbst organisierendes Forum, in dem jeder das macht, was er will, und nur durch einen amorphen Gruppendruck »diszipliniert« wird, funktioniert nicht. Es bedarf »Spielregeln«, um überhaupt in so etwas wie Diskussion eintreten zu können. Andernfalls artet es ziemlich schnell in wüste Beschimpfungen aus. Das ist auch der Grund, warum ich nicht (mehr) auf Blogs kommentiere, die signalisieren, dass sie keine abweichende Meinung gestatten. Das sind übrigens mitnichten nur die üblichen extremistischen Schwachköpfe; die lese ich erst gar nicht. Aber die Zeit, eine Meinung zu lesen und dann bei der Kommentierung unwillkommen zu sein, ist verschwendet. Ich könnte hier jetzt Namen nennen, lasse es aber.
Diese Haltung aber ist es, die zu einer Atomisierung beiträgt. Und hierin – in der Möglichkeit des zivilisierten Diskurses – liegt der (noch vorhandene) Vorteil bspw. des klassischen Feuilletons z. B. der »ZEIT«, der »FAZ« oder der »SZ«.
Die nicht (bzw. kaum) institutionell vertretene, »kritische Masse« ist in diesen Diskursen allerdings nicht oder kaum vertreten, da oft genug eine gewisse Betriebsblindheit im Feuilleton eingetreten ist. Der einzelne Blogger, der bspw. dezidiert Handkes Jugoslawien-Texte untersucht, ohne schon per se das fertige Urteil parat zu haben, hat da keine Chance. Daher die vage Idee einer Bündelung der Kräfte.
Ein Forum hat den Vorteil, dass sich im Idealfall Gruppen bilden, die sich gegenseitig »befruchten«. Das ist bei Nensch ab und an eingetreten; zugegebenermassen selten. Die Cliquen- bzw. Grüppchenbildung ist m. E. nicht primär falsch bzw. einer Diskussion abträglich.
Meine These ist: Wer lange bloggt, also quasi die volle »Freiheit« geniesst, wird nur schwer einen zusätzlichen »Mehrwert« darin erkennen, diese Position aufzugeben. Sie bestätigen das mehr oder weniger direkt. Ich halte das im übrigen auch nicht für schlimm – ich konstatiere hier nur.
Über Foren in den USA habe ich zu wenig Ahnung. Ich kenne K5 und habe einige Informationen aus Möllers Buch.
Intention
Ihre Intention des Bloggens ist in der Tat eine andere als bspw. meine. Hier gibt es Informationen über Studien zum Bloggen; man kommt hier so recht nicht weiter.
Schön finde ich Ihre Analogie des Lutherischen Apfelbäumchens auf Ihr Bloggen. Diese Sicht ist mir ziemlich fremd, wobei wir bei Ihrer appellartigen Frage wären:
Was wäre denn IHR persönliches Verlangen? Wäre es nicht als eben Ihres ebenso „ephemer“? Erhoffen Sie für sich eine Bedeutung in diesem riesigen Chor der disparaten Stimmen? Was wollen Sie der Welt denn sagen? Was wäre Ihre Ambition? (Ich meine das nicht polemisch.)
Ich nehme es wirklich nicht polemisch und kann nur reichlich naiv antworten: Ich weiss es nicht genau. Die profane Antwort habe ich oben bereits gegeben: Wenn ich über etwas schreibe, bleibt die Beschäftigung mit dem Thema (bzw. dem Buch) länger haften und ist intensiver. Das kann aber nur ein Teil dieses »ephemeren Verlangens« sein. Ich glaube gelegentlich, es ist wie ein Berufswunsch, den man als Kind gehabt hat: Irgendwann weiss man nicht mehr, was man daran eigentlich so toll fand.
Und: Ja, vielleicht ist es tatsächlich ein Narzissmus, der sich aus der Anmassung speist, dass irgendjemanden das, was zu einem bestimmten Thema denkt, interessiert, ja: zu interessieren hat.
Ausblick
Ihre weiteren Kommentare sind natürlich willkommen. Den Account schliesse ich -noch- nicht, also keine Sorge.
#4
Ein CERN für anderen Arten von Elemantarteilchen
Die Frage ist, ob Atomisierung per se schlecht ist… ob Blog oder Internet-Raum nicht eben primär Spielwiesen sind auch für „ephemere Verlangen“? Der Drang zur Gemeinschaftsbildung kann sich ja durchaus ergeben (bzw. es gibt ihn ja ausreichend: die Konsensformen, die „Gewalttätigkeiten ihrer Produktionsgewissheiten“ [Rainald Götz] sind ja Teil des Problems) – und sei es nur als Umkehrung über Sättigungseffekte oder die letztendlich um sich greifende Orientierungslosigkeit. Das Bedürfnis nach „Zusammensein“ (im Sloterdijk’schen Sinne: Blasen, Kontinuen, Sphären zu bilden mit deren Lesarten) wird ja anderswo im angeblich realen Leben genug gepflegt.
Geht es aber um – im weitesten Sinne – politische Anteil- oder Wirkungsnahme, müsste man dem neuen Medium wohl auch Zeit geben, etwas „erwachsener“ zu werden. Und ja, gegen die allseits eingerissenen Sitten helfen dann auch nur Einsicht und Selbstdisziplin. Wer aber fühlte sich bei all der Selbstverwirklichung und Ich-Götterei dazu berufen? Zu welchem höheren Zweck?
Will sagen: So, wie man sich daran gewöhnt hat, dass im Netz „alles umsonst“ ist – und quality content eben nur für Minderheiten -, so müsste man die nonchalanten Verhaltensweisen eben mitbedenken und daraus selber wieder Funken zu schlagen versuchen. Sie zumindest hinnehmen können.
Denn: Mir sind doch bei der Suche nach neuen Äußerungsformen auch immer wieder Momente aufgefallen, die man hätte verstärken können, im Sinne von Offenheit im Inhalt und in der Form. Nur war da nie jemand, der die unschuldigen Finder (Formulierer) hätte ermutigen oder erst einmal darauf aufmerksam machen können – zuvieles geht erstmal unter. Und das bringt mich wieder darauf, dass einerseits solche Dinge wohl benannt und gefördert gehören (Forum), andererseits so zu sagen evolutiv und co-evolutionär sich auch durchsetzen können müssen. Vielleicht absorbiert die Mehrheit um ihres Beharrens willen das Rohe, nicht gleich Einzugemeindende? Vielleicht stören aber manche sich auch an eben althergebrachten Formen, die sie um ihrer selbst willen eingehalten verstehen?
Mich fasziniert dieser Gedanke von der „Schwarm-Intelligenz“. Dass viele zusammen etwas wissen / schaffen können, das ihnen als einzelnen nicht gelänge. Wie bilden sich da aber die Überschüsse, die Übersprünge, die weiterführenden Effekte? Etwa nicht oft auch aus einem quasi Unbewussten der Menge? Etwas das ihr eben noch nicht vor-formuliert worden war?
(In biologischen Schwärmen gibt es kein einzelnes Tier das führt, sondern es sind anscheinend gewisse wesentliche Parameter, heraus deren Veränderungen es dann zu Potenzialen und Verstärkungseffekten und damit wieder zu Dynamiken kommt.)
Für mich müsste es in einer neuen Art Forum aber auch um eine Höhe dieser neuen Qualitäten gehen, denn das reine me-too Kommentieren bringt es weder bei (dem alles behandelnden) spiegel-online noch etwa in den (neue Themen) Heise-Foren, Telepolis. Letztlich stehen gute Beiträge dann auch mit dem, was an ihnen weiterführend wäre und wieder aufgenommen werden müsste, als tote Enden da.
Womöglich bin ICH aber auch das Problem, weil ich zuviele Dinge immer schon weiß (zu wissen meine)?
Vielleicht ist das Handke-Jugoslawien Thema ein gutes Beispiel.
Ich in Düsseldorf, an dem Heine-Preis-Vergabe-Ort, habe hier nicht eine Stimme vernommen, die mich damals hätte aufhorchen lassen (wie dann wieder Greiner, Hartwig, März… oder eben Botho Strauß überregional), obwohl es etwa in den lokalen opinio.de-Foren „Wellen“ schlug (von der „Rheinischen Post“ betrieben, ein meist als konservativ klassifiziertes Blatt). Aber mehr als das Hin- und Her der zu erwartenden, anderswo längst leergelaufenen Argumente ergab sich tatsächlich nicht.
(Das hat natürlich auch immer damit zu tun, dass ein selbstreflexiver Blick auf die eigenen Vorstellungen über solche Konsens-Korrektheiten gar nicht üblich ist: Die vermeintlichen [Schwarm-Parameter]-Gewissheiten sind zu stark. Allein die Frage, heraus welchen Vorstellungen man eigentlich von einem Schriftsteller nur die Doppelung von moralischen Korrektheiten statt neuer, anderer, bereichernderer Gedanken über die Welt oder einen ihrer Sachverhalte erwartet. Usw.)
Ich bin es seit langem gewohnt, eher auf einzelne Stimmen zu achten: Immer ist es eine einzelne, die etwas anders, mit anderen Betonungen oder Untertönen spricht. Diese einzelne Versuchsposition aber darzustellen, sie – eh entsprechend fragil – unter dem Druck etwa vieler Konsens-Kommentierungen, denen sie suspekt ist, nicht aufzugeben… das ist nicht vielleicht per se selten?
Aus meinem Blickwinkel wäre Atomisierung da eben die Stärke, nämlich in dem einzelnen Neutrino, dass seine anderswie leuchtende Ladung abgibt… auch wenn es dann doch unter dem Feuer der Massenmehrheit von vornherein mit dem Verschwinden bedroht ist. Würde ich es aber selber erkennen, wenn es an meinem Bewusstseinshorizont gerade etwas dunkel ist? Oder wenn seine irrationale Bewegung meiner Beharrungsträgheit zu wider läuft? Usw. Vielleicht müsste man mal ein Forum starten, in dem die unwahrscheinlichsten Meinungen co-evolutionär untersucht und gefördert würden?
(Peymann etwa, als einer der Wenigen, der anderswie auf Klar einging, wurde trotz seiner als „bizarr“ etikettierten Position doch einigermaßen weiterverbreitet… solche Effekte. Dagegen steht dann natürlich die bekannte Ökonomie der Aufmerksamkeit: Möglichst „schrill rüberkommen“ und sich um Sinn und Verstand dabei kaum mehr kümmern.)
Statt, dass ich das hier weiter spinne… wie hätten Sie sich die Behandlung des Themas denn vorgestellt?
#5
Komplexitätsreduzierung als Ergebnis?
Ich verstehe Ihre (in meinen Augen sehr idealistische) Idee des Vorteils einer Atomisierung, bin mir aber nicht sicher, ob sie auf Medien angewendet werden kann. Der Aussage, dass in »realen Leben« das Bedürfnis nach »Zusammensein« genug gepflegt ist, widerspreche ich sogar: Ich sehe gerade hierin einen wesentlichen Punkt, warum es Blogs gibt. Und ich sehe hierin auch wieder einen Grund für eine gewisse Ernüchterung, wenn sich die Erwartungen (das Finden von »Gleichgesinnten«) nicht erfüllen.
Man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass jeder »atomisierte« Weblog einen gewissen Anteil an dem hat, was Sie so treffend politische Anteil- oder WIrkungsnahme nennen. Es mag die entsprechenden Kommunikationstheorien geben, die dies bestätigen.
Was mir gefällt, ist der Gedanke einer Art evolutiver Durchsetzung von Äusserungen (ich hoffe, ich habe Sie da richtig verstanden). Voraussetzung dafür ist allerdings, dass diese Äusserungen im Meinungskontext des »Schwarms« multipliziert werden. Will sagen: Meine Einordnung über Handkes Jugoslawienbücher wird nur dann eine irgendwie geartete Gewichtung erlangen, wenn sie gelesen wird. Lesen ist hier natürlich wörtlich zu verstehen und nicht im digitalen Sinne als »Klicken«.
Was Sie zu den »mee-too«-Kommentarforen sagen, ist natürlich uneingeschränkt richtig. Hierin liegt ein zusätzliches Frustrationspotential: Telepolis soll (wie man mir berichtet hat) furchtbar sein; selbst im »Tagesschau«-Forum ist man vor dem Pöbel nicht immer sicher. Kommentarmöglichkeiten auf Webseiten bspw. der »FAZ«, der »SZ«, der »ZEIT« o. ä. dienen den Betreibern ja letztlich nur dazu, unmittelbaren Reaktionen auf ihre Artikel zu erhalten. Da spielt hinein, dass die Gruppe der klassischen »Leserbriefschreiber« erweitert werden soll – die Mehrheit der 20-40jährigen greift heutzutage eher zur Mail oder nutzt eben die Kommentarfunktion. Eine pluralistische Diskussion kann (und soll wohl auch) hier nicht entstehen; alleine schon deswegen nicht, weil die Kommunikation von »oben nach unten« nicht aufgebrochen wird.
Bei Nensch wurden (werden) die Beiträge aus der »Community« selber geschrieben und von ihr auch kommentiert und diskutiert. Etwas ähnliches versucht man mit der »Readers Edition«, wobei hier auch banale Alltagsmeldungen über Fussball oder Celebrity Eingang finden und das Konzept verwässern.
Gerade ein solches Thema wie Handke/Jugoslawien kann auf gängigen Meinungsforen nicht diskutiert werden. Ich wohne ja auch in Düsseldorf und war damals gar nicht auf die Idee gekommen, bei der »Rheinischen Post« irgend etwas hierzu nachzulesen.
Der Heine-Preis-Streit hat aber auch in der Blogosphäre fast nur ernüchterndes gebracht: Auf twoday war das Verhältnis ungefähr 4:1 »gegen Handke«. Hierüber wäre noch nichts zu sagen. Alleine die »Begründungen« waren aufschlussreich: Fast alle derjenigen, die sich in wüsten Beschimpfungen ergossen hatten so gut wie keine entsprechenden Bücher von Handke gelesen, sondern rekurrierten nur auf Aussagen Dritter (u. a. solcher Idioten wie NRW-MP Rüttgers). Erschien in einem Medium ein abwägender Artikel, brodelte des Spiessbürgers Seele und drohte mit dem Abbestellen des Abos. Ein Blogger meinte, er werde jetzt einmal was von Handke lesen – und erntete Unverständnis.
Diese Tatsache, dass man sich heutzutage offensichtlich nicht mehr schämt, komplizierte Sachverhalte, über die man sich nicht aus erster Hand informiert hat bzw. informieren möchte, trotzdem apodiktisch zu kommentieren, ist bezeichnend. Letztlich nivellieren solche Komplexitätsreduzierer das ganze »Gewerbe« auf das Niveau eines Stammtischs. Es tröstet nur schwach, dass solches Verhalten nicht alleine auf die Blogosphäre beschränkt ist: Harry Rowohlt schrieb auch was in der »ZEIT« über den Heine-Preis und Handke und gestand darin, nach der »Publikumsbeschimpfung« nichts mehr von Handke gelesen zu haben.
Den von Ihnen angesprochenen Peymann/Klar-Punkt sehe ich anders. Peymann hat sich und sein jeweiliges Theater immer schon verstanden, effektvoll darzustellen. Keine noch so plakative Provokation war ihm da zu schade. Er hat unglaubliches für deutschsprachige Kultur geleistet und hierfür gebührt ihm grosser Dank. Aber nach dem Tod von Thomas Bernhard ist sein Theater bzw. seine Art des Theaters kaum noch aufgrund der künstlerischen Aspekte in den Fokus gerückt; die Intendanz am BE hat ihn noch mehr marginalisiert. Da kommt eine Stellungnahme zu Klar (und das Angebot, ihn zu beschäftigen) gerade recht, sich wieder in den Schlagzeilen zu finden. Dazu passen auch die Selbstbeweihräucherungen der Pressestelle des BE. Und denken Sie daran, dass sich Peymann schon früher für RAFler eingesetzt hat (man denke an die Sache mit Ensslins Zahnersatz). Und »nebenbei« wird dann Peymanns Meinung gleich mit geliefert. Exotismus – zumal, wenn er eloquent vorgetragen wird – zieht immer noch.
Auf weitere Aspekte von Ihnen bin ich sehr gespannt. (Vorstellungen irgendwelcher Art hatte ich keine.)
#6
Nischenexistenz – Noch einmal zur Guerilla-Partizipation von Einzelstimmen
Komplexität als Weg in die Atomisierung? »Angesichts der schwierigen Weltlage hilft nur eines, den Schwierigkeitsgrad der Kunst zu erhöhen.« (Alexander Kluge 1967 Artisten)
Immerhin: die Medien und ihre Zielgruppen, der Markt (wie die gesellschaftl. Gruppen auch) – sie zerfallen ja! Natürlich wird es immer auch Sammlungen und Nischen geben (das bringt ja auch Vorteile), aber alle Großen bündeln das Disparate der Spezialinteressen seit eh und je. Was schwindet, ist nur der Konsensdruck: Dass also jem., der sich für Sport interessiert, sich auch leidlich in Europapolitk auskennt, jem. der Kreuzworträtsel löst, weiß, dass es auch eine Börsenseite gibt. Usw. Diese Ausschließlichkeit löst auch die eigene Verbindlichkeiten, das eigene Beteiligtsein: Irgendjemand wird sich im Problemfall schon darum kümmern!
Warum wir eine zunehmende Single-Gesellschaft sind, trotz all des Unterhaltungs-Remmidemmis, der Sportklubs, die um Mitglieder plakatieren, der Bedienung noch des abwegigsten Spezialinteresses, überlasse ich mal der Soziologie. Mit all der »Selbstverwirklichung« des Einzelnen aber schwindet seine Anschlussfähigkeit, sein Kompatibilität. Dass alle irgendwie wollen, aber nicht mehr recht können, könnte an unzähligen Phänomenen aufgezählt werden.
Eigentlich müsste es weniger um Gleich- als um Andergesinnte gehen! Aber das machte natürlich erheblichere Mühe, und setzte wohl auch eine andere Bewusstseinlage voraus. Aber, um noch einmal Baudrillard zu bemühen: Es ist ja der Andere, der mir mein Sosein ermöglicht.
Tatsächlich, so lese ich Blogs: Selektiv, unsystematisch… aber immer nach der Spur Ausschau haltend, die als »radikalisiert« Einzelnes etwas an Intensität verspricht, in dem ich mich selber, in einem Teilchenaufblitzen so zu sagen, begreifen kann (oder zumindest auf eine andere Idee davon kommen).
Sicher taugten Blogs und -Foren grundsätzlich auch zur Verständigung über Sachverhalte, aber es ist doch gerade diese Aufrüstung (oder auch: The Empowerment) des Einzelnen, des Subjekts in seinem Sonderfall, das auch dessen Subjektivität dann herausstellt. Und gilt sie nicht geradezu als die Erweiterung, als die neue und wesentliche Differenzqualität zu den »alten Medien«, wo die Objektivierungen ja schon seit geleistet werden (und trotzdem eben ihre Relevanz vor den Komplexitäten der Welt)?
Dass die allermeiste Subjektivität dann so wenig anschlussfähig ist – bzw. wenn alle Mehrheitsteilchen wild feuern das Exotenteilchen dann eben auch untergeht -, ist eien andere Sache.
Und die von Ihnen gesehene Komplexitätsreduzierung ist sowieso der Megatrend! Mehr als ein, zwei Kennzeichen einer Sache kann das Info- und Unterhaltungsgeflutete Durchschnittsbewusstsein gar nicht prozessieren?
Ich glaube manchmal, der unselige Kohl hat mit seiner Formel vom »kollektiven Freizeitpark Deutschland« damals etwas auf den Punkt gebracht, das immer noch gilt, und zwar bis in die neuerdings so genannte »digitale Bohème« (auch wenn ein zunehmend größerer Teil der Bevölkerung ausgeschlossen wird oder sich mehr anstrengen muss: Da frisst dann eben Lebenserwerb alle Bürgerstugenden von Anteilnahme oder sogar politischer Willensbildung.)
***
Was aber – bei immerhin ca. 80 Millionen in D, an die 300 Millionen in EU – wenn es auf die einzelne Stimme eben gar nicht ankommt (ankommen kann)?
Vielleicht sind ja Casting-Shows die neuen Formen von Partizipation? Andys 15 Minuten für jeden? Soziologen sprechen von einer neuen Art der sozialen Performanz, ein mutiges Hervortreten, dass risikobehaftet ist, aber – unter style-kritischen Augen den anderen – belohnt werden kann. Siehe etwa auch alle die »Künstler«, die Moderatoren, die…. Auftretenden, die es eigentlich nicht können, sich aber trauen. Und die Erfolg damit haben, weil sie frech genug sind oder »gut aussehen«.
Was, wenn diese Effekte eben auch bei Blogs zutage treten? Mehr jedenfalls als diese Empowerment-Utopisten von den »real existierenden« gesellschaftlichen Kräften, nämlich politischen Impotenzen, die über all den zu stillenden Unterhaltungsbedürfnissen zur Thematisierung anderer Fragen ihrer Existenz gar nicht mehr kommen?
Aber ich will gar nicht weiter polemisieren (obwohl das im Blog manchmal ein Ventil findet, ein durchaus Lustvolles: Den anderen mal die ewig überhörte Meinung sagen! Auch ein Motiv!).
Es ist ein bisschen schizophren:
Einerseits ist eine gewisse Ernsthaftigkeit wohl immer nur für Wenige. Andererseits soll aber auch gelten »Du bist Deutschland«. Und das heißt doch dann wohl mit allem, was einer je beizutragen hat.
(Übrigens – ich erwähne es auch, da Sie das Wort »Pöbel« benutzen -, fiel mir auf, zweimal wurde der Elitebegriff in letzter Zeit prominent im Feuilleton befragt: Es ginge da wesentlich um so etwas wie die Selbstzurücknahme des Einzelnen, ich glaube, das Wort »Adel« fiel in der Überschrift. Die Wiederentdeckung der »Elite« sei aber in erster Linie ein Zeichen der Krise. Dass Elite aber auch etwas Attraktives ist… darin läge oft die verborgene Wurzel ihrer Ablehnung.)
***
Was man festhalten muss, ist wohl: Komplexe Sachverhalte brauchen Vermittlung. Von daher wird es mit Pluralismus immer weniger weit her sein. (Da kann man andere komplexe Dinge dann in Buzzwords abhandeln: PISA, Migrantentum, Verwahrlosung, Zweidrittel-Gesellschaft etc.)
Vielleicht muss man sogar, hat man weitergehende Ansprüche, mit den Blogs arbeiten, die es eben so gibt? Überflogene Meldung letztens: Die Dame von »Lyssas Lounge« übernimmt jetzt eine Redaktion bei der Welt-online? Na, also! Ich denke aber, ich werde mir weiter nach Themen bzw. Autoren die Texte aussuchen, die mich angehen.
PS noch zu Handke:
(Von Peymann weiß ich zu wenig, er fiel mir nur als eine der wenigen »dissidenten« Stimmen auf. Ist es nicht auch in solchen Zusammenhängen oft so, dass da jede einzelne zählt? Das ist ja mit das Elend der Einzelnen, dass sie sich noch vor ihren Allianzen hüten müssen. Und wenn alle auf Exotismus reagieren, wird er – zumal als Theatermann – wohl wissen, wie er ihn einzusetzen hat: »win/win« mit der PR immer auch ein bisschen für sich selber. Cosi fan tutte!)
Ich fand es seinerzeit gerade interessant einmal zu hören, was denn »die Leute« zu dem Thema so zu sagen hatten. Einerseits mit einem Seitenblick auf OB Erwin, dem ich soviel literarischen Verstand nicht zubillige, als dass er den einmal von dieser Jury nominierten und immerhin ja namhaften Autor sich nicht zur Selbstschmückung gewünscht hätte.
Andererseits überhaupt mit einem gewissen Interesse auf das rührige, aber ewig provinzielle Dorf an der Düssel. Denn siehe da: Kaum ein Politiker hatte etwas von Peter Handke gelesen – aber zuständig fühlten sie sich alle! Haha!
Und so, meine ich mich zu erinnern, war dann auch oft der Tenor von besonneren Stimmen in opinio: Ja, Künstler… Versponnene eben! Aber: Kunststadt D-dorf: Beuys! Wilp! Bringt doch Renommee! (So deren win/win). Und man solle doch den Ruf der Stadt damit / nicht / jetzt nicht noch mehr aufs Spiel setzen, so oder so.
(Ich rätsele dann immer, ob es einen etymologischen Zusammenhang gibt und wie er zu erklären wäre, wenn, dass in »Lokalpatriotismus« das englische »RIOT« steckt.)
PS zum PS
(und das jetzt mit einem Seitenblick auch auf den Beitrag von kranich: Er sagt es ja sehr gut auf seine Weise und führt einen sehr guten, vielleicht überhaupt weiterführenden Begriff ein: Wechselseitigkeit.
(Und zur Kurzfristigkeit: Ja, vielleicht sind die Potenziale längst da, arbeiten und wirken und wir sehen sie nicht, außer, wie immer, ihre Oberflächeneffekte?)
Ich möchte es aber wieder persönlicher wenden:
Keine Ahnung, was ich an Kommentaren zu Handke seinerzeit erwartet hatte. Aber ich war auf meine Weise »erschüttert«. Und zugleich, das fällt mir jetzt auf: Hatte ich nicht, zu meiner eigenen Miesheit, meine Annahmen in eben diese Unbedarftheiten auch einmal wieder bestätigt sehen wollen?
Ich hatte damals einer Mailfreundin in Frankreich etwas dazu schreiben wollen, erinnere mich aber, dass ich es dann nach einigem Aufwand abgebrochen hatte – etwas, das bei mir selten vorkommt! Es war dann aber das Themenmiteinander zu komplex in dem aus meiner Perspektibe Anzusprechenden, zu kompliziert aber auch in den Berührungen von etwas in mir selber… versuchsweiser Stimmfindung in etwas bisher Ungesagtem, in der »anderen Wahrheit« von Literatur, im Gestus der Einspruchnahme, meinem eigenen Außenseitertum… und dann eben auch in dieser Stadt, in ihren Instituionen zur Gemeinschaftsfindung, in dieser Gesellschaft. Es war so zu sagen ein Moment selber an Politik! An selbsthafter Elementarteilchen-Politik, um es einmal so verquer zu sagen!
Ich erwähne das auch, um noch einmal auf das notwendig Vereinzelte so mancher Blog-Stimme hinzuweisen. (In der Quantenphysik übrigens gehen die allermeisten Exoten-Teilchen auch einfach unter, sie können ihre Potenziale nicht wirksam machen.)
Konkret: Es hat früher für mich verschiedentlich Möglichkeiten gegeben, in lokalen Institutionen etwa, meine Stimme als reale Anteilname einzubringen (ich kenne heute noch Leute dort, in so genannten Kulturgremien etwa). Es war dann mir aber letztlich nie möglich. Ohnmacht, und zwar solche, die elementar mit meinen persönlcihen Möglichkeiten zu tun hatte, die auf die objektiven, selber aber wiederum komplexen Verhältnisse treffen. Ich halte dies tatsächlich für eine weitverbreitet vorkommende, für eine gesellschaftliche Sutuation: Der Einzelne angesichts der (ihm nicht einmal a priori feindlich gesonnenen) Übermacht.
Zugleich stelle ich fest – etwa bei freien Künstlergruppen, seltsam unbestimmten Kunstläden und Aktivitäten hier und -, dass immer mehr »inkommensurable« Einzelne auftauchen, dass sie anderswie einmal da sind, hier Auftreten, dort etwas Plakatieren, wieder Untergehen… anderswie weiterwirken. Ich habe dafür keine Theorie. (Sie könnte vielleicht anschließen an die »Cool Killer«-Zeiten, urban-art-Bewegungen, auch soziale Stadtteilkommandos, Spontis etc.)
Ich denke aber, dass es auch da kritische Massen geben kann, Übersprünge hier und da, Unterwanderungen, die all die Schäubles der Welt nicht mal namhaft machen könnten, geschweige denn kontrollieren. Ich habe nicht die Illusion, dass diese Potenziale mal zu etwas wirklich Bewegendem reichen werden. (Allein dass seit dem Wechselbalg des »Neubeginns« eine solche veränderungsunwillige Partei wie die CDU derart Bestand hat, sagt mehr über die Bewohner dieses Landes und die Vielzahl der Einzelnen daran Verzweifelten.)
Für mich persönlich allerdings stellen sie in eben ihren Potenzialen (etwas, das permanent mit so etwas wie einem Möglichkeitshorizont verbunden bleibt) eher etwas Anschließbares dar, als die seit langem mit den üblichen Trägheitskräften durchsetzten Bewegungen. Ideen-Guerilla-Marketing der anderen Art, wo sie, Ideen und ihre Kräfte, wie Quantenteilchen »tunneln« und anderswie in Erscheinung treten mögen. Warum nicht hier und da in einem Blog, wenn sie – Entschuldigung, falls ich die Metaphorik bisher etwas überstrapazierte – einen solchen »Ereignishorizont« bieten?
#7
…ach ja, das noch: Stichwort „Zeitgenossenschaft“, Interessante Meldung dazu
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.03.2007
Die Schriftstellerinnen Sybille Lewitscharoff und Felicitas Hoppe begraben im Interview mit Hubert Spiegel die Kollegen Martin Walser und Günter Grass, deren »permanente Zeitgenossenschaft« ihr Werk zerstöre. Lewitscharoff wird recht deutlich: »Ich glaube, das hat ihnen wirklich das Kreuz gebrochen, auch wenn sie heute noch verehrt werden, aber das hat sie wirklich in die Falle gelockt, in die Werksfalle sowieso. Wenn man permanent in dieser Weise kommentieren muss, sich derart dem Zeitgeist aussetzt und ja auch an die Spitze des Zeitgeistes möchte, dann wird auch das eigene Werk infiltriert. Man ist ja jeder Form der Vulgarität ausgesetzt .« (Hervorhebung von mir)
#8
Komplexitätsreduzierung und Smalltalks
Kohls Ausspruch vom »kollektiven Freizeitpark« fand ich nie ganz untreffend – ich interpretiere es vermutlich aber ein bisschen anders als er. Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker gab Kohl indirekt vor vielen Jahren recht, als er meinte, die deutsche Gesellschaft habe jahrzehntelang in einer Art »stillem Übereinkommen« (meine Worte) mit der Politik einen »Vertrag« geschlossen: Die Politiker sollen sich um den Wohlstand und dessen Vermehrung kümmern – im Gegenzug kümmern sich die Bürger nicht zu detailliert um die Politik (und die Politiker).
Die Folgen dieses »Kontraktes« erleben wir heute. Immer dort, wo dann – entgegen der ursprünglichen Intention – eine Stellungnahme geboten erscheint, kommt es dann zu der von Ihnen als Megatrend beschriebenen Komplexitätsreduzierung. Das kann man überall sehen – von Feuilleton-Themen wie Handkes Jugoslawienbücher bis zur alarmistischen »Klimawandel«-Diskussion, die seltsame Blüten treibt und schon längst die tatsächlichen Implikationen zu Gunsten griffiger aber leider sinnloser Imperative vergessen zu haben scheint. Sie ergibt sich aus der Crux, über nichts mehr Bescheid zu wissen, aber genötigt zu sein, zu allem etwas sagen zu müssen. Dem sind Politiker von Amts wegen vielleicht noch entschuldbar verfallen (nein, eigentlich nicht entschuldbar!). Aber Blogger? Warum nicht aus Respekt vor der eigenen Unwissenheit einmal schweigen?
Insofern ist übrigens ihr Bild des Moderators oder der unseligen Casting-Shows treffend – hier gewinnt nicht unbedingt derjenige, der »fachlich« der beste ist, sondern der beste Vermarkter (und: ja, um so etwas behaupten und sagen zu können, habe ich mir natürlich einige dieser »DSDS«-Sendungen angesehen).
Einerseits ist also ein gesellschaftlicher Druck vorhanden, sich zu allen möglichen komplexen Themen äussern zu können (und nicht nur auf dem Niveau eines smalltalks bei Partys) – andererseits erfolgt das natürlich meistens auf einem Niveau des Dilettanten (hier verwendet im ursprünglichen Sinn). Weblogs multiplizieren irgendwann diesen Dilettantismus, der durch die Syndikatsbildung (das Verlinken von/mit Gleichgesinnten) mühselig zugekleistert wird.
Das Problem ist dabei, dass auch die professionelle Journalistik immer mehr einem Dilettantismus fröhnt, der manchmal geradezu erbärmlich ist. Und noch einmal: Ich möchte Dilettant nicht als ausschliesslich negativ konnotiert verstehen!
Immer wenn bei Nensch argumentationsresistente Zeitgenossen auftauchten, war der gängigste Ratschlag: »Nicht antworten – Don’t feed the troll«. Ich empfand das immer als reichlich paradox – einerseits ist ja man gerade auf einem Forum tätig, um einen Diskurs zu pflegen, andererseits sind mit bestimmten Zeitgenossen ab einem gewissen Punkt offensichtlich keine vernünftigen Diskussionen mehr möglich. (Ich habe damals schweren Herzens versucht, mit an die DFTT-Regel zu halten; nicht immer erfolgreich, übrigens.) Ein Weblog ist da der ideale Ausweg – nach einer gewissen Zeit blendet sich die Klientel, die sich über die Inhalte des Bloggers aufregt oder sich gelangweilt fühlt, einfach aus – man ist unter sich. Der Blogger ist also der »selbstverwirklichte Einzelne« (um Ihr treffendes Wort ein wenig abzuändern) – dessen »Anschlussfähigkeit« aber schwindet. Von hier zum Solipsismus ist es also nicht mehr weit, oder?
Ihr emphatischer Ansatz ist nun, dies nicht als besonders schlimm zu erachten. Im Vertrauen (ich glaube nicht, dass noch jemand mitliest): Ich stimme dem ja dahingehend zu, weil ich ja selber einen Weblog habe und eben die oben beschriebenen Verfahrensmuster inzwischen selber (zu meinem Leidwesen – teilweise) praktiziere. Ein gelegentlicher Blick über den Tellerrand allerdings offenbart grausiges; es gibt Weblogs, die derart rassistisch sind, dass sich einem die Haare zu Berge stellen (sie zelebrieren dies als besonders tugendhafte und freiheitliche Meinungsäusserung; rhetorisch nicht ungeschickt [diese meinte ich mit »Pöbel«] und übrigens weit entfernt zum dumpfen Rassismus der üblichen Dummköpfe). Hierauf dann nicht zu antworten hat immer auch ein wenig mit stillschweigender Akzeptanz zu tun; ein Dilemma. Ich kenne einen Blogger, der gelegentlich in anderen Blogs (und auch Foren) derart beschimpft wird, dass im Nu eine virtuelle Lynchmobstimmung aufkommt, die ad hominem geht.
* * *
Es ist ja nicht so, wie uns vor 25-30 Jahren erzählt wurde: Man breche das öffentlich-rechtliche Monopol des Radios und Fernsehens zu Gunsten privater Anbieter – und die Meinungsvielfalt prasselt über uns herein. Ich erinnere mich an flammende Appelle für »Bürgerrundfunk« und von der schönen Zeit, wenn Fernsehgremien von den Knechtungen der Parteieninfiltration frei seien; das bisschen Werbung… Und was haben wir bekommen? Ich verkneife mir Aufzählungen. 1993 wurde dann (man war schon mit RTL und SAT1 zugekleistert) ein ambitionierter Informations- und Nachrichtensender gegründet: VOX. Ich glaube, es dauerte nicht einmal ein halbes Jahr, bis die ganzen wirklich informativen und anspruchsvollen Sendungen zu Gunsten der üblichen Einheitssosse verschwunden waren – es gab nicht genug Quote. Und wo gibt es Qualitätsfernsehen im Moment? Bei den öffentlich-rechtlichen – in Nischen von »3Sat« und »Arte«. (Neulich, ein Verwandter in Bayern. Es wurded von der Mietergemeinschaft abgestimmt, welche Fernsehkanäle von der Sat-Anlage übernommen werden; es gehen aus technischen Gründen nur 12 oder 15. Irgendwann stand dann zur Diskussion: Entweder »Kabel 1« und »Super-RTL« oder »3Sat« und »Arte«. Brauch ich das Ergebnis nennen?)
In diesem Sinne stimme ich Ihnen also auch zu: Wir müssen nur lange genug suchen, um in der Blogosphäre so etwas wie »3Sat« zu entdecken – die Frage ist aber, ob der Blogger, der dies ja in der Regel freizeitmässig betreibt, dies durchhält.
Was Sie zum »lokalen Einbringen« sagen, deckt sich mit dem, was ich von anderer Seite immer wieder gehört habe. Engagierte man sich bspw. politisch in Parteien auf lokaler Ebene, wurde man zunächst einmal zum Plakatkleben abgestellt; die Rahmenbedingungen waren längst ausgekungelt, bevor man seine Ideen und Gedanken hätte einbringen können. Ich halte es jedoch für fatal, zu glauben, durch eine Nischenöffentlichkeit wie das Bloggen wäre die Möglichkeit der Partizipation höher. Das hielte ich für eine Täuschung. Hier würde ich eher auf meinen Gedanken über ein Forum verweisen – welches durchaus pluralistisch ein könnte, aber eben grundverschieden vom Mainstream wäre.
* * *
Zum sehr interessanten Kommentar der »Zeitgenossenschaft« äussere ich mich später oder sogar in einem separaten Beitrag.
#9
Der Einzelne und seine Ruhmeshallen
Zum „stillen Übereinkommen“ à la Freizeitpark-CDU-Staat. Mag denn wirklich jemand auf Dauer mit den uninspirierten Figuren bei solchen scharfen Sachen wie Gesundheitsreform und Krippenplätze belästigt werden? Oder anders herum: Wer wäre da noch fähig und wach genug für immer wieder mikropskopisches Nachdenken über derart öde, wenn auch ebenso längst notwendig komplexe Sachverhalte?
Allerdings ist so etwas wie „Schweigen“ wohl gar nicht mehr möglich: Alles braucht unentwegt Nachschub.
(Sogar ich mit meinem Tobak kriege Mails, warum ich keine Beiträge mehr einstelle!)
Aber so oder so: Bleibt nicht alles Verblendungszusammenhang?
Ein Lehrstück der Einspruch des ehemaligen Generalinspekteurs Naumann letztens zur „Ahnungslosigkeit unserer Politiker“ – immerhin sogar Steinmeier, der Minister des Äußeren! – zu „weltpolitschem“ Handeln, also der Sophistik wg. den neuen amerikanischen Raktenstationierungsplänen und dem „taktischen“ Auftritt Putins inm München. Es machte es schlagartig deutlich: Politik ist wesentlich auch ein Illusionstheater. Soll man es aber ergründen wollen, wenn einem die notwendige „Information“ aber per se vorenthalten wird resp. manipuliert scheint?
Lehrstücke auch, diese zähen „Aufklärungen“ um die CIA-Flugzeuge oder diese Sache mit Kurnaz, immerhin ein Bürger mit Verfassungsrechten! Was ist da gelaufen und was läuft da immer noch, während uns auf den Bildschirmen die zähen Rituale derer informationellen Aufklärung vorgeführt werden: Durch andere uninspirierte Figuren. Demokratie, Politik, Medien… unsere derart verhandelte und täglich „upgedatete“ Welt… Kann man sich noch dafür interessieren?
Die Fragen sind natürlich rhetorisch, aber sie zielen auf ein gefühltes Moment von Abgekoppeltsein von solcher Art Welt, und zwar auch durch ihre – hergestellte, nicht mehr zu unterlaufende – Komplexität. Also wendet man sich ab. Und behauptet sich anderswo. Journalismus wäre dann, solche Zusammenhänge nachhaltig aufzuklären (und immerhin gibt es das hier noch: In den USA, mit weitgehend unverstellten „Tendenz“-Nachrichten, haben deshalb Blogger tatsächlich ein anderes „standíng“).
Um auf das Bloggen hier zurückzukommen: Diese Art Unernst im Wissen über kaum einermaßen zu sichtende Themen herrscht ja auch da. Und ist das aber nicht ein gutes Zeichen? Können wir eine vernünftige Abschätzung treffen, wenn wir gar nicht wissen, dass etwa Putin von den Amerikanern über deren neuerlichen Raktenunsinn lange informiert war und diesen Vorsprung dann zu einem taktisch guten Zeitpunkt auf der Tagung in München zu einem moral-stragetischen „Vorsprung“ gegenüber dem Westen nutzen konnte? Usw. Wer wollte das alles durchblicken? Wen noch ernst nehmen?
(Aprospos Bahr, der sicher ein ernst zu nehmender Mensch ist, aber ist der auch nur den Informierteren durchschaubar? Ist er nicht der Prototyp des Geheimen Unterhändlers, Fädenziehers. Man kann dann auf die grundrechtliche Verfasstheit solcher Hintergrund-Politiker immer nur hoffen. Und dennoch gibt es dabei die still-elitäre Haltung: Wir müssen das tun, es ist zu Deutschlands Bestem, wir wissen schon, was zu irgendjemands Besten ist… obwohl es demokratischen Verfahrensprozessen zur Konsensfindung entgegen steht. Wer entscheidet das wann, wenn es den üblichen Verharensregularien entzogen ist?)
Ich will nur sagen, dass all die „Information“, weder die wohlfeile noch die potenziell-verfügbare, längst nicht mehr durchschaut werden kann, und dass jeder – ich hier gerade -, der versucht sie abzuwägen und sich dabei bewusst ist, wieviel er – Komplexitätsreduzierung – auszulassen hat, in dem Gefühl der dabei fälligen Ohnmacht nicht ganz falsch liegt. Warum es also ernst nehmen? Warum sich nicht die gleiche Freiheit nehmen? Warum nivcht Bloggen und unverANTWORTlich daherreden? Wenn man dann noch sieht, mit was und wie breit sich Zeitgenossen „im Fernsehen“ äußern dürfen? Man könnte annehmen: Eine Idiotenrepublik! Und müsste sich doch den Vorwurf der elitären Anmaßung anhören, weil es diesen Wunsch nach der Partizipation aller gibt!
(Da ist mir Botho Strauß dann immer so sympathisch: Ich denke, dass bei all den längst gängigen öffentlichen Affekten auch der des schlichten Ekels, der der offenen Verachtung seine Berechtigung hat. Die, die in dafür zeihen und sich selber in ihren basisdemokratischen Distinktionen adeln, kommen mir da durch ihre Geläufigkeiten nur anderswie blindgängerisch vor. )
Wäre es also nicht wirklich besser, und zwar für alle, einfach mal ab und zu den Mund zu halten? Aber Schweigen, glaube ich, ist eben längst etwas Unmögliches.
***
Das mit den „Privaten“ ist ganz übel. Aber da habe ich auch zu der ganzen Argumentiererei keine Lust mehr: Abschalten den Dreck, weil ihn nun wirklich niemand braucht. Aber bin ich da nicht auch in einer gewissen Nähe zum mir sonst fremden „Terrorismus“? Ich glaube, es ist aber auch ein gutes Beispiel für mein Nischen-Argument: Es GIBT einfach nicht genug Nachfrage nach Differenz. Und Zyniker sagen: Der gesellschaftliche Bodensatz, der sich Junk-Tivi ansieht, muss eben auch irgends gebündelt werden.
(Mir fällt da immer der Satz des grausligen RTL-Thoma ein: „Der Wurm muss dem Fisch schmecken nicht dem Angler“. Ja, aber! Er als gesellschaftlich-relevante Kraft – heute noch agiler „Berater“ etw bei Bertelsmann – übernimmt natürlich doch keine Folgen für die Analphabetisierung, nur für den Profit. Der Fisch stinkt da aber tatsächlich – und anhaltend! – vom Kopf her.)
Es bleibt bei „arte“ – immerhin! Es bleibt bei der Nische – sonst gäbe es eben gar nichts! Und am besten ist es (für mich, der sich da abgekoppelt hat), sich darüber auch nicht mehr groß aufzuregen, weil man doch zu sehr zum Don Quichotte wird.
Der große Einzelne – die Linie Schmitt, Jünger, Benn…. oder heute Botho Strauß, Dávila etwa – ist ja für unsereins auch kein praktisches Vorbild. Die – als Abstraktum zu verteidigende – Masse ekelt uns aber doch an. Zwischenwesen also, sind die meisten, die sich noch – anteil-nehmend & individualistisch – äußern da nicht für ihre Nischen gemacht? Jeder (s)ein Sonderfall und zugleich Teilchen in etlichen Strömungen? Also ist so ein Blog immerhin eine Art distanzierte Teilnahme, sein kleinen Betrag in der riesigen Textmasse immerhin einzuspeisen… bevor man völlig (völlig verzweifelt? wie die Leute der RAF? gerade Ohnmacht ist ja oft Grund für radikale Gewalt), und als Meinungs-Gesamtheit im Mainstream dann eh untergeht.
Ich neige immer zu dem „ephemeren Verlangen“. Die Tussi, die sich in ihrem Tussitum dort spreizt, die Schüler in ihren pubertären Abenteuern, all die Themen-Spezialisten in ihrem Sonderwissen ebenso… es wirkt da auch immer ein Narzissmus. Ins Blog ausgelagert werden auch diese Momente von Entdeckung, von eigenen Besonder- d.h. Selbstheiten, von Gefunden- (Erwählt-, Erhört-, Errettet-, Erlöst-)sein. Das Blog ist, als Ort der „Stimme“, wie immer auch moduliert, auch ein „Ruf“ selbst, dort allein ebenso wie herausgestellt zu sein, mit sich berufen und zugleich unter alle anderen.
(Fällt mir gerade ein: Sloterdijk arbeitet diese Seiten sehr gut heraus in seinem Aufsatz über Bach und das „Sirenen-Stadium“. Siehe aber auch den „oralen Fundamentalismus“. Das alles in „Sphären I Blasen“. Vielleicht liegen jeweils in solchen Tiefe mehr Gründe, als das oberflächliche Medium denken lässt?)
#10
Dilemmata
Ja, auch Iris Radisch hat vergangenes Jahr einmal den Respekt vor der Schreibhemmung eingefordert; versteckt (wie sonst gar nicht bei ihr) der Hieb auf die Geschwätzigkeit der Medien. Auf einem Blog so etwas einzufordern, bedeutet jedoch vom Metzger die Umstellung auf ein vegetarisches Angebot anzuregen. Und, nein, mit aller Entschiedenheit GEGEN ein unverANTWORTliches daherreden – DAS bekomme ich doch überall schon geliefert. Um es klar zu sagen: Viele Blogs unterscheiden sich doch nur marginal von primitiven Stammtischen. Und man erschrickt, wenn man erfährt, wer denn dahintersteht: manchmal (oft genug) Studenten; Mittelstand – kurz: Leute, von denen man anderes erwarten dürfte. Will ich aber bei bierseligen Stammtischen dabeisein? Nein; wirklich nicht. (Nebenbei die Frage, ob die »akademischen Stammtische« besser sind.)
Und s/Sie bringen es auf den Punkt: Einerseits der Wunsch nach Rückzug aus dem Politischen – andererseits der Wunsch nach Partizipation. »Was denn nun?« frage ich denjenigen, der mir nach fünf Minuten von mehr Bürgerbeteiligung schwärmt, aber nie und nimmer Argumenten aufgeschlossen ist. Man kann sehr leicht gegen »die Gesundheitsreform« sein, wenn man sich das Ding nicht durchgelesen hat. Will ich das aber? Ehrlich gesagt, nein. Aber ich müsste es, wenn ich hierüber (mit) zu entscheiden hätte.
Wir können uns aber eben gerade nicht diesen uninspirierten Geistern ausliefern! Wir sind zum Mitdenken verurteilt; wenigstens zum Fragen (Handke!). Aber dann mein Ekel, wenn ich eine Sendung in Radio und Fernsehen anhöre, bei der dann irgendwelche Leute anrufen und Politiker (oder Journalisten) befragen. Diese Leute haben nämlich meistens keine Fragen mehr, weil sie nur ihre Antwort durchgehen lassen. Fünf Minuten ein Held sein und seinen Sermon ablassen! Einwegkommunikation mal anders; multimediales Schmierentheater. Mit Recht auf dem Rückzug. Nein, ich bin dezidiert gegen grossflächige Volksentscheide (Ausnahmen auf kommunaler Ebene und die ganz grossen Entscheide [EU-Verfassung oder so etwas ähnliches!]). Sonst hätten wir ganz schnell Todesstrafe für Kinderschänder; die D-Mark; den Austritt Deutschlands aus der EU. Der Bürger wird eigentlich durch seine Repräsentanten vor sich selbst geschützt. Aber was, wenn diese Repräsentanten nicht mehr integer sind?
Und: Ich vertraute einem Egon Bahr noch, dass er »das Beste« wollte und machte – und schliesslich mussten sich ja die Produkte seiner Diplomatie den Abstimmungen stellen. Aber traue ich heute noch jemandem wie Steinmeier? Wohl eher nicht.
Zu den Blogs: Ich sehe Ihr Argument der Nischenexistenz. Aber wenn sich ein Nischenblogger in die Nische begibt, dann verhungert er dort, oder? Wird vielleicht zum »Autisten«? Wie die Leute in der U-Bahn, die mit aufgepfropften Kopf- oder Ohrhörern den ganzen Wagen beschallen, nur um sich abzuschotten? Neulich schrieb mir jemand, dem ich andeutete, dass ich den Blog schliesse, ich sei doch so was wie »3sat« oder »SZ«, also »unverzichtbar«. Und Redakteure dort würden doch auch nicht auf Zahlen, Quoten, Leserbriefe schauen. Klang alles gut – aber es stimmt nicht. Natürlich schauen sie darauf und selbst ein öffentlich-rechtlicher Sender wie »3sat« steht unter Legitimationsdruck. Eine Sendung wie »Kulturzeit« kann so gut sein, wie sie will – ohne Quote würde sie nicht weiterbestehen (zur Sicherheit verpasst man sich gerade dort eine neue politisch-korrekte Linie). Und »arte« findet jeder toll, guckt aber keiner.
Abschalten, den Dreck der Privaten. Ja, einverstanden. Aber damit blenden Sie sofort rd. 30-40% (50%?) der Bevölkerung aus, die ihre Informationen fast ausschliesslich hier beziehen! Und diese Leute entscheiden ja die Wahlen! Und man überlege einmal: Die Parteien beklagen, dass sich »traditionelle Bindungen« an sie auflösen. Sie sollten es als Chance sehen – denn ein Wähler, der heute CDU gewählt hat, steht dort nicht mehr dreissig Jahre lang unverrückbar. Sie haben es aber lieber, wenn der »Wechselwähler« ins Lager der »Nichtwähler« wechselt – auch, wenn sie natürlich das Gegenteil sagen. ‚Wenn ich seine Stimme schon nicht bekommen kann, dann der andere auch nicht.‘ Das ist eine Politik des »verbrannten Wählers« (statt verbrannte Erde), die dort seit Jahrzehnten betrieben wird.
Im Grunde genommen sind RTL und SAT1 »Riesennischen« für das sich so rasch und bereitwillig entpolitisierende Volk. Und dann vorgestern kurz im Fernsehen Michael Naumann mit einem Blumenstrauss, als er von 99% der Delegierten der Hamburger SPD zum Kandidaten für die Hamburger Bürgerschaft gewählt wurde. Man stelle sich Naumann vor, wie er mit RTL-Zuschauern diskutiert. (Kennen Sie noch den »heissen Stuhl«?) – Dilemma: Solche Leute müssen in die Politik – sind für die Masse der Wähler aber so exotisch wie ein blaues Kaninchen.
Wer ist in der Nische? »arte« oder »RTL«? Oder beide in jeweils anderen Ecken (so nennt man das beim Boxen wohl)? Sinnvoll muss es doch sein, einen Diskurs zwischen beiden zu suchen – und zwar ohne Anbiederung an die Masse. Ist es nicht eine Schande, dass öffentlich-rechtliches Fernsehen (ARD / ZDF) mehr und mehr zur willfährigen Hure des Massengeschmacks verkommt? An einem Sonntag gab es von 8 Uhr bis 17 Uhr Sport auf der ARD. Bezahle ich für Biathlon, Langlauf, Skispringen und Bobfahren? Wohlgemerkt: Das waren keine Welt- oder Europameisterschaften, sondern meistenteils nur »normale« Weltcup-Spiele. Brot und Spiele – aber wo ist da der Anspruch? Und warum laufen denn Büchersendungen um 23.30 Uhr sonntags? Weil sie um 22.45 Uhr mal eine niedrige Einschaltquote hatten?
Und da sind Weblogs eben nichts anderes als ein Spiegelbild der medialen Gesellschaft. Daher teile ich den Optimismus nicht, obwohl ich das Potential durchaus sehe. Aber auch im Fernsehen steckt ein grosses Potential – es wird nur nicht genutzt.
Ephemeres Verlangen – Zeitvertreib. Nicht weniger. Aber auch nicht mehr. Oder?
#11
Brot & Spiele – und die blinden Flecke des eigenen Unvermögens
…ephemeres Verlangen unser allen Zeitvertreibs (also ob mit ohne ohne vorgeschobenen Überbau von kippenden Gründen).
Ja, das trifft was! Was ist aber dann mit der Demokratie, wenn man sie verwirklichte? Müsste man nicht also einmal die Unvernunft der Massen „zu sich selbst kommen lassen“? (Oder ist sie da schon immer?)
Sonst bleibt es ja beim status quo derjenigen, die sich möglichst nicht in ihren Gewissheiten erschüttern lassen wollen. (Letztens während des Wartens auf einem Zugbahnsteig gehört: „Die Ausländer nehmen den Deutschen ihre Arbeitsplätze weg,“ tatsächlich mit allem Ernst an Überzeugung. Ist so etwas überhaupt noch argumentierbar? Welcher Aufwand macht dazu Sinn? Sollte man solche Dinge nicht an sich selber zuzgrunde gehen lassen?) (Alle Fragen hier sind natürlich rhetorisch.)
Mir ist Bahr auch sympathischer als Steinmeier, aber … gibt es überhaupt eine Wahl? Sind es nicht „gefühlte“ Argumente, die Zustimmung (Stimmen) bringen? Insofern war Schröder schon richtig, wie es jetzt auch Merkel ist: Irgendwie drückt sich der Zeitgeist auch in den Temperamenten und Mentalitäten der prominent im Namen anderer Agierenden aus. (Und Kohl hatte jenes unsympathische Deutschland vielleicht auch verdient?)
Mir kommt es manchmal so vor, als ob man die Schwächen des Systems, die Stumpfheit der Mehrheiten, die Idiotie der Medien, diese ganze träge Umwälzung namens Fortschritt, während der der Weltgeist angeblich zu sich findet… das man anscheinend das alles in Kauf zu nehmen hat, um „Freiheit“ – dann auch in seinen Elaborierungen, etwa der Wissenschaft, der Kunst – zumindest eben in ihren Nische relativ unbedrängt sich realisieren zu lassen.
Dieses „Verhungern“… wenn ich etwa ein ungeselliger Mensch bin, der sich eher für entlegene Kunst- als für die gängigen Gesellschaftsthemen interessiert, der in keinen Verein oder schon gar eine Partei eintreten mag, den Fußball nicht interessiert und auch sonst keine Massensachen… bin ich dann nicht per se abgehängt? Eine Nischen-Eixstenz? Eher wenig anschlussfähig an irgendeine Art Konsens? Ich frage mich das selber. Welche Art Partizipation ist mir noch möglich?
Und: Ist im Moment des Interesses des Persönlichen, wie es nur schwerer vergesellschaft werden kann – Obsesssionen, Leidenschaften, Manien, Agressionen… – nicht immer auch „autistisch“? Und wäre das nicht gut, angesichts einer alles bis ins Restlose vereinnahmen wollenden Idee namens „Politik“? (Der Widersprüche bin ich mir bewusst, aber es wären eben auch die Widersinne, die daran zu erwecken wären. Die Ir-ratio, die das Unvereinnehmbare des Eigensten vielleicht selber re-präsentiert.)
Ohne Ironie: Manchmal empfinde ich ja auch so etwas wie eine ans Anonyme gerichtete Dankbarkeit für die Möglichkeit meiner Randexistenz.
Kleine Zwischenbemerkung zum Fernsehen:
Ich schau fast nichts anderes als „arte“ – nicht, weil ich so differenzsüchtig bin oder mir selber auf die Schulter klopfen will: Ich würde mich gerne mal unter meinem Niveau gemein machen… aber mich auch nicht mehr dafür ekeln müssen (etwa bei dieser alles-verseuchenden Comedy). Es geht also kaum. Und siehe da: Die interessantesten, ungesehendsten Bilder kommen tatsächlich oft in diesen Experimentiersendungen nach Mitternacht! Ich beschwere mich also nicht, sondern bin froh, dass es überhaupt eine Ecke dafür gibt!!
„Kulturzeit“ allerdings ertrage ich kaum mehr: Eigentlich ist das auch nur mehr eine Ecken-Konsenssendung, die mir schon in der Anmoderation aufgibt, mit welcher Haltung und welchen Denkbausteinen ich das folgende Thema nun aufzunehmen habe: „Muss man das nicht auch im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus sehen?“ Ja, wie denn sonst? Brav!
Will sagen, dass bei diskurs-korrekter Über-Abdeckung von relevanten Themen ebenfalls Verflachungs- und Redundanz-Effekte einsetzen: Denkfaulheit! Alle Aufklärung nivelliert sich auf dme erreichten Niveau! Das ist weniger zynisch gemeint als ein Problem eben der Vermittlung: Weniger wäre mehr!
(Und auch dort längst jeder Magazin-konform Beitrag aufgepimpt mit überflüssiger Musik, mit immer mehr MTV-Ästhetik, alles vermeintlich nicht sofort Vertraute sofort auf einen mittleren Stand der anzunehmenden Informationspegels darüber gebracht! Sie lassen die Bilder, die Gesichter, die Besonderheiten nicht ausreden! Dazu kommt alles zusehends schmissig, konsumier-erwartbar, reproduktiv bis in die Formalien: Geht’s um Malerei etwa, klimpert immer ein Klavier – immer!. Bitte einmal keine Klavieruntermalung, wenn gemalte Bilder gezeigt werden, einmal nur, ja?! Danke!
Ich denke, diese Redaktion bräuchte dringend Erneuerung, eine Frischzellenkur! Und vorher etliche Erschütterungen ihrer Selbstgewissheiten. )
Das mit dem „Spocht“ hat wohl mit Geld zu tun: Die wissen, dass sich nur Minderheiten für solch exotische Disziplinen interessieren, aber es bindet gesellschaftliche Gruppen, erzeugt die Illusion der „Versorgung“ (ein wesentlicher Begriff für die Ö.R.!) und bringt billige Sendeformate.
Das, was einmal Vorteil war – viele Landesanstalten, Vielfalt – ist selber zur Erstarrung geworden. „Kultur“ ist nur ein bunter Fleck für Minderheiten im „audience flow“ für den Mainstream.
#12
Zementierung der Gewissheiten – und anderes…
Genau darum ging es mir bei der Beschreibung der meisten der aktuellen Weblogs: Sie wollen sich nicht in ihren Gewissheiten erschüttern lassen. Ich lasse das Wörtchen »möglichst« sogar noch weg! Die Frage ist nun, ob das eine Tugend ist oder ein Elend.
Im beschriebenen Beispiel (am Bahnsteig) ist es natürlich ein Elend. Meine Zeit, als ich dem dann widersprach, mich (verbal) einmischte, ist längst vorbei (genauer gesagt: ich habe es nur 2-3 mal gemacht). Aber im Blog?
Nehmen wir das aktuelle Beispiel um die »Koran-Richterin« (so eine Titelzeile auf einem Weblog). Wer hat ernsthaft den Sachverhalt vom Affekt gelöst? Wenige. Wer die Nachricht zuerst möglichst deftig kommentierte, hatte das meiste Echo. Reagans Gesetz: Eine Lüge solange wiederholen, bis sie nur noch geglaubt werden kann; Widerspruch nicht in den Sinn kommt.
Ist das die »neue Freiheit«? Ja, Freiheit ist anstrengend – implizit das Aushalten des Anderen. Aber was ist, wenn ich das Andere schön ausblenden kann mit der »Blogwirklichkeit«? Wirft nicht dieses affektierte Verhalten genau das schlechte Licht auf die »Blogger«, die sie verdienen? Ist ein Hartz typisch für alle Personalchefs? Natürlich nicht – aber jeder weiss nun, was möglich ist. Da ist ein Drang nach Vereinfachung – gerade weil die Welt so komplex ist. Das Vorurteil ist deswegen sehr bequem und es in abgeschlossenen Zirkeln zu kultivieren war noch nie so leicht wie heute (früher brauchte man hierfür »Logen«).
Wie gelegen einigen Gesinnungsfreunden diese Entgleisung der Frankfurter Richterin kam! Endlich hatten sie (wieder) Futter für ihre These. Welche Wollust aus ihren Zeilen triefte, als sie drei, vier eilig hingeschmierte Zeitungsartikel verlinken konnten! Was unterscheidet diese Leute von der Person am Bahnsteig und ihrer These? Weblogs sind Möglichkeiten – aber vor allem auch Herausforderungen! Und da ist Ihre These natürlich sehr treffend: Man muss den Müll in Kauf nehmen, um unter ihm die Pretiosen zu finden. In der Tat habe ich manchmal das Gefühl, die Suche im Netz ist das moderne Goldsuchen und Blogs sind die Claims. Hierin liegt ja auch der Charme: Das eigene Blog kann zum anarchischen Raum werden; zur Spielfläche. Und wie beim Goldsuchen schaut man natürlich, was sich in den anderen Claims so tut – aber nur, wenn man will.
* * *
Und natürlich ist es ein Vergnügen (in manchen Dingen) eine »Randexistenz« zu sein – es sein zu dürfen (freilich mit den Konsequenzen, die es mit sich bringt). Und die Ambivalenz in der Sache: Randexistenzen können nur möglich sein, weil viele exakt das machen, was man dann selber für sich ablehnt bzw. so nicht machen würde. Dieses Paradoxon erlebe ich oft genug selber. Sie erwähnten es ja schon einmal. Die Masse, der man (freundlich ausgedrückt) eine gewisse Ambivalenz entgegenbringt, ermöglicht erst das, was »Sosein« nennen könnte. Besonders krass (hier trifft das verhunzte Wort) ist das bei »Aussteigern« zu sehen: Das Aussteigen ist nur möglich, weil es genug »Drinbleiber« gibt. Würden alle gleichzeitig »aussteigen«, ginge es schon nicht mehr. [Als vor längerer Zeit einmal am Bahnhof ein heruntergekommener Mann morgens die Zugreisenden (meistens Pendler) mit den Worten beschimpfte: »Ihr Idioten! Ihr geht arbeiten! Ich brauch das nicht…« (die unflätigen Ausdrücke lasse ich weg) und dann gleichzeitig um Geld ersuchte – meine Antwort: Ich könne noch nichts geben, sondern müsste das Geld, was ich vielleicht ihm geben wollte, heute erst einmal verdienen!]
* * *
Manchmal frage ich mich, ob Nischendasein nicht als Euphemismus für voreilig selbst diagnostizierte Bedeutungslosigkeit steht. Früher habe ich Fernsehleute, die über ihren Quotenfetischismus gesprochen haben, für exaltiert gehalten. Deren Programm hatte doch mir gefallen – also was soll’s. Wenn man einen Blog hat, also – im Kleinen – auf der »anderen Seite« steht, schaut man (= ich) plötzlich, wie viele Leute was lesen, wie viele Klicks aufgrund von Google generiert werden (also zunächst einmal keine Leser, sondern »Laufkundschaft«), usw. Wenn ich nun feststelle, dass es mir in mehr als einem Jahr nicht gelungen ist, signifikant Zugriffszahlen zu steigern, so kann ich mich natürlich auf die Nische stützen und behaupten, ich schreibe eben nur für eine gewisse Klientel oder ich kann Themenauswahl und Schreibstil befragen. Ersteres ist bequem – letzteres muss dann Konsequenzen haben. Das hat nichts damit zu tun, was stimmt (vermutlich immer beides ein bisschen).
Neulich schrieb mir jemand, dass ihm einige Rezensionen (ich sage lieber »Begleitschreiben«) auf meinem Blog gefallen. Exakt diese haben jedoch eher übersichtliche Zugriffszahlen (vielleicht auch deswegen, weil sie wenig bis gar nicht kommentiert werden; Kommentare generieren ja immer Zugriffe). Seine (ernüchternde) Antwort war, dass es vielleicht mit der Länge der Beiträge zu tun habe. Vermutlich hat er damit sogar recht – aber was wäre ernsthaft die Konsequenz? Daumen rauf – Daumen runter? Es gibt einen anderen Blog auf twoday, der sich mit Büchern beschäftigt. Dort schreiben Leute – wie sie es nennen – »Rezensionen«. Diese bestehen meistens aus einem Zitat aus dem Klappentext des Buches und einer mit »Meinung« überschriebenen »Rezension«, die aus ca. 10-12 Zeilen besteht. Bei den Budddenbrooks stand da sinngemäss, dass der/die »RezensentIn« sich gefreut hatte, das dicke Buch zu »Ende gelesen zu haben; schliesslich sei es ja ein Klassiker. Die Sprache von Thomas Mann wurde dann noch irgendwie als antiquiert bezeichnet. Am Schluss gibt’s ein Tool, welches eine Bewertung anzeigt (ich glaube es sind maximal 5 Kästchen [ähnlich den »Sternen«] zu vergeben). Wäre das für mich die Alternative? Natürlich nicht.
* * *
Ein paar Worte zum »Spocht«. Ich mag das; schaue auch Fussball (habe die WM allerdings ohne Fahne und andere sichtbare Zeichen verbracht). Ich halte Sport auch für absolut notwendig. Er bietet den Menschen eine Sehnsucht: Klare Regeln, die jeder versteht und auch anwenden kann (daher ist ein Spiel wie Fussball so populär – und andere Sportarten eher nicht) und – vor allem – ein sichtbares, verhältnismässig schnelles Resultat, welches eindeutig ist. Keine Deutung ist bei einem 2:1 Ergebnis möglich. Es müssen keine Entwicklungen (wie in der Politik) abgewartet werden; keine langwierigen Prozesse. Die Spannung wird im Nu aufgelöst; nach 2 Stunden weiss man, wer »der Bessere« ist. Ich glaube, dass ein Spiel wie Fussball auch identitätsstiftend ist. Das kann dann natürlich aus eskalieren – siehe Hooliganismus. Aber früher sind die Völker in die Schlachten gezogen, um sich »zu beweisen« – heute hat man seine »Stellvertreter« – hochbezahlte »Profis«, die »für einen« in (einen überschaubaren) Krieg ziehen. Die eventuelle Niederlage ist dann auch keine Schmach mehr – flugs werden dann ein oder mehrere Spieler zur »Flasche« erklärt, usw. Die modernen Tragödien werden in den Sportarenen dieser Welt geschrieben; Krimis und Sport erlauben die Katharsis des 21. Jahrhunderts. Das sagt auch einiges aus.
* * *
Obwohl es nicht zum Thema gehört – einige Worte zu »Kulturzeit«. Ihr Urteil teile ich im grossen und ganzen. Die Redaktion bedarf vermutlich wirklich neuer Impulse; mit Schrecken sehe ich immer der Woche entgegen, wenn Tina Mendelsohn die Moderation übernimmt (immer mit erhobenem Textmarker beim Interview; grässlich) – und schaue inzwischen dann auch nicht mehr. Viele Beiträge sind allerdings gar nicht redaktionell, sondern liefen vorher in anderen (vorwiegend ARD-)Sendungen (»ttt«; »Weltspiegel«). Der Sendung gut es nicht gut, dass sie derart politisiert worden ist – und doch arg das eurozentristische Weltbild vertritt.
#13
Mein Beitrag zur Zukunft der Gesellschaft
Vielleicht berührt es ja teilweise ein Grundverständnis, ob man so weit von sich absehen kann, sich selber anderswo versuchsweise einmal anderswie zu begreifen? Es ist wohl wie mit den Deutschen auf Mallorca: Manche bestehen auf Bratkartoffeln wie zu Hause, andere wollen das „ursprüngliche“ Mallorca, das auch die euro-subventionierten Einwohner gar nicht mehr kennen können (und die haben es auch von den über Jahrtausend eingewanderten Piratenvölkern synkretistisch gewissermaßen entwickelt – Mallorca wäre so gesehen etwas ganz Unbekanntes… wenn man es nur einmal so begreifen könnte!).
Beides berührt aber in jedem Fall die Frage: Wer ist man – zuletzt: in egal welcher Betrachtungsweise -sich dabei selbst? Und sind die angeblichen Gewissheiten tatsächlich eigene oder nur solche, die man inmal ohne Nachdenken übernommen hat und also kaum je aus anderem Blickwinkel betrachtet? Und sind sie (als Selbststabilisierung) dann eine Freiheit oder eine Einengung? Usw.
Ich wollte wieder „die Nische“ anpeilen… Denk-Nischen, Lieblings-Glaubenssätze-Erker, Überzeugungs-Ohrensessel, Überbauten-Gehäuse… alles Merzbauten der Person, in der sie sich einrichtet. Alles in seiner Bedingtheit immer mit-bedenken ist ja aber auch mühsam. Und ist diese Franfurter Richtern, mit dem Versuch offenbar das Fremde in seinen Rechtsvorstellungen mit einzubeziehen nicht auch da schon in einer „Nische“, einer gut-deutschen eigentlich, eine die zeigen will, dass sie dazu gelernt hat? (Man denke hier aber auch einmal kurz an den „Tugend-Terror“, siehe Jessen, ZEIT.)
Was dann die Manipulationen angeht: Schaffen wir sie nicht wieder selber? (Und diese BILD-Betitlung „Koran-Richterin“: Wollen wir denn nicht, das etwas auf dem Punkt ist? Können wir alle die Korrektheiten in ihren Umständlichkeiten immer noch mitbedenken? Ist die Arbeit am „Richtigen“ nicht auch eine Art Verengtheit unserer „Konsens-Freiheit“, die wir gerne einmal loswürden? Befreiung durch Lachen à la „Borat“.)
Scheinfreiheiten. Letztens äußerte jemand den Gedanken, dass in all dem überbordenden Aussprechen, das alle in ihren Blogs leisten, sie damit den Kontrollinstanzen in die Hände spielen. (Nicht unbedingt gleich big-brother oder der Justiz, aber denen, die Interesse an aktuellen Geisteshaltungen haben, egal ob es die Geheimdienste des Staates oder die der ökonomischen Trend-Scouts sind, oder irgendwelcher Soziologen. Es gibt mittlerweile auch Text-Tools, die mit Datenbank-Techniken große Word-Scans nach catch-words durchführen können, um zu sematischen Auswertungen zu kommen. In Marbach wird angeblich auch überlegt, ob man nicht alles versuchsweise Geäußerte mal eben für Ewigkeiten zu speichern hätte. Oder „Myspace“: Für ein bisschen Fun und „falsche Freunde“ verraten alle gleich ungehemmt ihr Intimstes. Usw.)
Worauf ich hinauswill, ist, dass wir selber längst durchdrungen sind von allen möglichen Techniken und Kultur-Techniken aus disparaten Bereichen, die zu komplex sind, sie in ihren möglichen Auswirkungen immer erst einmal zu durchdenken… deren Gesamtheit uns aber sowieso in dieser Sphäre hält, uns in unserem Tun dort sogar „selbst“-ausweitet, aber eben auch immer genauer „formatiert“ (im Foucault’schen Sinne: Allen die Technik geben, und alle wären innerhalb dieser Techniken der Macht: Alle kriegen ein Mobiltelefon, aber alle Verbindungsdaten werden zentral gespeichert… Und unser eigenstes Herz ist tiefst-finster).
Wären also die Nische, die Kleinheit, die Anonymität… nicht selber (zumindest im Ansatz und einer gewissen Tendenz der Beweglichkeit, auch der Verweigerung) kleine Bedingungen, uns dem zu entziehen? Die implizite Verweigerung als die letzte „politische“? Das „Kleiner-Denken“, das Huschen über die „Tausend Plataues“ auch im Text, statt auf die Klickzahlen und die Schlagzeilen, also die Mini-Relevanz im Nachhall seiner Denke zu schielen? Die Nische, die Unbemerktheit als letzte Freiheit, die dann auch hier und da in Gedanken einmal tatsächlich die Formatiertheiten unteräuft?
(Und: Wenn man – ich tu das nach wie vor auf Telepolis – die hard facts der Kultur- und Medienwissenschaftler verfolgt, die die Auswirkung und Tatsächlichkeiten des Internets und seiner Techniken untersuchen, kommt man doch eh von all den schönen Utopie-Blasen – analog anscheinend den wirtschaftlichen aus der Gründer- und Boom-Zeit – ab. Blooms „Meme“ und das globale Gehirn, Teilhard de Chardin mit seiner Noosphäre – tolle Science Fiction! Anregend zu lesen, wenn man eine alte Schwäche fürs Utopische hat. Aber die Realien sind dann, dass solche Finstermänner wir Murdoch den ganzen Teenie-Spaß aufkaufen und sie ihrer Super-Vision unterziehen: Und die lautet: Profit!. Und was ist mit einem solchen Ansatz wie dem „Bundestrojaner“? Ist das Böse denn immer und überall gleich mit dabei? Wenn wir kommen: Anscheined ja! Ich brauche nur in mein Cookie-Verzeichnis zu schauen, mit wem ich es beim Surfen durchs Weltweite Wunderbare zu tun bekomme: Mind-Share ist immer dabei: Jemand erdreistet sich also ungefragt, mich, mein bisschen Geist im Auftrag anderer mit anderen wiederum zu teilen! Wer schöpft mich da aus / ab? Tatsächlich bin ich also mit all meinen wunderbaren Freiheiten immer im Netz einer Kontrolle – und immer auch schon der Click- und der Quotendepp: „Eine Freiheit, und ihr nicht entrinnen…“ (oder so ähnlich heißt es schon bei Schiller; der wusste vielleicht mehr über Schein-Freiheiten als wir!).
***
Dass meine eigene Randexistenz also ein Nischen-Dasein per se ist… und womöglich sogar auch noch eine Luxus-Falle: Das ist mir bewusst. Und um es auch zuzugeben: Ich selber habe, als ich mich auf diese Webarbeit eingelassen habe, früh alle diese naiven Träume geträumt, von der Schnelligkeit, dem unbegrenzten Austausch, der Radikal-Demokratiserung, der Befruchtung der Geister… und dann auch verstehen müssen, dass die Leute sich selbst gar nicht genug zurücklassen können, um in einen solchen Raum anderswie zu agieren. Sie bringen immer alles von sich mit!
Erinnert sich noch jemand an Sherry Turkle? Die intelligente Legitimation für eine erweiterte Web-Existenz! Aber anscheinend geht es gar nicht darum. Zumindest nicht, wenn sie Massen-weise vorkommen: Wie man überall vernehmen kann, ist es in „Second Life“ noch einfältiger als in der Realität, der sie dorthin für eine Spielexistenz entfliehen wollen! Um es wienerisch zu sagen: Wo der Geist hinkommt, wird es stupid… Statt Vielheit nur Mehrheit, und die überall. Da wird es schnell auch mal diktatorisch…
Vielleicht ist „Bedeutungslosigkeit“ ja der Preis, der für das bisschen mehr an Freiheit zu entrichten ist? (Zumindest der, sich nicht von der de facto Definitionsmacht der Mehrheit zu unterwerfen. Seltsamerweise wird „Bedeutung“ – eh oft erst im Nachhinein – häufig von einer Spannung zwischen der Masse und den Einzelnen erzeugt: Man kann seine eigene Bedeutung vor der Quantität letztlich immer auch leicht unterschätzen… siehe noch einmal das Elementarteilchen, das dann doch in einer bestimmten Kette von Reaktionen den Unterschied macht.)
***
Ich will mich nicht aufspielen mit meinem Medien-Desillusionismus, aber auch diese Erfahrung mit der Klick- und Leserzahl habe ich vor etwa 10 Jahren schon einmal gemacht. Es war die mit einigem Aufwand betriebene Site einer kleinen Künstlergruppe, seinerzeit mit sämtlich nur denkbarem aktuellen und ambitionierten „Content,“ den ich als Redakteur teilweise zusammenbrachte… an manchen Tagen gab es hundert Besucher! Als ich aber eines Tages eines meiner Objet Trouvés einstellte, ein Fundstück, dessen obszönen Text ich transkribierte, weil ich es für interessant hielt und auch für zeigenswert… stiegen die Klickzahlen rasch in die Tausend, und entsprechend der Traffic. Ich begriff damals, dass ich mir keine Mühe mehr geben brauchte, es sei denn, ich wäre dauerhaft mit den wenigen ernsthaften Interessenten zufrieden. Aber dafür all die Arbeit? Und die immense Kritik (für meinen „Subjektivismus“)? Es ist wohl doch eine Kosten-Nutzen-Relation. Heute fühle ich mich geradezu privilegiert! Ich bin, radikal unverbunden, freier so zusagen auch um meine „Bedeutung“. (In einem weitgehend „aufklärerischen“ Zusammenhang sehe ich mich dabei aber immer noch.)
***
Beim Sport gelingt es mir nicht mehr von den Phänomenen drumherum wegzuschauen, ob Manipulationen wie in Italien oder durch „Spitzenfunktionäre“ wie Sepp Blatter, ob bejubelter Faschistengruss in einem Riesenstadion wie in Rom oder dem kleinen miesen Schlägerspaß am Wochenende in der Provinzstadt, der für die eigene Frustabfuhr den Tod anderer in Kauf nimmt: von dem dreckigen Geld und dem Narionalismus-Hype mal ganz zu schweigen. Ehrlich gesagt, kann mir mein Urteil da gar nicht radikal genug sein. Ich denke sogar, dass sich an diesem Teilbereich der tatsächliche Zustand unserer Gesellschaft viel besser ablesen lässt, als an der reglementierten Politik: Es ist Krieg!
(Genazino sagt letztens irgendwo, dass unser Alltag längst „katastrophische Züge“ angenommen hat, und er bezog es auf Lärm, Gewalt, Massenüberfüllung… auf eine Szene in seinem neuen Buch, die zur Weltmeisterschaft spielt: Plötzlich leuchtete mir sein Einfall mit dem sich auflösenden Körper des Protagonisten auch ein – der verliert erst ein Ohr, dann einen Zeh: Es fällt aber niemandem weiter auf: Wir haben bei all der Komatrinkerei und der Vogelgrippe, bei Irak und Globalisierung den Pegel für so etwas wie einen normalen Blick auf uns verloren, bzw. diese „Norm“ hat tausende von Löchern. – Auch da empfinde ich meine Nische als Privileg.
Wieviel der „deutsche Wahnsinn“ eigentlich mit mir selber zu tun hat, weiß ich nicht. Manchmal denke ich: Mehr, als mich raushalten kann ich nicht tun. Aber das wäre mein bester Beitrag!)
#14
»Medien-Desillusionismus«
Schönes (vorläufiges?) Résumé?! Die »naiven Träume« machen ja das Aufwachen so hart. Blogs begreife ich dann fast nur noch als einen Akt der Verzweiflung. Der Blogger ist der Unerhörte. Manchmal glaube ich auch, die Ermöglichung all dieser Äusserungen (wie das Bloggen) ist nur Ventil – zum Abreagieren. Ein Simulieren von Pluralität der Meinungsäusserung. Speaker’s Corner. Das Schlimme dabei ist: Es ist gleichgültig geworden.
Diese Gleichgültigkeit gibt es in Diktaturen nicht (ich habe nie in einer gelebt). Dort hat das Wort noch einen Wert – mit oft fatalen Folgen. Manchmal – und jetzt bitte nicht falsch verstehen – wäre eine solche Gewichtung des Wortes fast wünschenswert. Endlich wieder lernen, »zwischen den Zeilen« zu schreiben und zu lesen (und nicht nur bei Schriftstellern)! Endlich wieder Worte suchen! Aber es geht ja nicht – es ist vollkommen hirnrissig, sich deswegen diktatorische Verhältnisse zu wünschen. Aber es ist Paradox: In der freien Meinungsäusserung liegt immanent das Moment des Nivellierenden; des Beliebigen und auch des Banalen. Das abgewogene, prüfende, tastende, suchende Wort lässt bei uns (fast) nur Gleichgültigkeit zurück.
Daher »Tabubrüche« – die wenigen, die noch bleiben (man denke an Eva Herman: Die blosse Abweichung von gesellschaftlich adaptierten Imperativen plus eine geschickte Marketingstrategie genügt). Und daher schlagen so viele Blogger auch diese schrillen, lauten Töne an: So werden sie gehört (wenigstens innerhalb der Szene). Krönung der Aufmerksamkeit: Sie werden (meist mit nichtigen Gründen) gemassregelt (einstweilige Verfügungen; Klagen). Hieraus saugen sie dann Nektar. Das schlimmste aber – im umgekehrten Fall: Niemand beachtet sie.
Und nur hierin haben wir vermutlich einen Dissens: Ich sehe nicht, dass das »Elementarteilchen« den Unterschied machen kann. Oder nur im Sinne dessen, was ich als blutigster Laie in »Chaostheorien« gehört habe. In der Medizin nennt man das wohl Homöopathie. Oder beim Gehen im Wald schaut man fasziniert auf den »Ameisenhaufen« – hat die einzelne Ameise eine Idee ihres Schaffens, ihres Beitrags? (Ganz sicher nicht)
#15
„Laut der neuesten, groben Schätzung von Blogherald gibt es heute weltweit rund 100 Millionen Blogs, und es ist nahezu unmöglich, eine allgemeine Einschätzung über ihre „Natur“ abzugeben oder sie in präzise Genres zu unterteilen. Doch ich werde eben dies versuchen. Es ist von strategischer Bedeutung, kritische Kategorien einer Theorie des Bloggens zu entwickeln,…“
Mir scheint, Überlegungen zu einer Theorie (oder auch „nur“ zur Praxis) des Bloggens, kranken oft daran, die all zu kurze Existenz- und Entwicklungszeit des Gegenstandes zu unterschätzen. Auch Geert Lovink wendet sich nach einer rhetorischen Einschränkung („ist nahezu unmöglich“) ziemlich unbekümmert seinem Thema zu.
Ich glaube, daß die „Blogosphäre“ weiterhin Potential zu ganz neuen und unerwarteten Erscheinungen hat. Und zwar deshalb, weil viele Blogs die Auseinandersetzung eines Individuums, des Bloggers, mit seiner umgebenden Realität spiegeln. Sie spiegeln diese Auseinandersetzung und sind selbst eine spezifische Form dieser Auseinandersetzung. Neue Momente der Realität und des Realitätsbezugs der Individuen werden, so meine Vermutung, zu gegebener Zeit neue, vielleicht erhebliche Auswirkungen auf’s Bloggen haben.
Meine Blogger-„Startposition“ ist nicht zu trennen von meinem intensiven, vieljährigen Tagebuchschreiben. Eine Funktion dessen war immer Selbstverständigung. Diese Funktion bleibt im doch öffentlichen Bloggen (erstaunlicherweise) fast ohne Einschränkung erhalten. Dem liegt durchaus eine bestimmte Auffassung vom Menschen, von meinem „persönlichsten Ich“ in der Gesellschaft zu Grunde. Dazu gehört nicht zuletzt der Gedanke: Meine Selbstverständigung kann für Dritte einen Wert haben.
Zugleich hatte mein Tagebuch für mich immer die Funktion einer Materialsammlung und zugleich eines Lebensberichts „nach draußen“. Ich würde Zeugnis ablegen. Konkret hätte ich diese Absicht bei Fortexistenz der DDR und Nichtvorhandensein eines WWW in einer Form verwirklicht. Heute haben sich inhaltliche Ausrichtung und technische Form des beabsichtigten Bezeugens gravierend gewandelt aber der Grundimpuls, ziemlich tief in meiner Lebenskonzeption verankert, bleibt wirksam; kein flüchtiger Antrieb.
Zeugnis abzulegen kann eine einsame Veranstaltung sein: „Ecce homo!“ und kaum jemand schaut hin. Wie wichtig bin ich denn? Ohne alle Hilfsmittel würde ich mich vielleicht nur drei oder fünf Leuten mitteilen können. Deshalb sind für mich tägliche Besucherzahlen des Blogs von 100 phantastisch, übertreffen alle Erwartungen..
Wie wichtig sind mir Diskussionen, Kommentare? Mittelprächtig. Natürlich ist die Bestätigung schön, verstanden zu werden oder Anregungen zurück zu bekommen, doch im Grunde genügt mir das Wissen, daß die BesucherInnen (zu 35% Wiederholungstäter) sich ihrs ‚rausgenommen haben. Der Zugewinn ergibt sich für mich nicht so sehr aus der direkten wechselseitigen Diskussionbeteiligung als vielmehr aus der Pflege meines „kleinen persönlichen Blogprozesses“, soll heißen: Aus der Führung meines eigenen Blogs, der einigermaßen systematischen Wahrnehmung von und mitunter aktiven Beteiligung an ca. 35 Adressen meiner Blogroll, sowie der sporadischen Sichtung weiterer Blogs und Websites.
Danke für das hiesige schöne Angebot zur Beteiligung.
[EDIT: 2007-03-15 20:14]
#16
Existenz- und Entwicklungszeit
Danke für diese Schilderung.
Mir scheint, Überlegungen zu einer Theorie (oder auch „nur“ zur Praxis) des Bloggens, kranken oft daran, die all zu kurze Existenz- und Entwicklungszeit des Gegenstandes zu unterschätzen.
Das ist natürlich der »Knackpunkt«. Sind wir zu ungeduldig? Oder suhle ich mich bereits im Abgesang auf die Bloggerszene (infiltriert von »Journal« hier)?
Deine optimistische Sicht finde ich interessant. Kannst Du noch ein bisschen mehr zu den Auswirkungen sagen, die sich für das Bloggen ergeben sollen?
[EDIT: 2007-03-16 11:02]
#17
Das Bloggen scheint mir ein bedeutendes Werkzeug der Individualisierung zu sein und zugleich Ausdruck derselben.
Früher habe ich eine leidenschaftlich-optimistische Sicht auf Individualisierung gehabt, die ich als einen notwendigen Unterbau oder besser gesagt den unverzichtbaren Gegenpol des sozialistischen Kollektivismus wahrgenommen habe.
Das Kollektiv könne nur echt werden, wenn das Individuum vorher keinen „Kollektivstein“ auf dem anderen gelassen hat. Danach käme es „nur“ (!) darauf an, so meine Vorstellung, daß die freien Individuen aus freier Entscheidung ihre Bindungen gestalten.
Bezüglich der Möglichkeiten, Fähigkeiten, Bereitschaft und Absicht der Individuen solches tatsächlich zu tun, habe ich mir immer Neugier und immer auch starke Zweifel erlaubt; wenn überhaupt, dann nur sehr eingeschränkten Optimismus (nach dem Untergang der DDR in einer kommuneartigen Szene dazu zahlreiche Erfahrungen gemacht).
Ob nun optimistische Perspektive von Individualisierung oder nicht – ihre Realität bezweifle ich nicht.
Bedeutendes Moment z.B. der Umgang des Individuums mit Informationen. Das Bloggen bedeutet enorme Aktivierung der dem Individuum verfügbaren Informationen einschließlich eines wachsenden Anteils selbst generierter Information. Ebenso gravierend (in Umfang wie in Struktur) beeinflußt es die Informationsaufnahme des Individuums. Der Blogger krempelt sein ganzes persönliches Informationsmanagement um, in gewissem Sinne schafft er es überhaupt erst. In Anbetracht der schnellen Entwicklung der Hardware- und Softwarebedingungen des Bloggens, ist dieser Prozeß noch lange nicht am Ende. Und dito in Anbetracht der im WWW sprunghaft zunehmenden Informationsmenge, einschließlich zu findender Qualität.
Gewiß der WWW-“Dünnpfiff“/Marktschrott nimmt ebenfalls sprunghaft zu. Das eigene, ständig durch die persönliche Erfahrung überprüfte Infomations- und Kommunikationskonzept bietet m.A. n. aber ausreichenden Schutz.
Information im Blog ist immer, zumindest potentiell, soziales Signal, enthält, wenn auch vielleicht nur höchst abstrakt, die Möglichkeit, daß Individuen aneinander „andocken“. Das einräumen, heißt keineswegs der Vorstellung einer eigenen Blogger-Gemeinschaft anzuhängen. Das liegt mir fern.
Ihr „sozialer Grund“ muß die Individuen zur Bindung drängen. Das ist, wenn es passiert, zunächst völlig unabhängig vom Bloggen. Wenn es aber passiert, dann könnte das Bloggen zum enorm produktiven Vehikel werden. Ein bisher unvorstellbares Maß „unmittelbarer Gesellschaftlichkeit“ der Individuen (von ihnen gewollt) könnte Wirklichkeit werden. Ich verstehe jeden, der heute praktisch Null Ansätze zu solchen sozialen Tendenzen sieht. Meine Erfahrung aber, wie unglaublich verschieden dieselbe „Masse Mensch“ im Verlauf weniger Jahrzehnte denkt, flößt mir größte Zweifel ein, das heute unbestritten und allgemein Selbstverständliche als endgültig zu betrachten.
[EDIT: 2007-03-22 16:24]
#18
Im Grunde genommen beschreibst Du aus persönlicher Sicht das, was en-passant mit »Atomisiserung« meint.
Natürlich ist Bloggen individualistisch; der polemische Titel meines Aufsatzes hier, der von »Narzissten« spricht, ist allerdings nicht umsonst gewählt. Die Gefahr in diesem Individualismus liegt natürlich in dem, was schon besprochen wurde (Eindimensionalität; Komplexitätsreduzierung, usw). Wenn jemand wie Peter Turi als Fazit von anderthalb Jahren Bloggen sagt Bloggen macht süchtig, dick, aggressiv und kurzatmig, stiehlt Lebenszeit und bringt am Ende nix ein ist das m. E. mehr als eine hübsch gesetzte Pointe – sondern äusserst resignativ. (Mein Eindruck ist übrigens, dass man sich in diesen »Alphablogger«- oder »Betablogger«-Kreisen nur noch um sich selber und/oder seine Rankings dreht; bspw. hier – naja, was soll’s.)
Was mich immer skeptisch macht, ist, wenn mit neuen medialen Möglichkeiten eine Art Paradies beschrieben wird. Ich habe noch in Erinnerung, als in Westdeutschland in den 80er Jahren Ideen über »freie« Radiostationen kursierten, die so etwas wie »Bürgerfunk« progagierten, der losgelöst vom Korsett der öffentlich-rechtlichen »Meinungsmafia« zur wahren und richtigen und authentischen und nützlichen Information führen sollte.
Nun, Lokalradiostationen heutzutage sind der Regel nur primitive Dudelfunksender, die vom Kommerz umnebelt (= am Leben erhalten) werden. Und was das Privatfernsehen angeht – das wissen wir ja alle, welche »Qualitätsschübe« da kommen.
Aufgrund dieser Erfahrungen (und natürlich auch der Resonanz auf meinen Blog hier) bin ich skeptisch. Der gekonnt geschriebene Partyplausch oder die witzige Alltagsschilderung wird immer ein Publikum bekommen. Hierin dürfte die Zukunft des Bloggens liegen. Aber ein Blog, der in irgendeiner Weise den traditionellen Medien »Konkurrenz« macht oder auf sie rekurriert, dürfte auf Dauer keine Chance haben. Es sei denn, er ist sich selbst genug.
[EDIT: 2007-03-23 09:11]
#19
Der Blog als Logik unserer Zeit
Vorweg: Ich habe die oben stehenden Kommentare nur überflogen, falls sich manches wiederholt, bitte ich um Verzeihung.
Bloggen ist mittlerweile ein verbreitetes Phänomen. Das hat mehrere Gründe: Zum einen ist das technische »Substrat« vorhanden, zum anderen haben viele Menschen (in unserer westlichen Welt) auch Zugang dazu, sei es nun als Leser oder als Schreibende. Das Bloggen resultiert aber auch aus gesellschaftlichen Entwicklungen bzw. treibt es diese weiter voran – ich denke hier an wechselwirkende, sich selbst verstärkende Prozesse.
Zuvor vielleicht noch zu dem immer wieder beanstandeten »Müll« in den Weiten des World Wide Web. Man sollte sich darüber vielleicht nicht über Gebühr erregen, vorallem wenn man bedenkt, dass vieles was früher in Tagebücher gekritzelt wurde, was auf fliegenden Blättern notiert wurde, heute eben in einem Blog, in Foren, oder auf persönlichen Seiten in digitalisierter Form deponiert wird. Ist nun einmal so. Bedauernswert, beklagenswert, aber nicht mehr als zu anderen Zeiten.
Drei Schlagworte: »Individualisierung«, »Ökonomisierung der Lebenswelt«, »Postmoderne«. Anhand dieser ist es vielleicht möglich, sich dem Phänomen zu nähern, es verstehbar zu machen. Ich bin mir nicht gänzlich sicher ob ich auf dem richtigen Weg bin, aber es scheint mir so, als ob das Bloggen eine Konsequenz unserer Zeit ist, sich quasi logisch aus ihr ableiten lässt. Und ich bin mir ziemlich sicher: Eine monokausale Erklärung gibt es nicht. Und: Alle Erklärungen sind miteinander verwoben. Also zum ersten:
Die Individualisierung/>
Dazu wurde oben bereits einiges gesagt, daher vielleicht nur so viel: Es scheint logisch, dass das Netz »mitindividualisiert«, das heißt die virtuelle Ebene die gesellschaftliche spiegelt. Ein Blog liefert die Möglichkeit ganz gezielt, eben das, was mich als Individuum interessiert, oder belangt, zu behandeln, zu kommentieren, und gleichzeitig für »alle« einsehbar zu machen. Ein Blog ermöglicht, sich mit Facetten dieser ungeheuer komplizierten, unüberschaubaren und in Detailwissen aufgesplitterten Welt zu beschäftigen. Das isolierte Individuum, von der Vielfältigkeit der Welt überwältigt und abgestossen, beginnt wieder mit Teilen, mit Splittern dieser Welt zu interagieren – auf textueller, virtueller Ebene. Ja, vielleicht ist gerade diese Illusion ein ganz wesentlicher Punkt: Mein Blog ermöglicht es mir in die Welt hinauszuschreien, ich werde gehört und wahrgenommen! Und wenn wir an Krisengebiete denken stimmt das teilweise sogar, denn Blogs aus solchen Regionen werden gerne gelesen.
Ökonomisierung/>
Du schriebst, ein Blog ist auch eine Marke. Genau. Mann kann sich verkaufen, anbieten, präsentieren und darstellen. Dinge die der allgegenwärtige Markt fordert. Schriftsteller, Politiker, Journalisten, Stars, Sportler – sie alle vermarkten etwas, nämlich sich selbst – und sie haben ihre Fangemeinden, die konsumieren wollen (zumeist wahrscheinlich nicht mehr; die Forderungen die Du beispielsweise an einen Blog stellst sind gänzlich andere). Ein Blog ist also die Möglichkeit ein bestimmtes Selbstbild zu verbreiten, zu transportieren, Werbung zu machen, und zwar auf ganz »persönlicher« Ebene, aber – und das ist wiederum wichtig – für alle sicht- und lesbar.
Das posmoderne Paradigma/>
Ein Blog bietet auch die Möglichkeit der Moderation und kommt damit dem, was man – zugegeben vereinfacht – als postmoderne Beliebigkeit bezeichnet, entgegen. Ich kann mit Hilfe meines Blogs »alles« sein, jede Meinung vertreten, einmal dieses, dann jenes. Das reale Individuum, das sich mit verschiedenen Identitäten zu schmücken versteht (der Markt fordert!), tut im Web genau dasselbe. Es will glitzern und schauspielern. Einen festen Kern gibt es nicht. Hier kann man perfekt tarnen und täuschen, mehr aus sich machen als tatsächlich da ist, lügen, schwindeln, schön reden – alles ist möglich, die »Wahrheit« natürlich auch. Der Blog verankert dieses Schauspiel (man findet ihn wieder), im Gegensatz zum Chat, wo man ein ähnliches Spiel treiben kann, aber eben diesen Ankerpunkt nicht hat.
Unsere Zeit »fordert« den Blog, sie bedingt ihn, und er wiederum sie – insofern wird das Phänomen von Dauer sein.
#20